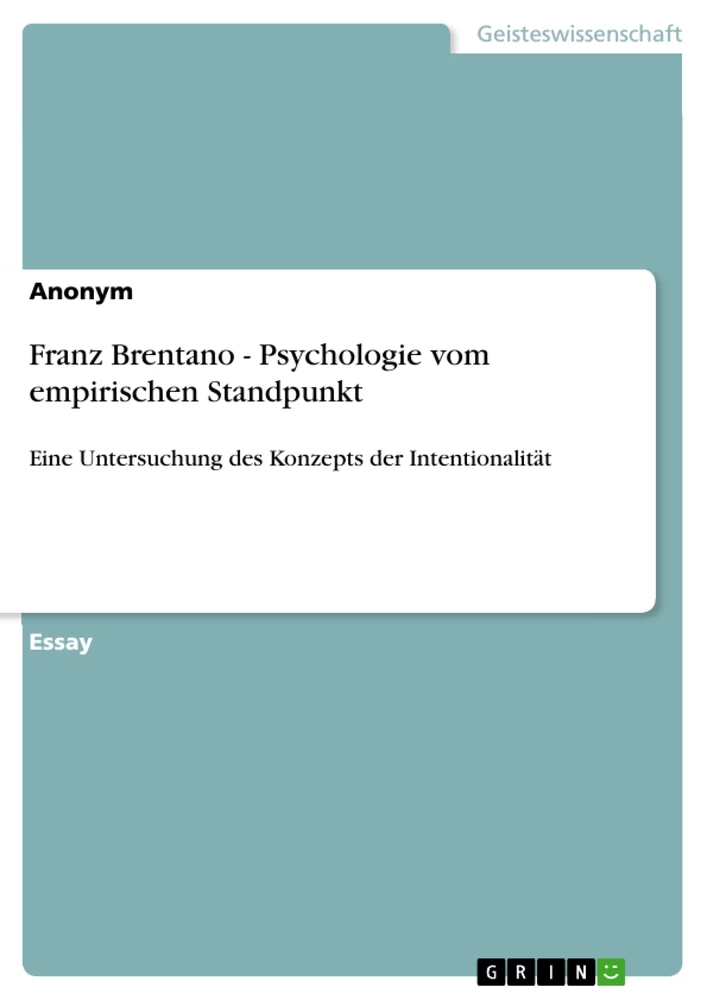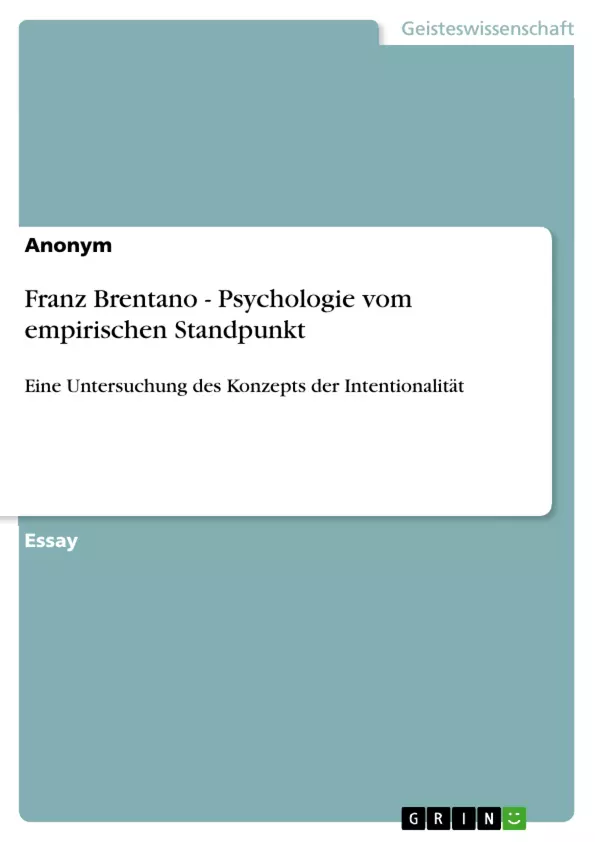Einleitung
Franz Brentano war nicht der erste, der auf das Konzept der Intentionalität gestoßen ist. Er selbst bezieht sich im 1874 erschienenen „Psychologie vom empirischen Standpunkt“ (von nun an: PeS) auf Aristoteles und auf die Scholastiker des Mittelalters. Heidegger gibt an, dass sich Brentano vornehmlich auf Thomas von Aquin und auf Suarez bezogen hat. Dale Jacquette bestätigt dies, und fügt der Aufzählung die Namen Duns Scotus, Ockham und des Vertreters der common-sense Philosophie Thomas Reid hinzu. Bei letzterem taucht die Intentionalität, wie man es auch bei Brentano feststellen kann, als das auszeichnende Merkmal des Geistes („mind“) auf.
Die Scholastiker waren laut Heidegger weit davon entfernt, den „Sinn dieser Struktur grundsätzlich zu begreifen“. Sie hätten die Intentionalität nur dem Willen zugesprochen (als intentio des Willens, der voluntas), und es sei Brentano gewissermaßen zu verdanken, dass er das Konzept der Intentionalität zurück auf die Tagesordnung der Philosophie gebracht habe. Brentanto habe das Phänomen der Intentionalität zwar selber auch nicht „hinreichend begriffen“, dennoch gelang ihm eine schärfere Umgrenzung und Betonung der Wichtigkeit dieser Struktur als er behauptete, man müsse alle psychischen Phänomene (und nicht nur den Willen) auf diese zurückführen und sie anhand dieser klassifizieren.
1. Einleitung
Franz Brentano war nicht der erste, der auf das Konzept der Intentionalität gestoßen ist. Er selbst bezieht sich im 1874 erschienenen „Psychologie vom empirischen Standpunkt“ (von nun an: PeS) auf Aristoteles und auf die Scholastiker des Mittelalters.[1] Heidegger gibt an, dass sich Brentano vornehmlich auf Thomas von Aquin und auf Suarez bezogen hat.[2] Dale Jacquette bestätigt dies, und fügt der Aufzählung die Namen Duns Scotus, Ockham und des Vertreters der common-sense Philosophie Thomas Reid hinzu. Bei letzterem taucht die Intentionalität, wie man es auch bei Brentano feststellen kann, als das auszeichnende Merkmal des Geistes („mind“) auf.[3]
Die Scholastiker waren laut Heidegger weit davon entfernt, den „Sinn dieser Struktur grundsätzlich zu begreifen“. Sie hätten die Intentionalität nur dem Willen zugesprochen (als intentio des Willens, der voluntas), und es sei Brentano gewissermaßen zu verdanken, dass er das Konzept der Intentionalität zurück auf die Tagesordnung der Philosophie gebracht habe. Brentanto habe das Phänomen der Intentionalität zwar selber auch nicht „hinreichend begriffen“, dennoch gelang ihm eine schärfere Umgrenzung und Betonung der Wichtigkeit dieser Struktur als er behauptete, man müsse alle psychischen Phänomene (und nicht nur den Willen) auf diese zurückführen und sie anhand dieser klassifizieren.[4]
2. Der Gegenstand der empirischen Psychologie
Brentano suchte ein Merkmal anhand dessen man physische von psychischen Phänomenen unterscheiden könne. Im Sinn hatte er die Etablierung der Psychologie als einer ausreichend begründeten, d.h. sich auf empirische Daten stützenden Wissenschaft. Im Vorwort zur PeS schreibt Brentano: „Wir müssen hier das zu gewinnen trachten, was die Mathematik, Physik, Chemie und Physiologie, die eine früher, die andere später, schon erreicht haben; einen Kern allgemein anerkannter Wahrheit“[5] Brentano versuchte der Psychologie Eigenständigkeit zu verleihen und ihr ein Fundament zu geben, was dem Anspruch der damaligen Zeit auf Wissenschaftlichkeit, d.h. Nachweisbarkeit Genüge tat.
Laut Brentano habe die Psychologie den empirischen Wissenschaften gegenüber sogar einen großen Vorzug. Während sich alle Naturwissenschaften nur mit Phänomenen beschäftigen und nie mit den Dingen wie sie 'an sich' wirklich sind, besitzen die psychischen Phänomene[6] eine Evidenz, die nicht geleugnet oder angezweifelt werden kann: „Die Wahrheit der physischen Phänomene ist, wie man sich ausdrückt, eine bloß relative Wahrheit. Anderes gilt von den Phänomenen der inneren Wahrnehmung. Diese sind wahr in sich selbst. Wie sie erscheinen – dafür bürgt die Evidenz, mit der sie wahrgenommen werden -, so sind sie auch in Wirklichkeit.“[7]
Psychologen können und sollen sich auf die innere Wahrnehmung stützen und sie als „Lehrmeisterin“ betrachten. Es war Brentano bewusst, dass ein Erkenntnisgewinn aus dem Selbstbewusstsein problematisiert werden muss. Er wendet sich stark gegen die zu seiner Zeit verbreitete Auffassung, man könne durch Beobachtung der Gefühle und Bewusstseinszustände Aufschluss über den Gehalt dieser Gefühle erlangen oder diese Beobachtung für eine Klassifizierung nutzbar machen. Sogenannte Introspektoren wurden in der damaligen Psychologie beschäftigt, die aus der genauen Selbstbeobachtung heraus Aussagen über die Beschaffenheit der psychischen Phänomene machen sollten.
Brentano meinte, dass man auf psychische Phänomene niemals die Aufmerksamkeit lenken könne, weil wenn dies passieren würde, die Phänomene schon nicht mehr vorhanden wären. „Denn wer den Zorn, der in ihm glüht, beobachten wollte, bei dem wäre er offenbar bereits gekühlt, und der Gegenstand der Beobachtung verschwunden.“[8]
Auch wenn man z.B. Gefühle nicht beobachten könne, kann man sich mithilfe des Gedächtnisses auf diese Zustände beziehen. Und auch wenn diese immer eine gewisse Einzigartigkeit aufweisen, sind sie aus bestimmten Gründen doch mitteilbar.[9]
[...]
[1] Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Band 1, S. 124-125.
[2] Martin Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, S. 81.
[3] Dale Jacquette, Brentano's concept of intentionality, S. 99.
[4] Vgl.: Heidegger, a.a.O., S. 81.
[5] Brentano, a.a.O., S. 2.
[6] Brentano versteht laut Kraus Phänomen hier als Tätigkeit, also die Beziehung zu einem Objekt, welche immer 'real' ist. Vgl.: Oskar Kraus, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Anmerkungen des Herausgebers, S. 265-266.
[7] Brentano, a.a.O., S. 29.
[8] Ebd.: S. 41.
[9] Ebd.: S. 45.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Franz Brentano - Psychologie vom empirischen Standpunkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205171