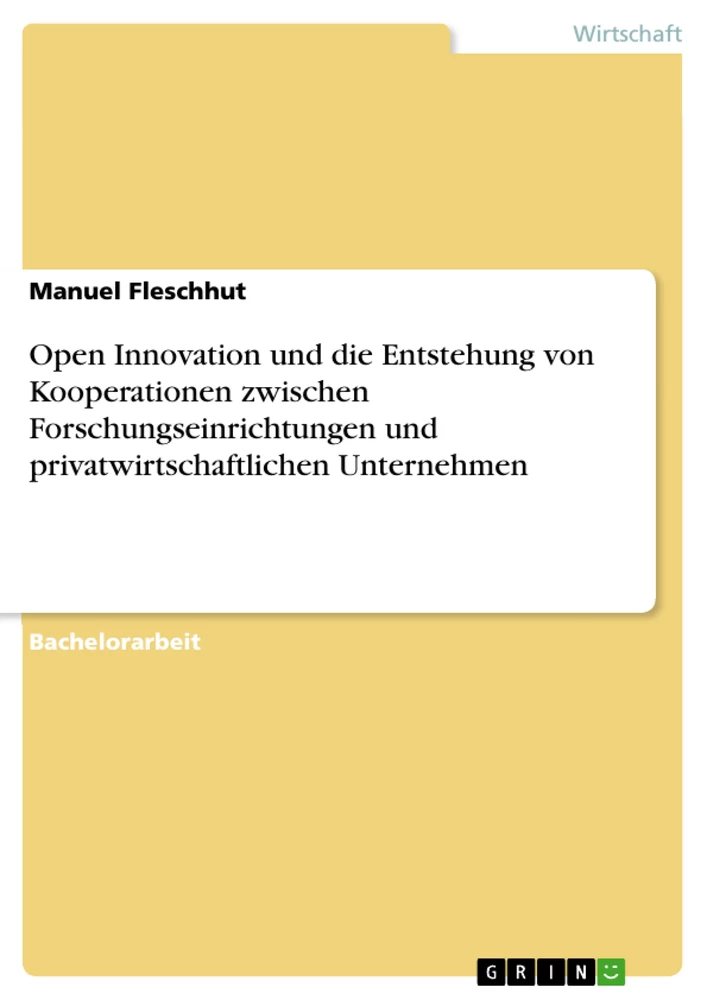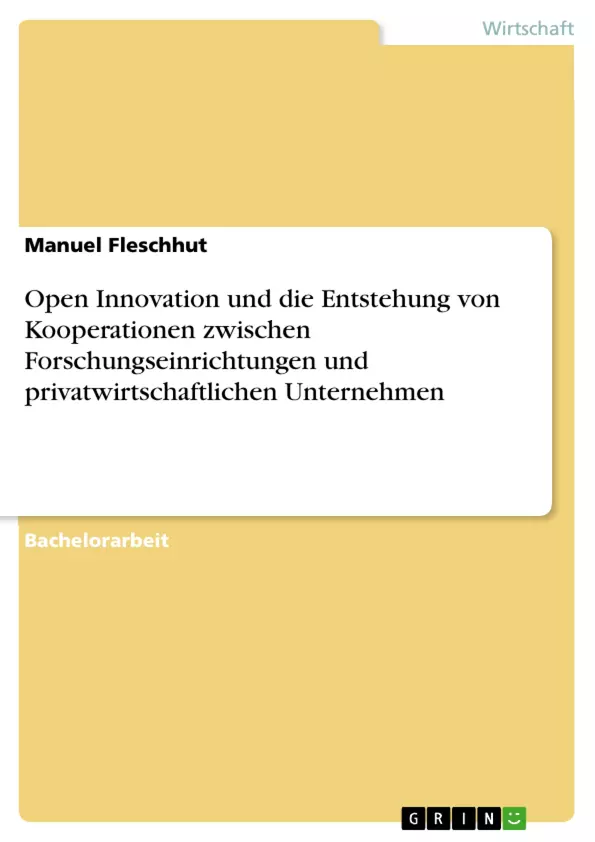Die Einbindung externer Partner in den Innovationsprozess ist entscheidend für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen, da die benötigten Ressourcen ausschließlich betriebsintern nicht mehr effizient erbacht werden können. Die Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen ist hierbei eine Möglichkeit das Paradigma der Open Innovation zu implementieren. Ziel dieser Arbeit ist es, die Entstehung solcher Kooperationsformen mithilfe des Abgleichs konzeptioneller Studien mit empirsch gewonnenen Informationen zu beschreiben. Hierbei wird deutlich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Wissenschaft in einem konfliktären Spannungsfeld zwischen akademischer Relevanz und der konkreten Produktentwicklung befindet. Diese negative Wechselwirkung führt zu einer Typologisierung der unterschiedlichen Kooperationsausprägungen. Daraus lässt sich ableiten, dass sich der Konflikt zwischen wissenschaftlichem Output und betriebswirtschaftlichem Nutzen durch eine wiederkehrende Zusammenarbeit der beiden Institutionen auflösen lässt.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Einbezug von Forschungseinrichtungen in den Innovationsprozess
2.1 Innovation & Innovationsprozesse
2.1.1 Der Zwang zur Innovation
2.1.2 Forschung und Entwicklung im Wandel
2.2 Open Innovation
2.2.1 Vom Closed- zum Open Innovation Paradigma
2.2.2 Externe Kooperationspartner
2.3 Die deutsche Forschungslandschaft
2.3.1 Forschungsinstitute
2.3.2 Hochschulen
2.3.3 Industrielle Forschung
2.4 Prozessmodell zur Entstehung von U-I Kooperationen
2.4.1 Chronologischer Ablauf von U-I Kooperationen
2.4.2 Kritische Erfolgsfaktoren
3 Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus motivationsorientierter Sichtweise
3.1 Kooperationsgründe aus Sicht der Forschungseinrichtungen
3.1.1 Akademischer Output
3.1.2 Ökonomische Beweggründe
3.1.3 Lerneffekte
3.1.4 Marketing
3.2 Kooperationsgründe aus Sicht der Unternehmen
3.2.1 Konkrete Produktentwicklung
3.2.2 Ökonomische Beweggründe
3.2.3 Lerneffekte
3.2.4 Marketing
4 Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus typologischer Sichtweise
4.1 Kooperationen im Bereich der Problemlösung
4.2 Kooperationen im Bereich der Technologieentwicklung
4.3 Kooperationen im Bereich der Ideenprüfung
4.4 Kooperationen im Bereich der Wissensgenerierung
4.5 Kooperationen im Bereich der multiplen Zusammenarbeit
5 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Innovationszwang
Abbildung 2: Traditioneller F&E Prozess
Abbildung 3: Inkrementeller F&E Prozess
Abbildung 4: Das Open Innovation Paradigma
Abbildung 5: Die deutsche Forschungslandschaft
Abbildung 6: Die fünf Phasen von U-I Kooperationen
Abbildung 7: U-I Kooperationsgründe
Abbildung 8: Typologisierung von U-I Kooperationen.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Open Innovation Kooperationen
Tabelle 2: Typologisierung Praxispartner
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
In der Gegenwart sehen sich Unternehmen mit stärkerer globalisierter Konkurrenz, höherer Produktvariabilität sowie stetigem Innovationsdruck konfrontiert. Als Konsequenz dieser sich ständig wandelnden ökonomischen Rahmenbedingungen müssen Unternehmen neue Wege der Innovation erschließen, um in internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben (Lichtenthaler 2011, S.75). Ein Weg sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen, ist die Öffnung des Innovationsprozesses innerhalb des Unternehmens und die Einbindung externer Kooperationspartner in die Erforschung und Entwicklung neuer Produkte. Chesbrough (2003, S.51) definiert diese neue Innovationslogik, der Öffnung des betriebsinternen Produktentwicklungsprozesses, als Open Innovation. Dieser Paradigmenwechsel wird in der betriebswirtschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschung seit der Arbeit von Chesbrough (2003) diskutiert, genauer bestimmt und mit bestehenden Theorien des Technologiemanagements verglichen, um neue Erklärungsansätze dafür zu liefern, warum Firmen wachsen oder scheitern. Nach Chesbrough (2003, S.40) können Unternehmen ihren Innovationsprozess durch die Einbindung von Kunden, Zulieferer, Forschungseinrichtungen, Allianzen, Beratungsfirmen sowie durch die Kooperation mit Existenzgründern öffnen. Diese Arbeit fokussiert sich auf die Einbindung externer Forschungseinrichtungen in den Innovationsprozess.
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es zu erläutern wie Kooperationen zwischen Wissenschaft und Privatwirtschaft entstehen und in welcher Form diese zustande kommen. Existierende Studien über die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen innerhalb des Open Innovation Ansatzes, fokussieren sich zumeist auf eine unternehmenszentrische Betrachtungsweise (Teixeira und Pinheiro 2010, S.1). Diese Abhandlung erschließt den Kooperationsprozess aus einer dualperspektivischen Sichtweise. Daher werden Unternehmens- und Forschungsseite gleichberechtigt behandelt. Im Verlauf der Arbeit werden auch empirisch erhobene Daten eingebunden. Damit wird die Situation in Deutschland mit stärker international ausgerichteten Forschungsergebnissen kritisch abgeglichen, um somit eine Symbiose von Theorie und Praxis zu erreichen. Ziel ist es, die Motivationen der beiden Akteure theoretisch und empirisch zu erschließen und die Umsetzung der Kooperationen, darauf aufbauend, in typologischer Sichtweise aufzuarbeiten.
Die Abhandlung erschließt die komplexe Entstehung von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen mithilfe einer deduktiven Vorgehensweise. Es wird also vom Allgemeinen auf das Besondere geschlossen. Durch diese Abfolge ist auch der Ablauf der Arbeit bestimmt. Zunächst werden U-I[1] Kooperationen in Hinblick auf ihre Stellung innerhalb des Open Innovation Paradigmas eingeordnet und von anderen Formen der Zusammenarbeit im Bereich des Produktentwicklungsprozesses abgegrenzt. Hierbei wird auch auf die wandelnde Bedeutung der Forschung und Entwicklung (F&E) innerhalb privatwirtschaftlichen Organisationen eingegangen. Darauffolgend soll die deutsche Forschungslandschaft typologisiert werden um die unterschiedlichen Ausrichtungen der Institutionen aufzuzeigen. Im Weiteren wird ein erstes Prozessmodell zur Entstehung von U-I Kooperation vorgestellt und innerhalb des Innovationsprozesses erläutert. Ein weiterer zentraler Punkt der Arbeit ist die dualperspektivische Untersuchung der Kooperationsgründe der beiden beteiligten Akteure. Mithilfe der theoretischen Analyse bestehender Literatur und der Ergänzung durch die empirisch gewonnenen Daten der Interviews werden die Motivationsgründe der Parteien getrennt voneinander herausgearbeitet. Durch die Gegenüberstellung der verschiedenen Motivationsgründe werden mögliche Konflikte zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen dargelegt und erläutert. Anschließend erfolgt anhand der bisherigen herausgearbeiteten Ergebnisse eine qualitative Klassifizierung der Kooperationsformen entlang des Spannungsfeldes der unterschiedlichen Grundausrichtungen der beiden Organisationen. Abschließend erfolgen eine kritische Beantwortung der Forschungsfrage sowie ein kurzer Ausblick für eine mögliche weitere Forschung.
2 Der Einbezug von Forschungseinrichtungen in den Innovationsprozess
Das folgende Kapitel beschreibt die ökonomische Notwendigkeit für Firmen effektives Innovationsmanagement zu betreiben. Des Weiteren wird erläutert, warum das alte, innerbetriebszentrische Modell der Produktentwicklung in der heutigen makroökonomischen Realität nicht mehr konkurrenzfähig ist und Unternehmen verstärkt externe Partner in den Innovationsprozess einbinden.
2.1 Innovation & Innovationsprozesse
Innovation ist die Umsetzung von Ideen (Invention) innerhalb einer Organisation mit dem betriebswirtschaftlichen Ziel neue oder verbesserte Produkte am Markt anzubieten (Brown und Duguid 2010, S.155).
2.1.1 Der Zwang zur Innovation
Durch Globalisierung, moderne Informationstechnologie und den gesellschaftlichen Wandel ändert sich auch die ökonomische Realität in denen privatwirtschaftliche Unternehmen agieren. Produktlebenszyklen werden kürzer und Kundenansprüche, durch das verstärkte Angebot, höher. Betriebsinterne Produktneuentwicklungen werden zügiger durch Konkurrenten imitiert und dadurch sinken die Innovationsvorteile immer schneller. (Stern und Jaberg 2010, S.3). Des Weiteren kommt es durch die exponentielle Entwicklung des wissenschaftlichen Fortschritts zu immer komplexeren technischen Möglichkeiten mit welchen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, um neue Produkte zu entwickeln (Iansiti 1998, S.210).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Innovationszwang (In Anlehnung an Stern und Jaberg 2010, S.3)
Durch diese externen Faktoren (siehe Abbildung 1) ergibt sich für Unternehmen die Notwendigkeit ein Innovationsmanagement zu betreiben welches zu immer schnelleren und effektiveren Produktneuentwicklungen imstande ist.
2.1.2 Forschung und Entwicklung im Wandel
Forschung und Entwicklung (F&E) ist ein zentraler Aspekt der industriellen Firma. F&E kann als Ursprungsquelle von unternehmensinternen Innovationen und deren Umsetzung in marktfertige Produkte angesehen werden. Daher kommt diesem Bereich der Unternehmung eine elementare Erfolgsrolle zu. Forschung ist die spezialisierte und isolierte Gewinnung von neuem Wissen, wobei Entwicklung hingegen marktgerichtet ist und versucht neue Produkte zu generieren, um den zukünftigen Erfolg der Unternehmen zu sichern (Iansiti 1998, S.13). Der traditionelle Ansatz um den Vorgang der Produktentwicklung zu erläutern wird durch folgendes Schaubild (Abbildung 2) verdeutlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Traditioneller F&E Prozess (In Anlehnung an Iansiti 1998, S.15)
Der Innovationsprozess innerhalb des Unternehmens ist gekennzeichnet durch eine unilaterale Beziehung zwischen den beiden Akteuren. Die Aufgabe der Forschungsabteilung liegt darin neues Wissen zu generieren und diese wissenschaftlichen Ergebnisse an die Entwicklungsabteilung zu übermitteln, welche aus den bereitgestellten Daten ein marktfertiges Produkt generiert. Diese Isolation von Forschung und Entwicklung des konventionellen Modells der Produktentwicklung wird zunehmend kritisch betrachtet, aufgrund seiner geringen Effizienz. Das Paradigma der unabhängigen und freien Wissenschaft führt zu einer geringen Praxisorientierung der Forschung. Dies resultiert in einer zunehmenden Unfähigkeit technologische Neuentwicklungen innerhalb der Firma zu generieren (Iansiti 1998, S.16).
Daher versuchen Unternehmen den innerbetrieblichen Innovationsprozess stärker inkrementell zu gestalten (Abbildung 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Inkrementeller F&E Prozess (In Anlehnung an Iansiti 1998, S.15)
Der inkrementelle F&E Prozess ist gekennzeichnet durch eine intermediäre Vernetzung der beiden Parteien. Die bis dahin rein wissenschaftlich ausgerichtete Forschungsabteilung beschäftigt sich nun auch verstärkt mit der praxisorientierten Umsetzung des akademischen Outputs. Auf der anderen Seite ist die Entwicklungsabteilung stärker in den Wissensgenerierungsprozess eingebunden. Es kommt also zu Rückkopplungseffekten und einer verstärkter Interaktion zwischen der innerbetrieblichen F&E. Zwingend notwendig hierfür ist eine effiziente Organisation dieser Beziehung sowie eine verstärkte Kommunikation zwischen den beiden Akteuren. Der technische Integrationsprozess ist auch davon abhängig, ob es der Firma durch ein effektives Change Management gelingt, dass inkrementelle Innovationsmodell innerbetrieblich zu implementieren (Iansiti 1998, S.16-17). Die Interaktionsnotwendigkeit von F&E ist auch darin begründet, dass der technologische Fortschritt und die Entwicklungsarbeit immer komplexer werden und daher fachspezifische Methoden der Wissenschaft innerhalb der Produktentwicklung an Bedeutung zunehmen (Iansiti 1998, S.210).
Daraus folgernd lässt sich schließen, dass die benötige Zunahme der Wissensgenerierung und Umsetzung nicht mehr ausschließlich innerbetrieblich erfolgen kann. Das benötigte akademische und technologische Fachwissen lässt den rein betriebsinternen Prozess der F&E immer ressourcenintensiver werden. Eine Möglichkeit diesem Dilemma entgegenzutreten ist, wie folgend beschrieben, die Einbindung externer Partner in den Innovationsprozess.
2.2 Open Innovation
Der Innovationsprozess innerhalb des Unternehmens ist einer stetigen Veränderung unterworfen. Firmen müssen den betriebsinternen F&E Prozess verstärkt mit extern erbrachten Ideen ergänzen um weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Diese Einbindung von außerbetrieblichen Ideen und Wissen zur Entwicklung neuer, marktgerechter Produkte nennt man Open Innovation (Chesbrough 2003, S.xxiv).
2.2.1 Vom Closed- zum Open Innovation Paradigma
Die rein unternehmenszentrische Generierung von neuen Erkenntnissen und deren Umsetzung in neue Produkte und Services bezeichnet man nach Chesbrough als Closed Innovation. Der F&E kam hierbei die alleinige Aufgabe der Ideengenerierung, Auswahl und marktorientierte Umsetzung dieser zu. Dieses introvertierte Paradigma war maßgeblicher Standard für die industrielle Produktentwicklung im 20. Jahrhundert (Chesbrough 2003, S.30).
Durch verschiedene externe, ökonomische und gesellschaftliche Faktoren kommt es zur Erosion des Closed Innovation Paradigmas. Erstens ist aufgrund der zunehmenden Bildungsexpansion und des daraus resultierenden verstärkten Angebots an akademisch ausgebildetem Personal eine stärkere Fluktuationsrate auch in innerbetrieblichen F&E Abteilungen gegeben. Einzelne Forscher und Entwickler arbeiten während ihrer Karriere für mehrere Firmen und dadurch kommt es zu einem vermehrten Wissenstransfer. Zweitens ist durch die zunehmende Verfügbarkeit von Risikokapital die Umsetzung von Ideen mit Hilfe einer Existenzgründung leichter geworden. Privatwirtschaftliche Firmen sehen sich daher einer gehäuften Konkurrenz von technologieorientieren Startups gegenüber. Drittens können neue Ideen oftmals einfacher außerhalb der eigenen Firma umgesetzt werden. Durch zunehmenden Globalisierung und Entmonopolisierung ist es möglich geworden, umfassende F&E Projekte bei verschiedenen Firmen umzusetzen. Viertens wäre die Zunahme externen Zulieferer zu nennen. Diese besitzen verstärktes akademisches und technologisches Fachwissen und sind daher eher in der Lage dem F&E Prozess vorgelagert zu dienen (Chesbrough 2003, S.34-39).
Daraus resultierend ergibt sich die verstärkte Öffnung des Innovationsprozesses (Abbildung 4)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Das Open Innovation Paradigma (In Anlehnung an Chesbrough 2003, S.44)
Open Innovation (OI) ist also die verstärkte Einbindung externer Partner in den Innovationsprozess. Diese Entwicklungsabläufe können nun innerhalb und außerhalb der Firma entstehen. Die externe Verwirklichung von F&E ist dabei auch separat umsetzbar. Daher können zum Beispiel Abschnitte des Forschungsprozesses innerhalb der Firma, die Umsetzung des Produktes jedoch komplett extern erfolgen. Dabei ist herauszustellen, dass OI als Ergänzung zum betriebsinternen F&E zu sehen ist, welches immer noch entscheidend an allen Innovationsprozessen teilnimmt. Die Entwicklung von Closed- zu Open Innovation ist also nicht die Konsequenz des Scheiterns der innerbetrieblichen F&E, sondern ein Resultat externen Erosionsfaktoren, welche neue Gestaltungsmöglichkeiten für Innovationsprozesse möglich machen.
2.2.2 Externe Kooperationspartner
Durch das OI Paradigma hat sich ein zunehmend komplexerer Innovationsprozess entwickelt, welcher durch mehr Variabilität und die Einbindung externer Partner gekennzeichnet ist. Dabei können verschiedene Partner ausgewählt werden. Eine grob orientierte Typologisierung dieser Beziehungen zwischen Unternehmen und externen Organisation zeigt die Forschung von Sofka und Grimpe (2010, S.319) auf. Die möglichen Kooperationspartner lassen sich anhand ihrer Wissensgebiete wie folgt (Tabelle 1) klassifizieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Open Innovation Kooperationen (In Anlehnung an Sofka und Grimpe 2010, S.319
Marktorientierte Partner innerhalb des Innovationsprozesses sind gekennzeichnet durch ihr spezifisches Praxiswissen. Kooperationsformen dieser Art sind vor allem praxisorientiert und es geht häufig darum, Produkte/Services zu verbessern statt vollkommen neuartige Konzepte zu testen. Die empirisch geprägte Forschung von Sofka und Grimpe (2010, S.319) zeigt auch, dass der Innovationserfolg einzig bei dieser Kooperationsform positiv mit den Ausgaben für die hauseigenen F&E korreliert. Es gibt also keinen Substitutionseffekt von betriebsinterner F&E und externen marktorientierten Kooperationspartnern. Die zunehmend praktische Ausrichtung von Forschungseinrichtungen (Nelson 2004, S.455) ermöglicht eine stärkere Kooperationsbereitschaft zwischen Unternehmen und Wissenschaft. Diese agiert dabei nicht ergänzend zur betriebsinternen F&E, sondern substitutional. Kooperationsformen mit versorgungsorientierten Partnern sind ebenfalls in Bezug auf die betriebsinterne F&E substitutionaler Natur. Beispielsweise können vorgelagerte Schritte des Innovationsprozesses durch Zulieferer erfolgen. (Sofka und Grimpe 2010, S.319).
Die Wahl des Kooperationspartners ist durch die Art und den Beitrag der hauseigenen F&E Abteilungen determiniert. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Unternehmen sind vor allem bei komplexen Themengebieten sinnvoll, wobei Partnerschaften mit marktorientierten Akteuren bei der Produktoptimierung eingesetzt werden. Im Folgenden werden forschungsorientierte Kooperationen näher betrachtet.
2.3 Die deutsche Forschungslandschaft
Forschung in Deutschland findet staatlich gefördert sowie privatwirtschaftlich organisiert statt. Nach DAAD (2012, S.6) kann man die wichtigsten nationalen Forschungstypen anhand der akademischen Ausrichtung und der Mittelherkunft klassifizieren (Abbildung 5). Die Größe der Kreise ergibt sich aus dem jährlichen Forschungsbudget im Verhältnis zu den gesamten Forschungsausgaben aller hier erläuterten Einrichtungen. Der Begriff Forschungseinrichtung wie er in dieser Arbeit verwendet wird, ergibt sich aus den erläuterten Organisationen in 2.3.1 und 2.3.2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Die deutsche Forschungslandschaft (In Anlehnung an DAAD 2012, S.6)
2.3.1 Forschungsinstitute
Die vier wichtigsten deutschen Forschungsorganisationen sind Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Fraunhofer-Gesellschaft. Die Ausrichtungen dieser Organisationen sind sehr unterschiedlich. In Hinblick auf das Open Innovation Paradigma ist vor allem die besondere Stellung der Fraunhofer-Institute zu betrachten. Diese betreiben anwendungsorientierte Wissenschaft und ca. 80% des jährlichen Budgets wird durch Auftragsforschung eingeworben. Daher ergibt sich eine verstärkte Notwendigkeit zur Kooperation mit der Industrie. Die Hauptforschungsgebiete sind hierbei die Ingenieurs- und Biowissenschaften. Die Leibniz-Gemeinschaft ist durch ein sehr breites Fächerspektrum und die unabhängigen Institute gekennzeichnet. Die Forschungsbandbreite ist eine Symbiose aus Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung. Die private Finanzierung ist relativ stark, was vor allem auf die praxisorientierten Ingenieurs- und Biowissenschaften zurückzuführen ist. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist durch Großforschung und öffentlicher Finanzierung geprägt und daher weniger dem projektorientierten OI Paradigma zuzuordnen. Die Max-Planck-Gesellschaft ist durch eine reine Grundlagenforschungsorientierung gekennzeichnet. Zur Kooperationen mit Firmen kommt es daher selten. (DAAD 2012, S.8-14)
2.3.2 Hochschulen
Die deutsche Hochschullandschaft ist geprägt durch 170 Universitäten und gleichgestellten Einrichtungen mit Promotionsrecht und ca. 200 Hochschulen (ehemals Fachhochschulen), welche sich verstärkt auf eine praxisorientierte Ausbildung ihrer Studenten konzentrieren. Die thematisch abgedeckte Forschung innerhalb dieser Organisationen vollstreckt sich über das komplette wissenschaftliche Spektrum. Die Hochschulen ohne Promotionsrecht konzentrieren sich hierbei verstärkt auf die Ingenieurs-, sowie Wirtschaftswissenschaften. (DAAD 2012, S.17).
2.3.3 Industrielle Forschung
Die zusammengefasste privatwirtschaftliche Forschung ist mit einem jährlichem, intern verwendeten, Budget von knapp 46 Mrd. € der mit Abstand größte Forschungsfinanzier in Deutschland. Die drei größten F&E Ausgabenbereiche nach Sektoren ergeben sich in der Automobilindustrie (38%), im sonstigen Ingenieursbereich (30%), sowie in der chemischen Industrie (14%). Diese Ausgaben sind eine Grundlage für die Innovationskraft der deutschen Industrie (DAAD 2012, S.26). Die Höhe der privatwirtschaftlichen Ausgaben für F&E zeigt die immer noch sehr starke Bedeutung des internen Innovationsprozesses zur Produktentwicklung in der deutschen Wirtschaft.
2.4 Prozessmodell zur Entstehung von U-I Kooperationen
Die vorigen Kapitel haben die Bedeutung von Innovationen für Unternehmen erläutert und aufgezeigt, dass Firmen ihren F&E Prozess verstärkt öffnen müssen, um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Die Kooperation mit Forschungseinrichtungen stellt dabei eine Möglichkeit der externen Wissenseinbindung dar. Die Forschungsarbeit von Philibin (2008, S.496) bildet einen ersten Ansatz U-I Kooperationen aus chronologischer Entstehungsperspektive zu verstehen. Die folgende Grafik (Abbildung 6) teilt den Kooperationsprozess in fünf aufeinanderfolgenden Phasen ein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Die fünf Phasen von U-I Kooperationen (In Anlehnung an Philibin 2008, S.496)
Im Folgenden werden die einzelnen Phasen erläutert und aufgezeigt, welche Erfolgsfaktoren innerhalb des Prozesses bestehen.
2.4.1 Chronologischer Ablauf von U-I Kooperationen
Zunächst versuchen Unternehmen und Forschungseinrichtungen getrennt voneinander Ideen für eine mögliche Kooperation zu finden. Beide Parteien müssen sich über die vorhandenen Ressourcen ihrer Institution im Klaren sein. Dabei müssen beide Akteure sich jeweils auch in die Perspektive der anderen Partei hineinversetzen können. Ein entscheidender Punkt der Ideenphase ist die erste informale Kontaktaufnahme zwischen Individuen der beiden Organisationen (Philibin 2008, S.501).
Die Forschung von Ahrweiler et al. (2011, S.218) macht deutlich, dass die verstärkte Suche nach Drittmitteln von Seiten der Forschungseinrichtungen, insbesondere Hochschulen, auch durch politischen Druck entsteht. Die moderne Hochschule soll nicht mehr nur ein Ort von Forschung und Lehre sein, sondern auch einen direkten Beitrag zur technologischen Entwicklung der Volkswirtschaft beitragen.
Die erste informelle Kontaktaufnahme zwischen den beiden Institutionen kommt in den meisten Fällen durch den persönlichen Kontakt zweier Individuen der jeweiligen Organisationen zustande (Bergman 2010, S.318).Diese Hypothese lässt sich auch durch die für diese Arbeit vollzogenen Interviews bekräftigen (Interview 1; Interview 5). Daraus lässt sich schließen, dass Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen weniger stark formalisiert sind als andere Kooperationen und das persönliches Vertrauen der Akteure von großer Bedeutung ist. Dies resultiert auch darin, dass die geographische Distanz zwischen den beiden Akteuren zumeist gering ist und ein regelmäßiger Austausch zwischen den beiden Organisationen stattfindet (Interview 1; Interview 7). Dies bestätigen auch die empirischen Forschungsergebnisse von Asakawa et al. (2010, S.120), wobei auch herausgestellt wird, dass Kooperationen mit stärkerer Interaktion nicht erfolgreicher sind als jene mit weniger regelmäßigem Austausch.
Verlief das initiale Gespräch erfolgreich, kommt es zur Vorschlagsphase. In dieser machen beiden Parteien ein Angebot darüber wie die Kooperation im Allgemeinen aussehen soll. Dabei wird festgelegt was das Ziel der Forschung ist und welche Ressourcen benötigt werden. Des Weiteren muss in dieser Phase die erste Kontaktaufnahme mit den zuständigen höheren Entscheidungsstellen der jeweiligen Organisation vollzogen werden. (Philibin 2008, S.502).
Entscheidend in dieser Phase ist die Unterstützung des Forschungsvorhaben durch die jeweils organisatorisch übergeordneten Stellen (Asakawa et al. 2010, S.112). Die erste Kontaktaufnahme zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen geschieht zwar durch einen persönlichen Austausch zweier oder mehrerer sich bekannter Individuen. Das Fortschreiten des Prozesses ist jedoch davon abhängig, ob die beiden Organisationen von der Firmenkultur heraus offen für eine solche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sind.
Anschließend folgt die Initiierungsphase. In dieser wird die Zusammenarbeit formalisiert und vertraglich festgelegt. Hier sind der erwartete Output der Zusammenarbeit und die benötigten monetären, sowie nichtmonetären Mittel, zu vereinbaren. Des Weiteren wird bestimmt wie das Vorhaben gesteuert werden soll und wer die Rechte am entstehenden geistigen Eigentum hat (Philibin 2008, S.503).
Entscheidend in dieser Phase ist die Höhe der entstehenden Transaktionskosten. Diese ergeben sich aus der notwendigen Verhandlung der beiden Akteure über die genauen Umstände der Zusammenarbeit (Coase, 1937, S.390). Sind die durch die Vertragsverhandlung verursachten Transaktionskosten zu hoch, so ist es für beide Seiten, oder für eine Seite, nicht mehr rentabel eine Kooperation einzugehen. Daraus abzuleiten wäre, dass Unternehmen bevorzugt mit bereits bekannten Partnern kooperieren und somit die Verhandlung, aufgrund der Erfahrung, schneller zum Abschluss kommt. Je öfters es also zu einer Zusammenarbeit zwischen zwei Organisationen kommt, desto geringer sind die Transaktionskosten und entsprechend höher sind die Chancen, dass es zum Vertragsabschluss kommt.
Danach kommt es zur Entwicklungsphase. In dieser wird die eigentliche Kooperation und somit die Forschung und Entwicklung vollzogen. Es kommt zum regelmäßigen Treffen der beiden organisatorischen Akteure und es wird ein operatives Management eingeführt, welches den Fortschritt des Projektes steuern und kontrollieren soll. (Philibin 2008, S.504).
Abschließend kommt es zur Evaluierungsphase. In dieser wird das Projekt mit den in der dritten Phase vertraglich festgelegten Vorgaben verglichen. Hierbei sind die entstehenden Resultate zu bewerten und es kommt gemeinhin zu einer Entscheidung darüber, ob das Projekt erfolgreich war. Wichtig in dieser Phase ist eine mögliche Fehlerfindung, um Lerneffekte für zukünftige Projekte zu generieren (Philibin 2008, S.504).
Entscheidend in dieser Phase ist die Einschätzung darüber, ob die Kooperation erfolgreich war oder nicht. Philibin (2008, S.504) geht hierbei davon aus, dass sich der finanzielle und nichtmonetäre Gewinn für beide Organisationen einfach bestimmen lässt. Die Forschungsergebnisse von Kleyn et al. (2007, S.343) widersprechen dieser Vorstellung jedoch. Der Erfolg von U-I Kooperationen ist schwer zu messen. Zum einen sind die Lebenszyklen einzelner Produkte sehr unterschiedlich und der Gewinn der Forschung zeigt sich oftmals erst nach mehreren Jahren. Des Weiteren sind auch der akademische Output und der langfristige Erfolg für die beteiligten Forscher ungewiss. Das Verfassen von Artikeln für Fachjournale ist ein langwieriger Prozess und daher kann der wissenschaftliche Output erst nach einer längeren Zeitspanne bemessen werden. Ahrweiler et al. (2011, S.343) zeigen durch ihre ökonometrisch ausgerichtete Forschung, dass Innovationserfolge von Projekten zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen oftmals multikooperativ auftreten. Daher ist der Erfolg des singulären Projekts oftmals nicht bestimmbar. Zusammenfassend ist die Evaluierungsphase aus prozessorientierter Sichtweise zwar notwendig und teilweise auch durchführbar, aber die Projektevaluierung ist schwierig und oftmals nur zeitlich verzögert möglich.
2.4.2 Kritische Erfolgsfaktoren
Ist die Kooperation erst einmal eingeleitet, so gibt es verschiedene Faktoren welche den Erfolg innerhalb der Phasen determinieren.
Zunächst ist die soziale Interaktion zwischen den teilnehmenden Kooperationspartner von großer Bedeutung für die Entstehung und den Fortbestand der Zusammenarbeit. Dieser Vertrauensfaktor entsteht durch den persönlichen Kontakt der Individuen. Erreicht wird dies durch regelmäßige Treffen und die Einbindung aller wichtigen Akteure in den Entscheidungsfindungsprozess. Des Weiteren ist es von Bedeutung, dass alle beteiligten Kooperationsteilnehmer das zur Umsetzung des Projektes notwendige akademische und technische Hintergrundwissen besitzen. Hierbei kommt es nicht darauf an, dass alle Akteure auf demselben akademischen und technischen Level agieren, lediglich ein gewisses Grundverständnis der Thematik muss bei allen Teilnehmern gewährleistet sein. Dies resultiert in eine effiziente Kommunikation zwischen den Parteien und ist daher erfolgskritisch innerhalb der einzelnen Phasen (Philibin 2008, S.500).
Die für diese Arbeit erhobenen empirischen Informationen belegen dies. Die Koordinationsfunktion von Forschungsinstituten bei Projekten in welchen Unternehmen mit verschiedenen akademischen Partnern interagieren wird oftmals dadurch erschwert, dass die praktische Sichtweise nicht mit der wissenschaftlichen Argumentationsweise übereinstimmt (Interview 5). Es kommt daher zu einem Kommunikationsproblem der beiden Akteure, da die Grundausrichtung zu unterschiedlich ist. Für den Erfolg der Kooperation ist es schlussfolgernd von essentieller Bedeutung, dass beide Akteure sich in die Denkweise des Anderen hineinversetzen können und der benötigte Sachverstand in beiden Organisationen gegeben ist.
Zweitens ist die Projektführung für den erfolgreichen Ablauf der einzelnen Phasen von besonderer Wichtigkeit. Die Forschungsergebnisse von Philibin (2008, S.500) erschließen die Notwendigkeit eines Kooperationsagenten. Dieser Intermediär zwischen Forschungseinrichtung und dem Unternehmen soll den Prozessablauf überwachen und dafür sorgen, dass vereinbarte Liefertermine eingehalten werden. Der Kooperationsagent kann hierbei sowohl aus dem akademischen oder privatwirtschaftlichen Bereich stammen.
Kleyn et al. (2007, S.342) befürworten die Notwendigkeit einer starken Hierarchie zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Interaktion zwischen den beiden Akteuren gleicht also nicht einer Zusammenarbeit, sondern die Forschungseinrichtung wird als Dienstleister gesehen. Diese Argumentation wird von der Mehrzahl der Interviewpartner dieser Arbeit nicht geteilt. Allgemein wird zwar die Bedeutung der Koordination und Kontrolle herausgestellt, unabhängig von welcher Partei, aber eine stark hierarchische Kooperationsform wird nicht angewendet. Die Unternehmensseite (Interview 2; Interview 4) befürwortet eine geringe hierarchische Überordnung der privatwirtschaftlichen Seite gegenüber der Forschungseinrichtung, um den Kooperationsprozess zu steuern. Die Forschungsperspektive (Interview 7; Interview 8) sieht die beiden Akteure als gleichberechtigte Partner an. Die erfolgreiche Interaktion zwischen Unternehmen und akademischen Partner ist daher durch eine möglichst flache Hierarchie geprägt, wobei eine gewisse Kontrollfunktion durch das Unternehmen, welches als Finanzier auftritt, gegeben ist.
[...]
[1] University-Industry, gemäß der in der angelsächsischen Literatur üblichen Verwendungsweise bezeichnet die Abkürzung allgemein Kooperationsformen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Open Innovation"?
Open Innovation ist die Öffnung des betrieblichen Innovationsprozesses für externe Partner wie Forschungseinrichtungen, Kunden oder Zulieferer, um die Effizienz der Produktentwicklung zu steigern.
Warum kooperieren Unternehmen mit Forschungseinrichtungen?
Gründe sind der Zugang zu neuem Wissen, die konkrete Produktentwicklung, Lerneffekte sowie ökonomische Vorteile durch geteilte Risiken in der Forschung und Entwicklung.
Welche Konflikte gibt es bei Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft?
Es besteht oft ein Spannungsfeld zwischen dem akademischen Ziel (Veröffentlichung, Grundlagenforschung) und dem betriebswirtschaftlichen Ziel (marktreife Produkte, Geheimhaltung).
Was sind kritische Erfolgsfaktoren für U-I Kooperationen?
Wichtig sind klare Zieldefinitionen, Vertrauen zwischen den Partnern, eine gute Kommunikation und die Überwindung kultureller Unterschiede zwischen Akademie und Privatwirtschaft.
Wie ist die deutsche Forschungslandschaft strukturiert?
Sie umfasst Universitäten, Fachhochschulen sowie außeruniversitäre Forschungsinstitute (z.B. Fraunhofer, Max-Planck) und die industrielle Forschung in den Unternehmen selbst.
- Quote paper
- Manuel Fleschhut (Author), 2012, Open Innovation und die Entstehung von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205276