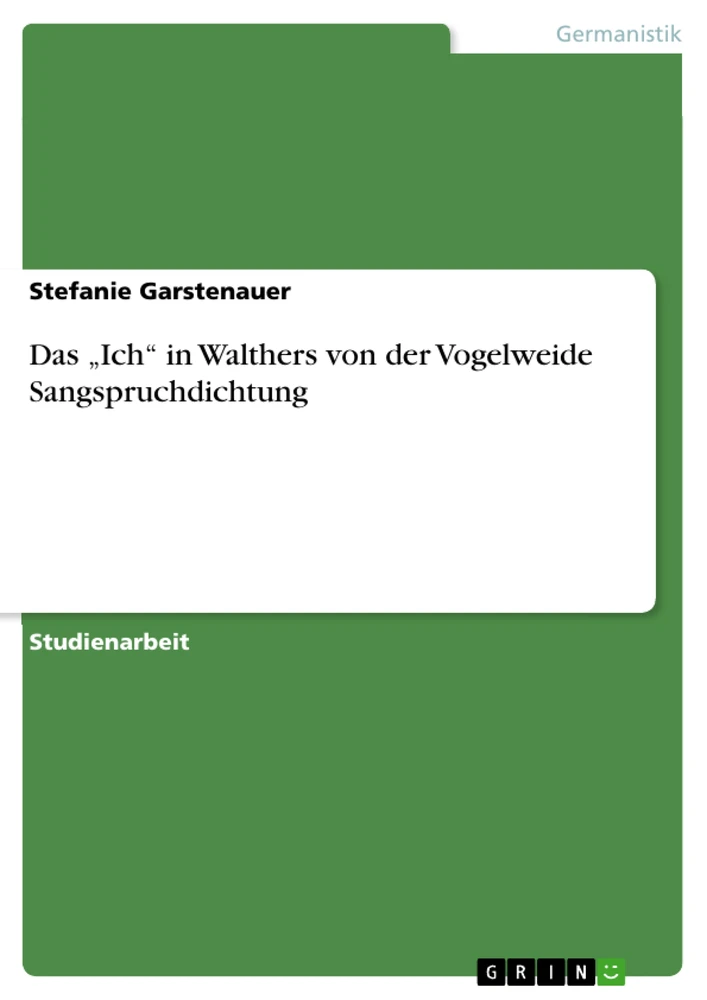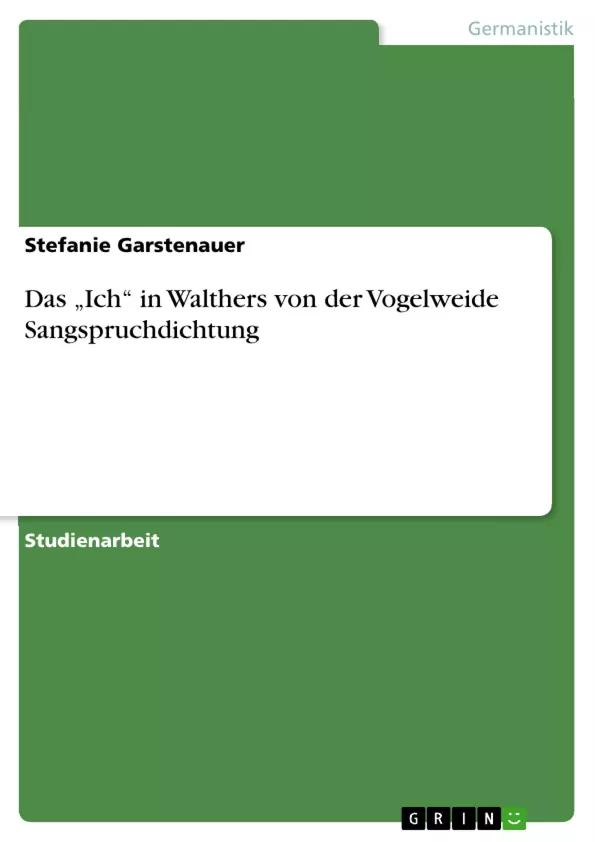Aus dem Zeitalter des Mittelalters ist nur wenig über Autoren und Autorenschaft, Literaturverständnis, Rezitations- und Vortragsweise bezeugt. Walther von der Vogelweide, welcher als einer der bedeutendsten Dichter dieser Zeit anzusehen ist, „bediente die beiden großen Gattungen des Mittelalters und lebte daher sowohl das Leben eines fahrenden Sangspruchdichters als auch eines am Hofe angestellten Minnesängers.“ Dadurch, aber auch dank seines sehr umfangreich überlieferten und auch thematisch außergewöhnlich vielseitigen Werks bietet Walther eine große Angriffsfläche, um den Versuch zu wagen, aus seinem breiten Werk auf ihn als historische Persönlichkeit zu schließen.
Der Rückgriff auf sein Werk als biographisches Zeugnis ist wohl auch darauf zurück zu führen, dass alle greifbareren, historischen Zeugnisse bezüglich seiner Person bis auf die urkundliche Nennung eines „Walther cantor de Vogelweide“ im Handelsregister des Passauer Bischofs Wolfger von Erla als höchst unsicher gelten. Im Gegensatz zum oft stark stilisierten Minnesang, in dem man schon seit langem von einem Rollen-Ich zum Verständnis der Lieder ausgeht , wurde in der eher lebenspraktisch ausgerichteten Sangspruchdichtung oftmals versucht, das lyrische Ich biographisch auszulegen , um eine möglichst lückenfreie Biographie des Sängers zu kreieren. Vorallem während des vaterländischen Patriotismus des 19. Jahrhunderts wurde Walther durch diese Art der Interpretation zum „Dichter der Nation“ hochstilisiert. Dies stößt insofern auf Widerspruch in der jüngeren Forschung, dass es sich auch bei Sangsprüchen um lyrisch-literarische Texte handelt, deren Literarizität zu berücksichtigen ist. Interpretiert man das „Ich“ in Walthers Sangsprüchen nicht mehr nur als „autobiographisches Ich“, so ändert sich auch das Bild auf ihn als Sangspruchdichter immens. Daher beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, ob, beziehungsweise inwiefern Rückschlüsse auf das Leben des Sängers anhand seiner „autobiographischen“ Sangsprüche überhaupt möglich sind. Des Weiteren soll darauf eingegangen werden, inwieweit die Beschäftigung mit der Biographie Walthers überhaupt sinnvoll und zielführend für die Erforschung seines Werks ist.
Inhaltsverzeichnis
- Thematische Hinführung
- Die Rolle des Autors in der Sangspruchlyrik Walthers von der Vogelweide
- Positionen zur Interpretation des „Ichs\" in Walthers Sangspruchdichtung
- Überprüfung möglicher autobiographischer Bezüge anhand ausgewählter Sangsprüche
- Lehensbitte an Friedrich L28,1
- Lehensdank L28,31
- Hofwechselstrophe L19,29
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Primärtext
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern sich aus Walthers „autobiographischen“ Sangsprüchen Rückschlüsse auf sein Leben ziehen lassen. Zudem wird untersucht, inwieweit die Beschäftigung mit seiner Biographie für die Erforschung seines Werks sinnvoll und zielführend ist.
- Untersuchung der Rolle des „Ichs“ in Walthers Sangspruchdichtung
- Analyse der Verbindung von literarischem und biographischem Ich in Walthers Werk
- Relevanz autobiographischer Bezüge für die Interpretation der Sangsprüche
- Bewertung der Rolle des historischen Walthers im Kontext seiner Zeit
- Analyse der Kommunikationspraktiken in der Sangspruchdichtung des Mittelalters
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine einführende Darstellung des Forschungskontextes, in dem sich Walther von der Vogelweide als Dichter und Person bewegt. Es werden die Herausforderungen aufgezeigt, die sich aus der Interpretation von Texten aus dem Mittelalter ergeben, insbesondere im Hinblick auf die Rekonstruktion der Autorenintention. Das zweite Kapitel widmet sich der Rolle des Autors in der Sangspruchlyrik Walthers. Es analysiert verschiedene Positionen zur Interpretation des „Ichs“ in seinen Texten und beleuchtet die Kontroverse zwischen einem rein biographischen und einem literarisch-rollenhaften Verständnis des lyrischen Sprechers. Die Diskussion umfasst auch die Analyse von ausgewählten Sangsprüchen, die als Beispiele für verschiedene Formen der Selbstdarstellung Walthers dienen.
Schlüsselwörter
Sangspruchdichtung, Walther von der Vogelweide, „Ich“-Interpretation, Autobiographie, Rollen-Ich, Minnesang, Mittelalter, Literaturgeschichte, Kommunikationspraktiken, höfische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Kann man aus Walthers Sangsprüchen seine Biographie rekonstruieren?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob das „Ich“ in den Texten autobiographisch oder als literarisches Rollen-Ich zu verstehen ist. Eine lückenlose Biographie lässt sich kaum sicher ableiten.
Was ist der Unterschied zwischen Minnesang und Sangspruchdichtung?
Während der Minnesang stark stilisiert ist, gilt die Sangspruchdichtung als lebenspraktischer und politischer, weshalb sie oft fälschlicherweise rein autobiographisch gedeutet wurde.
Warum wurde Walther im 19. Jahrhundert als „Dichter der Nation“ gefeiert?
Im Zuge des vaterländischen Patriotismus wurde sein Werk biographisch interpretiert, um ihn zu einer historischen Leitfigur und zum nationalen Identitätsstifter hochzustilisieren.
Welche Rolle spielen Lehensbitten in Walthers Werk?
Texte wie die Lehensbitte an Friedrich (L28,1) zeigen die existenzielle Abhängigkeit des Dichters vom Hof und dienen als Beispiel für die Kommunikation zwischen Sänger und Mäzen.
Was sagen historische Urkunden über Walther von der Vogelweide aus?
Es gibt lediglich eine gesicherte urkundliche Nennung eines „Walther cantor de Vogelweide“ im Reiserechnungsregister des Passauer Bischofs Wolfger von Erla aus dem Jahr 1203.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Garstenauer (Autor:in), 2011, Das „Ich“ in Walthers von der Vogelweide Sangspruchdichtung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205339