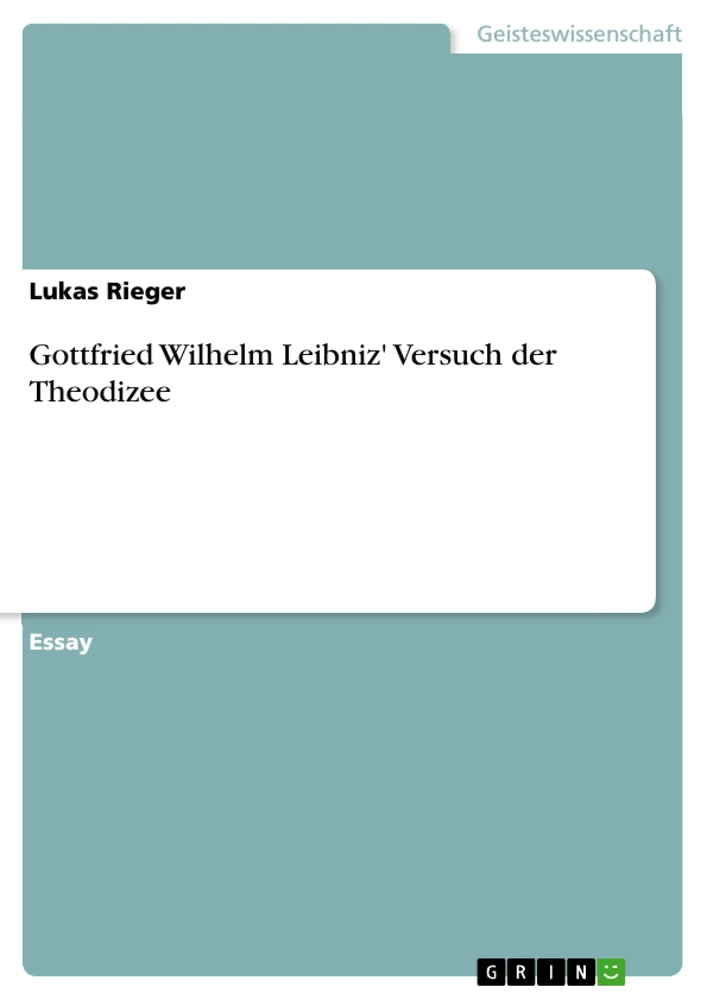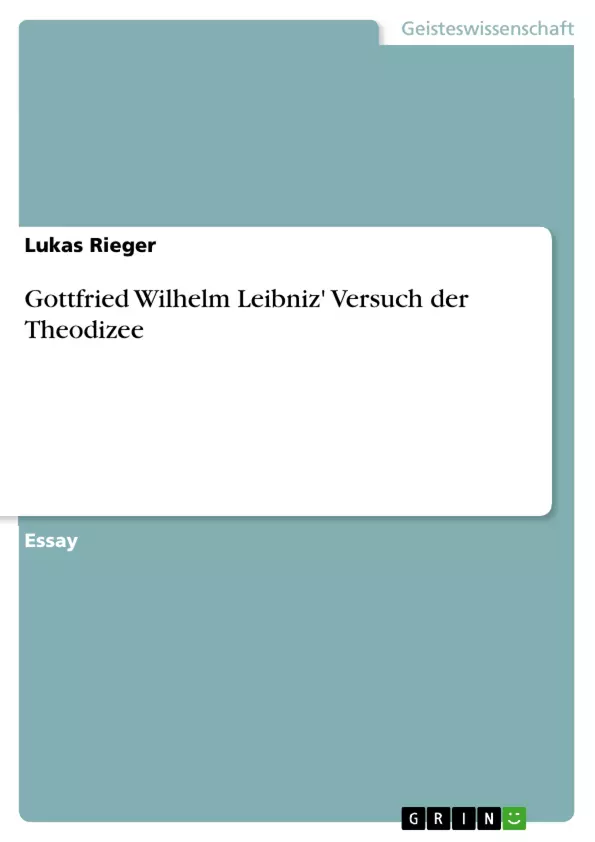Der Essay setzt sich mit den geistesgeschichtlichen Entstehungsbedingungen von Gottfried Wilhelm Leibniz' Versuch der Theodizee auseinander, stellt diesen Versuch vor und überprüft ihn kritisch auf interne Konsistenz.
Die Frage nach der Theodizee, verstanden als Problem der Rechtfertigung der Vorstellung vom Dasein eines sowohl hinsichtlich seines Wissens, seiner Macht wie seiner Güte vollkommenen Wesens im Angesicht einer behaupteterweise von diesem Wesen hervorgebrachten, unter Übeln leidenden Welt, ist beinahe so alt, wie die Philosophie selbst. Es ist unklar, wer dieses Rechtfertigungsbedürfnis als erstes formuliert hat, doch alle diesbezüglichen Zuschreibungen reichen schon bis in vorchristliche und nachplatonische Zeit zurück. Seit das Problem der Theodizee das Licht der ideengeschichtlichen Welt erblickt hat, hat es Versuche gegeben, es zu lösen. Die Traditionslinie der Lösungsversuche, in die sich der Versuch der Theodizee des Gottfried Wilhelm Leibniz einreiht, ist diejenige, die der Kirchenvater Augustinus mit der grundlegenden Überlegung, dass Übel stets nur die Abwesenheit von Vollkommenheit sei, mitbegründet und wesentlich geprägt hat. Gleichwohl die Frage nach der Theodizee deshalb keine ist, die Ausdruck eines speziellen frühneuzeitlichen Signums wäre, steht der leibnizsche Versuch ihrer Beantwortung insbesondere hinsichtlich seiner Methode deutlich im Zeichen eines Diskursfeldes seiner Zeit.
Dieses methodologische Diskursfeld ist eines, das sich dem Denken der frühen Neuzeit durch die philosophischen Arbeiten von René Descartes eröffnet, der in diesem Sinne als der bedeutendste und wirkmächtigste Wegbereiter der Moderne gelten darf. Das cartesianische Plädoyer für den methodischen Zweifel als grundlegende Methode sicheren Erkenntnisgewinns hatte in der abendländischen Philosophie einen Paradigmenwechsel eingeläutet, in Folge dessen das über Jahrhunderte mittelalterlich-scholastischer Denktradition dominant gewordene Erkenntnisprinzip „credo ut intelligam“ zu Gunsten der Emanzipation der Vernunft eine erhebliche Schwächung erfuhr. Während dem überwiegenden Teil der Aufklärungsphilosophie insbesondere der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon die Überzeugung vom unbezweifelbaren epistemologischen Primat der Vernunft eingeschrieben ist, spiegelt die leibnizsche Philosophie deutlich den geistesgeschichtlich zwar schon entflammten, aber noch unentschiedenen Konflikt zwischen den beiden Prinzipien „Glaube“ und „Vernunft“ um die Hoheit der Deutung wider. Nicht umsonst widmet sich ein nicht unbeträchtlicher methodischer Teil seines zur Frage der Theodizee umfangreichsten Werkes „Versuche in der Theodizee über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels“ der Verortung des eigenen Denkens im Bezug auf diese beiden Prinzipien. Die Vernunft, resümiert Leibniz seine diesbezüglichen Darlegungen, müsse stets im Dienste des Glaubens stehen und diesem vermittels des Prozesses entmystifizierender Veredelung zur wahren Bedeutsamkeit verhelfen. Diese Positionierung klingt in der Betonung des Primats des Glaubens freilich ebenso anselmisch und anti-aufklärerisch, wie sie in der Betonung der notwendigen Mithilfe der Vernunft zur Veredelung des Glaubens ebenso aufklärerisch wie anti-anselmisch klingt. Mit gutem Recht lässt sich die leibnizsche Philosophie deshalb als Ansatz charakterisieren, der schon unverkennbar die Stärkung der erkenntnistheoretischen Rolle der Vernunft umsetzt, während er zugleich noch dem Versuch verhaftet ist, den epistemologischen Konnex zwischen beiden Prinzipien zu wahren. Ein Blick auf den weiteren Fortgang der Ideengeschichte lehrt, dass diesem leibnizschen Versuch keine große Wirkmacht beschieden war. Eine der Ursachen für diesen Umstand dürfte Leibniz‘ Scheitern am Versuch der Theodizee aus methodischen Gründen sein. Ein Anliegen dieser Arbeit wird es sein, darzustellen, wodurch dieses Scheitern zustande kommt, und worin vermittels dieses Scheiterns die ideengeschichtliche Leistung des leibnizschen Essays liegt. Zuvor folgt allerdings eine geraffte Darstellung des leibnizschen Lösungsversuches für das Problem der Theodizee.
Der Glaubenssatz, den es für Leibniz auf vernünftigem Wege zu erhellen gilt, ist der von der behaupteten Attribuierung Gottes als allwissendes, allmächtiges und allgütiges Wesen. Die Erhellung des Satzes ist dabei rückgebunden an die aus Leibniz‘ Sicht nur scheinbare Unvereinbarkeit der Implikationen des Satzes selbst mit der erfahrbaren, faktischen Beschaffenheit der Welt. Der unter Rückgriff auf die Empirie gewonnene Anschein des Widerspruchs zwischen beiden Größen soll in diesem Zusammenhang als Vehikel eines vernünftigen Offenbarungsnachvollzugs nutzbar gemacht werden.
Das Argument, mit dem Leibniz sich im Zuge seines Versuchs der Theodizee auseinandersetzt, lautet:
P1.1: Die Welt ist ein Produkt Gottes.
P1.2: Das Produkt eines Wesens, das in der Lage ist, alle und ewige Zusammenhänge zu erkennen, das in der Lage ist, sein Produkt ohne jede Einschränkung seiner Macht nach seinem bloßen Willen wirklich werden zu lassen und das vermittels seiner uneingeschränkten Güte wollen muss, dass sein Produkt uneingeschränkt gut ist, darf keine Übel enthalten.
P1.3: Die Welt enthält Übel.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Theodizee" bei Leibniz?
Theodizee bezeichnet die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt, also die Frage, wie ein allmächtiger und gütiger Gott Leid zulassen kann.
Welche drei Eigenschaften schreibt Leibniz Gott zu?
Leibniz definiert Gott als ein Wesen, das allwissend (vollkommenes Wissen), allmächtig (vollkommene Macht) und allgütig (vollkommene Güte) ist.
Wie verhält sich laut Leibniz Vernunft zum Glauben?
Leibniz vertritt die Ansicht, dass die Vernunft im Dienste des Glaubens stehen und diesen durch "entmystifizierende Veredelung" unterstützen sollte.
Was ist das logische Paradoxon, das Leibniz aufzulösen versucht?
Der scheinbare Widerspruch, dass eine von einem perfekten Gott geschaffene Welt dennoch Übel und Leid enthält.
Welchen Einfluss hatte René Descartes auf Leibniz?
Descartes' Methode des Zweifels eröffnete das Spannungsfeld zwischen Glaube und Vernunft, in dem Leibniz versuchte, beide Prinzipien zu versöhnen.
- Quote paper
- Lukas Rieger (Author), 2012, Gottfried Wilhelm Leibniz' Versuch der Theodizee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205350