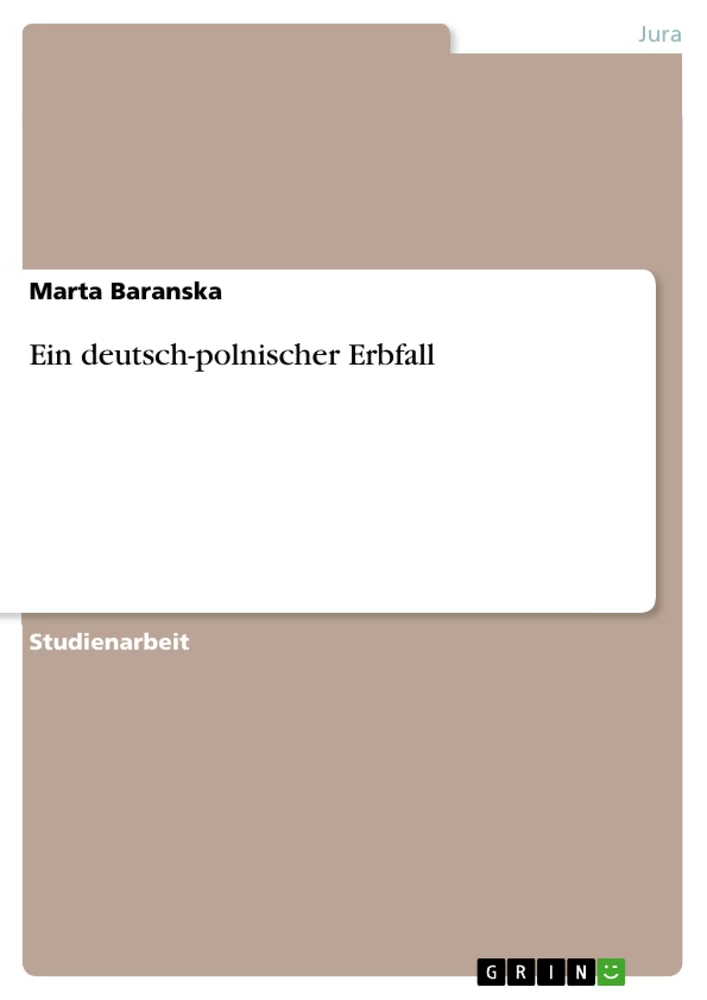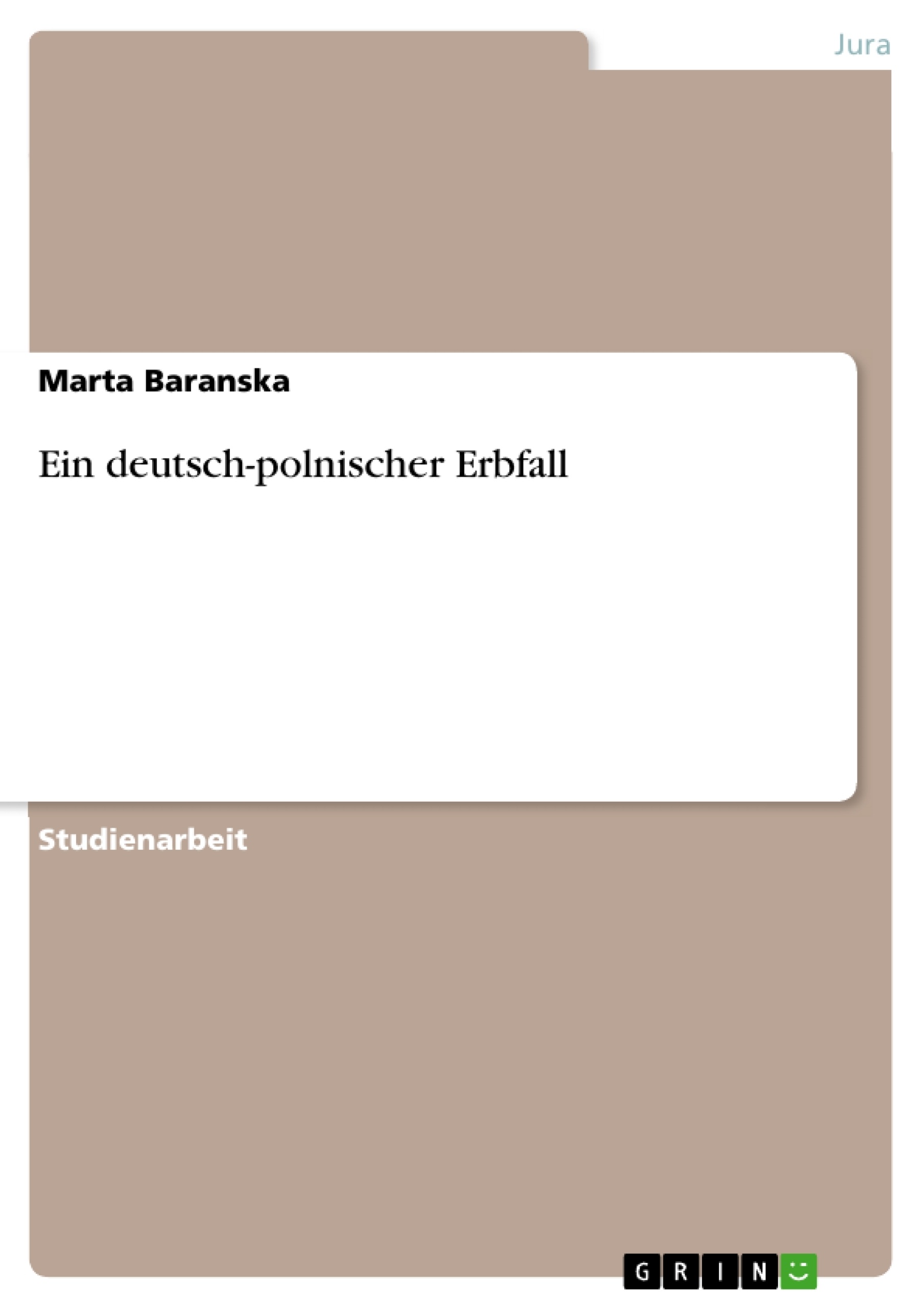Die Abhandlung ist eine komparative Darstellung des deutschen und polnischen Erb- und Erbsteuerrechts. Sie gibt Ratschläge für mögliche Erbschaftsteueroptimierungen im Falle eines deutsch-polnischen Erbfalles und deckt mögliche Schwierigkeiten und Herausforderungen an dieser binationalen Konstellation auf.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Vergleich des deutschen und des polnischen Erbschaftsteuerrechts
- A. Erbanfallsteuer
- B. Verkehrsteuer
- C. Substanzsteuer
- D. Subjektsteuer
- III. Mögliche Fälle der Doppelbesteuerung
- IV. Anwendung der Anrechnungsmethode
- V. Fazit
- VI. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Besteuerung deutsch-polnischer Erbfälle. Ziel ist der Vergleich der steuerrechtlichen Regelungen in Deutschland und Polen, mit Fokus auf die Vermeidung von Doppelbesteuerung. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung nationaler Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensübertragung im Erbfall.
- Vergleich des deutschen und polnischen Erbschaftsteuerrechts
- Möglichkeiten der Doppelbesteuerung im deutsch-polnischen Kontext
- Anwendung der Anrechnungsmethode zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
- Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensübertragung im Erbfall
- Analyse der steuerlichen Vergünstigungen im internationalen Erbfall
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar, indem sie auf die Herausforderungen des internationalen Erbschaftsteuerrechts im Kontext der europäischen Integration hinweist. Sie betont den zunehmenden Bedarf an internationaler Steuerplanung und kritisiert die geringe Aufmerksamkeit, die deutsch-polnischen Erbfällen in der Literatur gewidmet wird, im Gegensatz zur Fokussierung auf westeuropäische Fälle. Die Arbeit kündigt den Vergleich der steuerrechtlichen Regelungen beider Länder und die Analyse von Gestaltungsmöglichkeiten an.
II. Vergleich des deutschen und des polnischen Erbschaftsteuerrechts: Dieses Kapitel vergleicht die Erbschaftsteuergesetze Deutschlands und Polens. Es analysiert die verschiedenen Steuerarten (Erbanfallsteuer, Verkehrsteuer, Substanzsteuer, Subjektsteuer) in beiden Ländern und untersucht die Unterschiede in ihren Strukturen, Besteuerungsgegenständen und Steuersätzen. Der Vergleich liefert die Grundlage für die spätere Analyse der Doppelbesteuerungsprobleme. Die Bedeutung des 2005 in Kraft getretenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Einkommens- und Vermögenssteuern wird angesprochen, wobei der Mangel eines vergleichbaren Abkommens für Erbschaft- und Schenkungssteuern hervorgehoben wird. Dieser Abschnitt legt somit den Grundstein für das Verständnis der komplexen steuerlichen Herausforderungen im deutsch-polnischen Erbfall.
Schlüsselwörter
Deutsch-polnischer Erbfall, Erbschaftsteuerrecht, Doppelbesteuerung, Anrechnungsmethode, Vermögensübertragung, Internationale Steuerplanung, Vergleichendes Steuerrecht, Erbanfallsteuer, Verkehrsteuer, Substanzsteuer, Subjektsteuer.
FAQ: Deutsch-Polnische Erbschaftssteuer
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Besteuerung deutsch-polnischer Erbfälle, vergleicht die steuerrechtlichen Regelungen in Deutschland und Polen und konzentriert sich auf die Vermeidung von Doppelbesteuerung. Sie beleuchtet die Anwendung nationaler Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensübertragung im Erbfall.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich des deutschen und polnischen Erbschaftsteuerrechts, Möglichkeiten der Doppelbesteuerung im deutsch-polnischen Kontext, die Anwendung der Anrechnungsmethode zur Vermeidung von Doppelbesteuerung, Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensübertragung im Erbfall und die Analyse der steuerlichen Vergünstigungen im internationalen Erbfall.
Welche Steuerarten werden verglichen?
Der Vergleich umfasst verschiedene Steuerarten: Erbanfallsteuer, Verkehrsteuer, Substanzsteuer und Subjektsteuer, sowohl im deutschen als auch im polnischen Rechtssystem.
Wie wird die Doppelbesteuerung behandelt?
Die Arbeit analysiert mögliche Fälle der Doppelbesteuerung im deutsch-polnischen Kontext und untersucht die Anwendung der Anrechnungsmethode als Lösungsansatz. Sie hebt den Mangel eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuern hervor, im Gegensatz zum bestehenden Abkommen für Einkommens- und Vermögenssteuern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vergleich des deutschen und des polnischen Erbschaftsteuerrechts, Mögliche Fälle der Doppelbesteuerung, Anwendung der Anrechnungsmethode, Fazit und Quellenverzeichnis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist ein umfassender Vergleich der steuerrechtlichen Regelungen in Deutschland und Polen bezüglich der Erbschaftssteuer, mit dem Fokus auf die Identifizierung und Vermeidung von Doppelbesteuerung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsch-polnischer Erbfall, Erbschaftsteuerrecht, Doppelbesteuerung, Anrechnungsmethode, Vermögensübertragung, Internationale Steuerplanung, Vergleichendes Steuerrecht, Erbanfallsteuer, Verkehrsteuer, Substanzsteuer, Subjektsteuer.
Welche Bedeutung hat das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung?
Das 2005 in Kraft getretene Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Einkommens- und Vermögenssteuern wird erwähnt, jedoch wird der Mangel eines vergleichbaren Abkommens für Erbschaft- und Schenkungssteuern hervorgehoben und als relevante Problematik dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Magister Marta Baranska (Autor:in), 2012, Ein deutsch-polnischer Erbfall, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205366