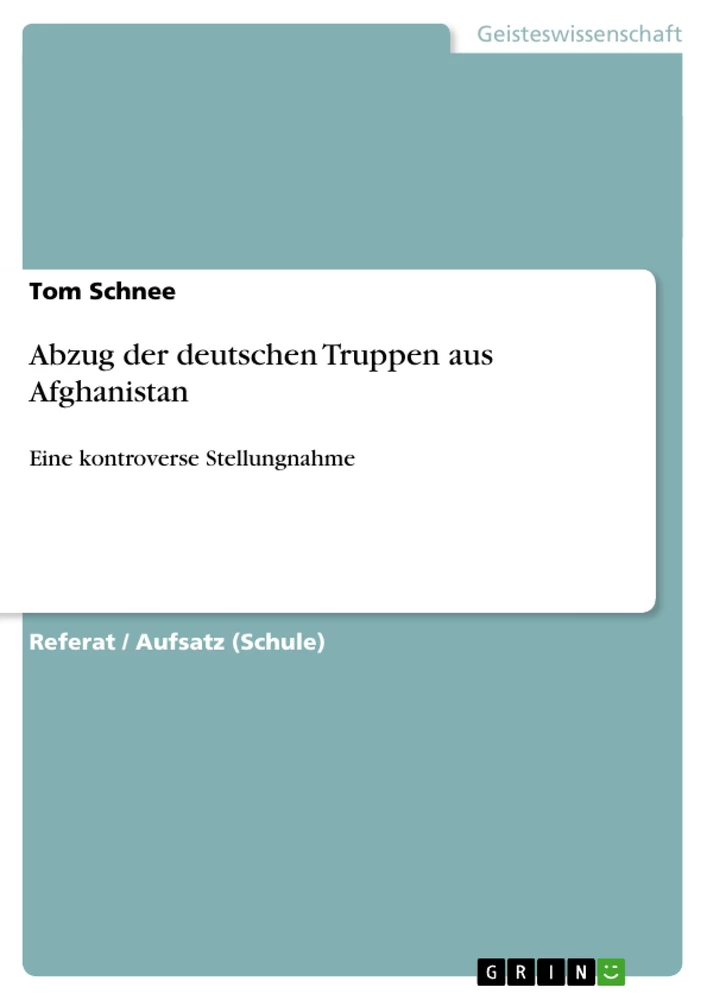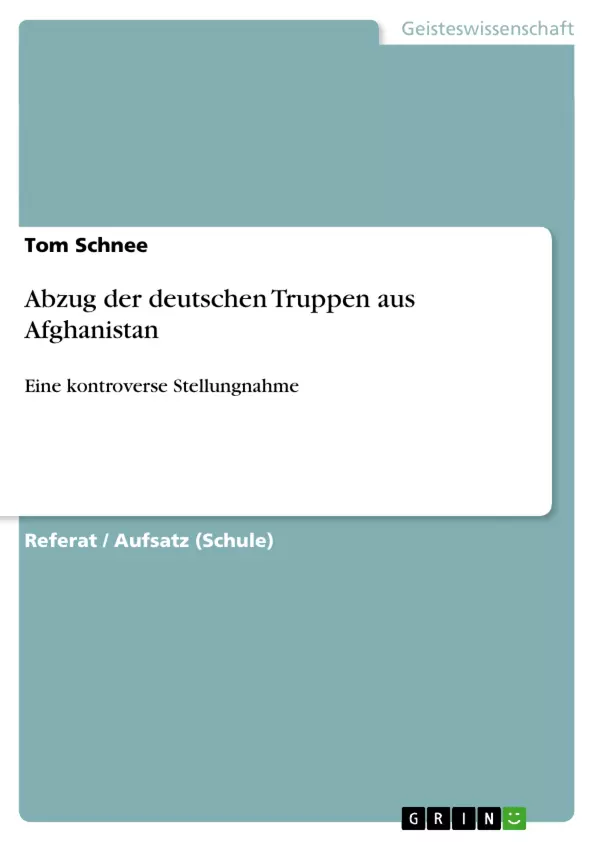„Die Mission in Afghanistan ist ausgelaugt und der Versuch gescheitert, Demokratie dorthin zu bringen." Solche Worte sind in den letzten Jahren oft zu hören. Diese stammen aus dem Mund des italienischen Politikers Umberto Bossi und verdeutlichen den allgemeinen Zweifel am Sinn des Afghanistaneinsatzes und die aufkommende Unzufriedenheit der Bevölkerung in den kriegführenden Staaten. Zu recht, denn angesichts immer schwerer werdender Verluste, des Vorrückens der schon geschlagen geglaubten Taliban, äußerst zweifelhafter Luftangriffe und des mehr als schleppend verlaufenden Wiederaufbaus des Landes erscheint ein Sieg dieses Feldzuges als eine Utopie und ein Rückzug aus dem Land am Hindukusch als die einzig richtige Alternative. Doch sind Tausende von toten Soldaten und Zivilisten, zerstörte Landstriche und mehrere 100 Milliarden Dollar Kosten nicht ein zu hoher Preis um jetzt einfach aufzugeben?
Sollen die deutschen Truppen aus Afghanistan abgezogen werden, oder soll der Einsatz verlängert werden? - Eine Stellungnahme
„Die Mission in Afghanistan ist ausgelaugt und der Versuch gescheitert, Demokratie dorthin zu bringen." Solche Worte sind in den letzten Jahren oft zu hören. Diese stammen aus dem Mund des italienischen Politikers Umberto Bossi und verdeutlichen den allgemeinen Zweifel am Sinn des Afghanistaneinsatzes und die aufkommende Unzufriedenheit der Bevölkerung in den kriegführenden Staaten. Zu recht, denn angesichts immer schwerer werdender Verluste, des Vorrückens der schon geschlagen geglaubten Taliban, äußerst zweifelhafter Luftangriffe und des mehr als schleppend verlaufenden Wiederaufbaus des Landes erscheint ein Sieg dieses Feldzuges als eine Utopie und ein Rückzug aus dem Land am Hindukusch als die einzig richtige Alternative. Doch sind Tausende von toten Soldaten und Zivilisten, zerstörte Landstriche und mehrere 100 Milliarden Dollar Kosten nicht ein zu hoher Preis um jetzt einfach aufzugeben?
Die Alliierten haben ihren Einmarsch 2001 auf zwei Versprechen gegründet. Eines war an sich selbst gerichtet: das Taliban-Regime zu verjagen und damit dem Terror, der mit deren Hilfe möglich wurde, den Boden zu entziehen. Das andere ging an die internationale Gemeinschaft, vor allem aber an Afghanistan: Dem Land beim Wiederaufbau zu helfen, um ihm eine Perspektive jenseits von Armut und Gotteskriegern zu ermöglichen. Geschafft wurde bisher weder das Eine, noch das Andere. Somit fällt die Bilanz nach mehr als 10 Jahren Krieg eher mager aus: Korruption, Bedrohungen durch radikale Islamisten und kriminelle Machenschaften durchziehen das Land und auch der Demokratisierungs-Versuch scheint gescheitert zu sein. So hat die afghanische Regierung die Präsidentschaftswahlen massiv manipuliert, weshalb sich die Frage stellt, aus welchem Grund die westliche Gesellschaft die politische Macht eines eitlen und korrupten Präsidenten erhält, der frei ist von jeglicher demokratischer Zukunftsvision und eigener Handlungsfähigkeit. Warum also nimmt die internationale Gemeinschaft die Wahlfälschung einer Regierung, die mit Milliarden aus dem Westen gefüttert wird, billigend in Kauf? Die Antwort ist einfach und erschreckend zugleich: Man schweigt, weil man sonst sagen müsste, dass Nato-Soldaten in Afghanistan sterben, um eine korrupte, ineffiziente Regierung an der Macht zu halten, die noch dazu Wahlen fälscht. Diese Wahrheit will kein Politiker aussprechen. Die Legitimationsbasis für den Afghanistaneinsatz bräche augenblicklich weg. Darum sagt man lieber nichts, man flüchtet sich in Worthülsen, oder man redet von den Millionen Mädchen, die dank der Nato wieder zur Schule gehen können, von Brunnen, die gebohrt werden, von Bewässerungskanälen, die wieder instand gesetzt werden, von den Straßen, den Schulen, den Kraftwerken. Doch auch in diesem Aspekt stellt sich die Frage, wie effizient Nato-Truppen nun wirklich arbeiten. Der Westen hatte eine große Chance zwischen 2002 und 2004. Die Taliban waren geschlagen, die Kriegsherren verängstigt, das afghanische Volk war voller Hoffnung, die Mehrheit im Westen unterstützte den Krieg. Sieben Jahre später sind die Taliban erstarkt, die Kriegsherren wiederauferstanden, das Volk ist enttäuscht, die Heimatfront im Westen bricht, wie die Umfragen zeigen, zusammen. Die Zahlen sprechen für sich: So ist eine große Mehrheit der Deutschen für einen Truppenabzug und auch in den USA und in Großbritannien ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn die Zustimmung zum Afghanistaneinsatz unter 50 Prozent gefallen. Wegducken ist keine Option, schon gar nicht in Wahlkampfzeiten. Doch auch in Afghanistan wächst der Unmut und die Ablehnung gegenüber den westlichen Streitkräften. Mehr als 60% der Afghanen sind gegen militärische Interventionen aus dem Westen, verständlich, so müssen sie doch zusehen, wie ihre Regierung zum Spielball zweier konträrer, sich bekämpfender, Mächte wird. Eine von den TV-Stationen ARD, ABC und BBC in Auftrag gegebene Umfrage von 2007 zeigte, dass vielen Afghanen der Kampf für Demokratie in ihrem Land offenbar eher nebensächlich scheint. So sahen schon damals jeweils rund 30 Prozent in ihren Regionen die größten Probleme bei der Sicherstellung der Stromversorgung und dem (Wieder)aufbau der Wirtschaft. Nur knapp 16 Prozent sahen Defizite bei der inneren Sicherheit. Der Westen stößt an seine Grenzen, militärisch, politisch und kulturell. Er ist nicht das Imperium Romanum, dem die zivilisierende Unterwerfung entfernter Provinzen gelingen konnte. Dazu fehlt es ihm an Kraft und Glaubwürdigkeit. Es können noch so viele Brunnen gebaut werden, denn letztendlich entscheidet sich der Kampf um Afghanistan in den afghanischen Institutionen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan kritisiert?
Kritikpunkte sind das Scheitern des Demokratisierungsprozesses, die hohe Korruption in der afghanischen Regierung und die mangelnden Fortschritte beim Wiederaufbau trotz hoher Kosten.
Welche Ziele verfolgten die Alliierten ursprünglich in Afghanistan?
Die Hauptziele waren die Vertreibung des Taliban-Regimes zur Terrorbekämpfung und die Unterstützung des Landes beim zivilen Wiederaufbau.
Wie dachte die afghanische Bevölkerung über die NATO-Präsenz?
Laut Umfragen wuchs der Unmut; viele Afghanen priorisierten wirtschaftliche Stabilität und Stromversorgung gegenüber westlichen Demokratie-Konzepten.
War die Wahlfälschung in Afghanistan ein Problem für die Legitimation?
Ja, die massive Manipulation der Präsidentschaftswahlen untergrub die moralische Basis des Einsatzes, da Soldaten für den Erhalt einer korrupten Regierung starben.
Was war das Fazit nach 10 Jahren Krieg?
Die Bilanz fiel mager aus: Erstarkte Taliban, enttäuschte Bevölkerung und eine schwindende Unterstützung an der Heimatfront in den westlichen Staaten.
- Arbeit zitieren
- Tom Schnee (Autor:in), 2012, Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205432