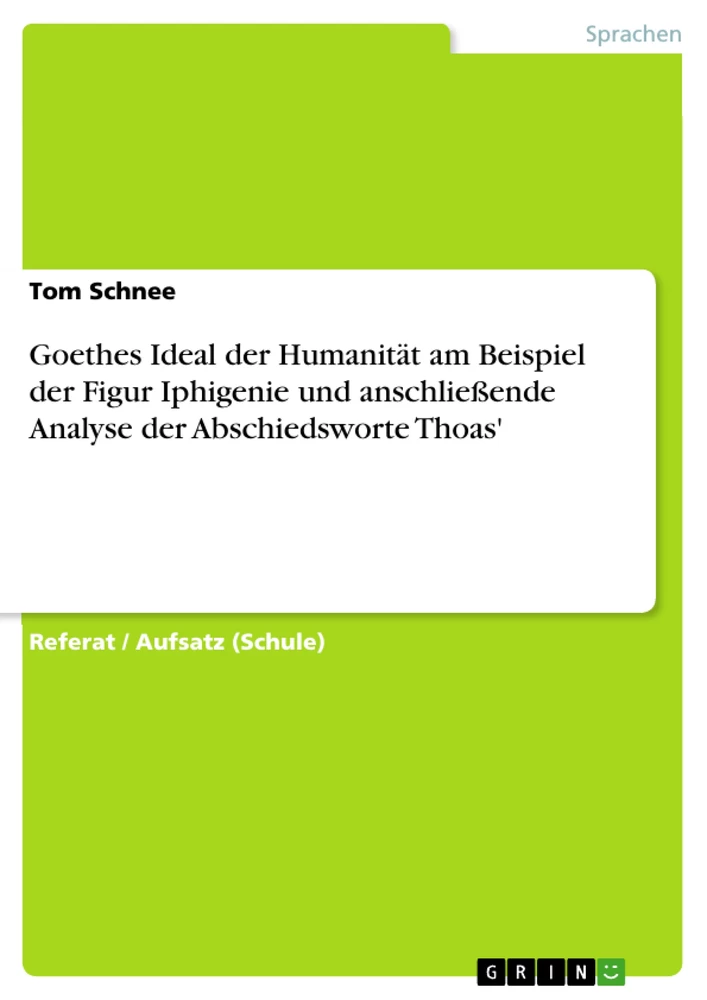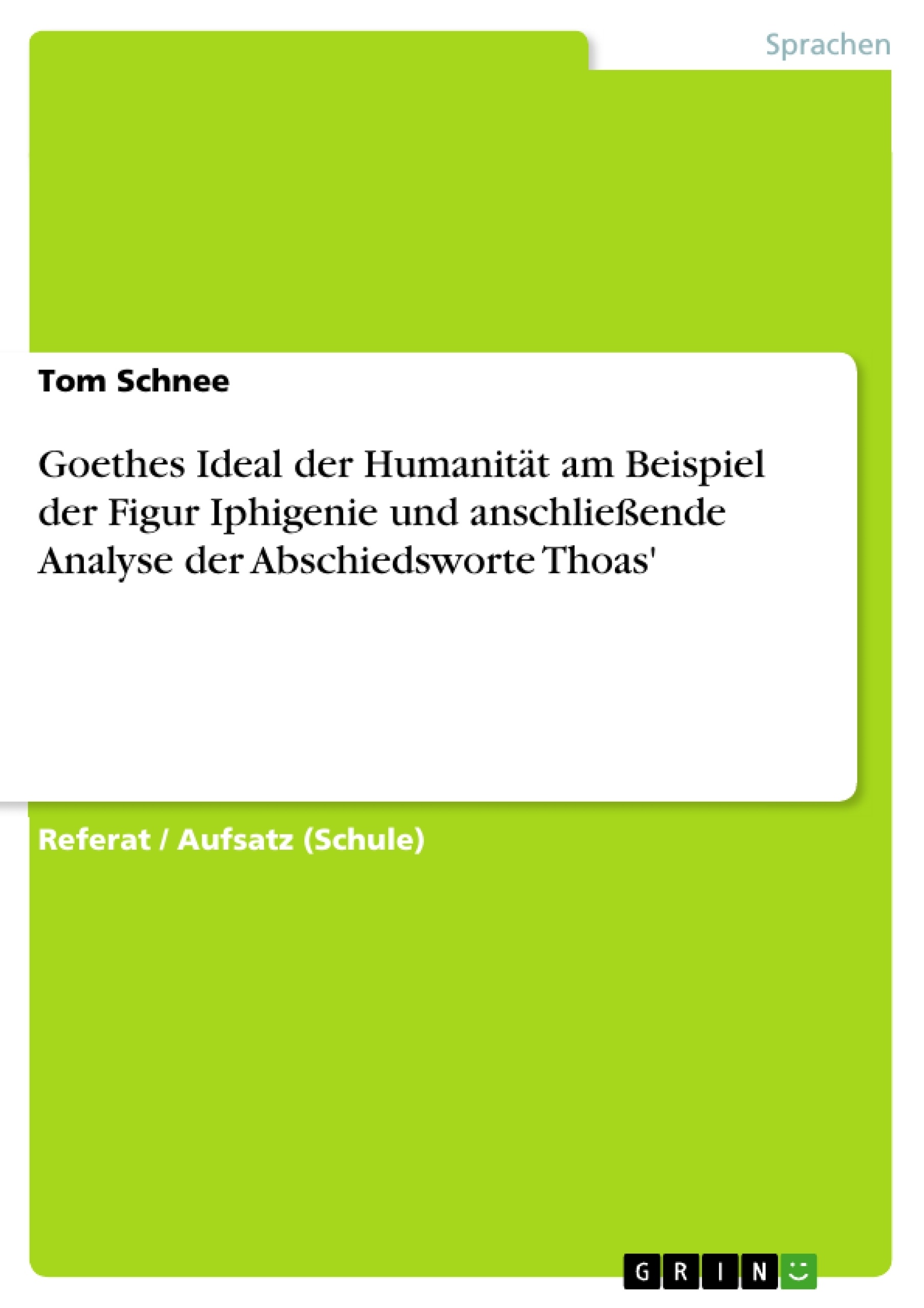Während der radikal subjektiven Zeit des Sturm und Drang wandte sich der Dichter Johann Wolfgang von Goethe gegen die damaligen, vom Absolutismus beherrschten und durch Unterdrückung gekennzeichneten, gesellschaftlichen Verhältnisse, welche den Menschen in seinem Freiheitsdrang eingrenzten. Dies bezieht sich zum einen auf die politischen Verhältnisse, gleichzeitig kritisiert er jedoch auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, welche durch starre gesellschaftliche Normen keinen Raum zur Entfaltung zur Individualität lassen.
So verarbeitete Goethe seinen Zorn vor allem in dem Schauspiel „Götz von Berlichingen“ und in dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“, dessen Hauptperson sich durch ein Handeln auszeichnen, welchem ein gewisser Freiheitsdrang zugrunde liegt. Diesen Freiheitsdrang verwirklicht Goethe auch künstlerisch, insofern, dass er seine Kunstwerke nicht länger an Regeln und Normen orientierte.
Goethes Ideal der Humanität am Beispiel der Figur „Iphigenie“
Während der radikal subjektiven Zeit des Sturm und Drang wandte sich der Dichter Johann Wolfgang von Goethe gegen die damaligen, vom Absolutismus beherrschten und durch Unterdrückung gekennzeichneten, gesellschaftlichen Verhältnisse, welche den Menschen in seinem Freiheitsdrang eingrenzten. Dies bezieht sich zum einen auf die politischen Verhältnisse, gleichzeitig kritisiert er jedoch auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, welche durch starre gesellschaftliche Normen keinen Raum zur Entfaltung zur Individualität lassen.
So verarbeitete Goethe seinen Zorn vor allem in dem Schauspiel „Götz von Berlichingen“ und in dem Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“, dessen Hauptperson sich durch ein Handeln auszeichnen, welchem ein gewisser Freiheitsdrang zugrunde liegt. Diesen Freiheitsdrang verwirklicht Goethe auch künstlerisch, insofern, dass er seine Kunstwerke nicht länger an Regeln und Normen orientierte.
Dennoch wird ihm ,vor allem durch seine Erfahrung als Politiker, schnell klar, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht so einfach ändern lassen, was in einer Hinwendung zum Menschenbild der Weimarer Klassik mündet.
Demnach sieht Goethe die Aufgabe der Literatur vielmehr darin, den Menschen selbst zu verbessern, ihn zur Menschlichkeit zu erziehen und ihn zu sittlichem Handeln zu befähigen. Dem Theater kommt somit die Aufgabe zu, den Menschen ein vorbildhaftes Handeln zu demonstrieren, dessen Akteure von einer harmonischen Geisteshaltung geprägt sind.
Der sogenannte Humanismus ist eine Weltanschauung, die auf die abendländische Philosophie der Antike zurückgreift und sich an den Interessen, den Werten und der Würde des einzelnen Menschen orientiert. Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit gelten als wichtige humanistische Prinzipien menschlichen Zusammenlebens. Die eigentlichen Fragen des Humanismus sind aber: „Was ist der Mensch? Was ist sein wahres Wesen? Wie kann der Mensch dem Menschen ein Mensch sein?“ Humanismus bezeichnet die Gesamtheit der Ideen von Menschlichkeit und des Strebens danach, das menschliche Dasein zu verbessern.
Erstmals Anwendung findet dieses Menschenbild in dem Drama „Iphigenie auf Tauris“ und zwar in Gestalt der Protagonistin Iphigenie, welche - heute wie damals - als ein Ideal reiner Menschlichkeit angesehen wird. Wusste sich der Mensch gemäß dem antiken Menschenbild noch in dem guten Wirken der Götter aufgehoben, so muss der Mensch gemäß der Weimarer Klassik aus sich heraus, also ohne Hilfe der Götter, zur Menschlichkeit gelangen. Dies wird auch in dem vorliegenden Drama deutlich, als sich Iphigenie in ihrer Konfliktlösung nicht mehr an die Götter wendet, sondern ihre Entscheidung zu der sogenannten „unerhörten Tat“ in sittlicher Autonomie trifft. Diese Abwendung von den Göttern wird unter anderem auch in der abgeänderten Version des sogenannten Parzenlieds deutlich, in dessen letzten Strophe Iphigenie verdeutlicht, dass sie nicht länger an die Allmacht der Götter glaubt (vgl. V. 1761-1766).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist Goethes Ideal der Humanität?
Es ist das Streben nach Menschlichkeit, Toleranz, Gewaltfreiheit und sittlicher Autonomie. Ziel ist es, den Menschen durch Literatur und Theater zu einem besseren Wesen zu erziehen.
Wie verkörpert Iphigenie dieses Ideal?
Iphigenie löst ihren Konflikt nicht durch List oder Gewalt, sondern durch ihre „unerhörte Tat“ – die Wahrheit. Sie handelt in sittlicher Autonomie, ohne göttliche Hilfe.
Was unterscheidet „Iphigenie auf Tauris“ vom Sturm und Drang?
Während der Sturm und Drang auf radikale Subjektivität und Freiheitsdrang setzte, betont die Weimarer Klassik (in der Iphigenie entstand) Harmonie, Sittlichkeit und Selbstbeherrschung.
Was bedeutet „sittliche Autonomie“ bei Goethe?
Es bedeutet, dass der Mensch fähig ist, Entscheidungen aus eigenem Gewissen und moralischer Einsicht heraus zu treffen, anstatt nur göttlichen Befehlen oder Trieben zu folgen.
Welche Bedeutung haben Thoas' Abschiedsworte?
Sein schlichtes „Lebt wohl!“ am Ende des Dramas signalisiert die Akzeptanz von Iphigenies Menschlichkeit und den Verzicht auf Rache, was den Sieg der Humanität über die Barbarei besiegelt.
- Citation du texte
- Tom Schnee (Auteur), 2012, Goethes Ideal der Humanität am Beispiel der Figur Iphigenie und anschließende Analyse der Abschiedsworte Thoas', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205433