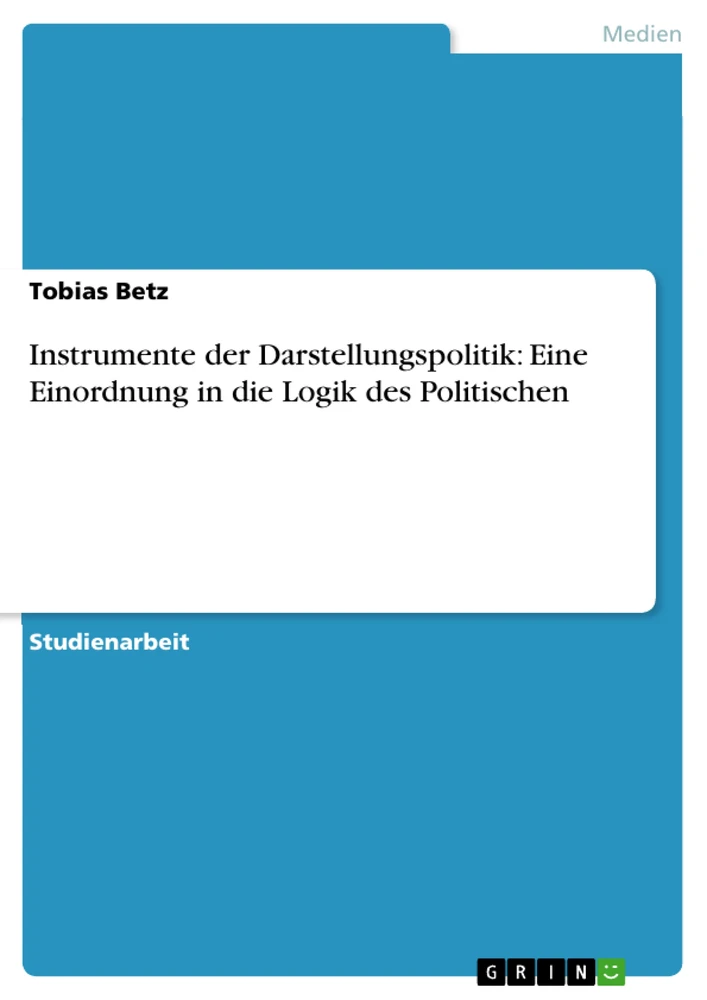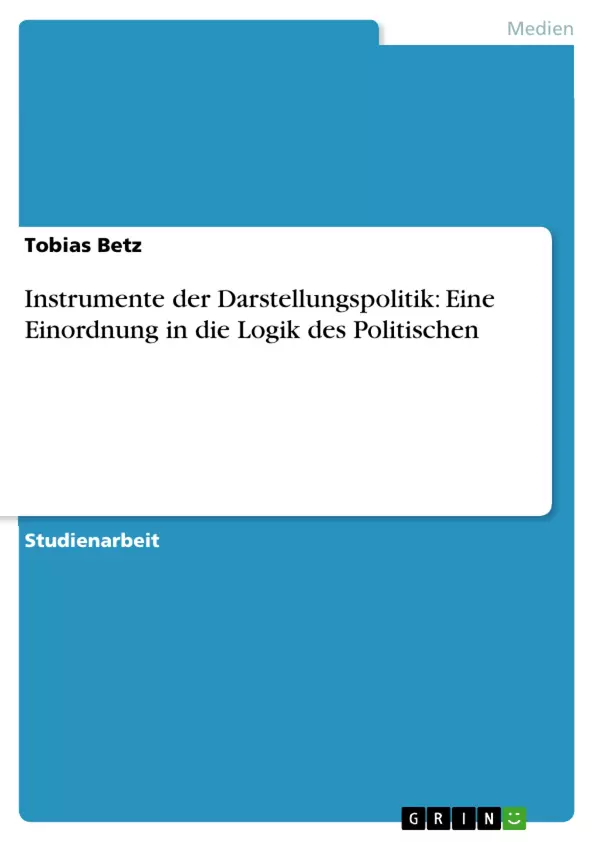„Regierungen sind so entscheidend, weil ihre Möglich-keiten der Machtausübung verhältnismäßig groß sind“ (Dahl 1976, 46).
Die Möglichkeiten der Regierungen gründen auf die wegen ihres Amtes zugeschriebenen Kompetenzen und wie die Regierenden die Potenziale der Machtausübung ausschöpfen. Gleichzeitig kommen weitere nicht verfassungsgemäße Instrumente hinzu, die in vorliegender Arbeit anhand der „dominanten Führungstechniken innerhalb der Öffentlichen Arena“ diskutiert werden (Grasselt und Korte 2007, 128-133).
Daraus resultiert folgende Forschungsfrage: Wie instrumentalisieren Regierungschefs die ihnen gegebenen Instrumente der Darstellungspolitik?
Die folgenden Leitfragen spiegeln sich in den einzelnen Kapiteln und Unterpunkten wider:
i) Welches sind dominante Instrumente der Darstellungspolitik?
ii) Was sind Voraussetzungen für mediale Inszenierung?
iii) Was begrenzt die Instrumente?
iv) Wie setzten Gerhard Schröder und Angela Merkel die Instrumente ein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mittel der medialen Darstellung und Inszenierung
- Personalisierung
- Medienkompetenz
- Mediencharisma
- Verhandlungs- vs. Mediendemokratie
- Ein Vergleich aus der Empirie: Ungleichgewichte und Gleichgewichte
- Gerhard Schröder: Ungleichgewicht zwischen Darstellungs- und Entscheidungspolitik
- Angela Merkel: Gleichgewicht mit Ausschlägen ....
- Fazit......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Instrumente der Darstellungspolitik, die von Regierungschefs zur Gestaltung ihres öffentlichen Images eingesetzt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie diese Instrumente im Kontext der Mediendemokratie eingesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf die Entscheidungspolitik haben.
- Die Bedeutung der Personalisierung in der politischen Kommunikation
- Die Rolle der Medienkompetenz für die Inszenierung von Politik
- Das Verhältnis von Darstellungs- und Entscheidungspolitik
- Der empirische Vergleich der Strategien von Gerhard Schröder und Angela Merkel
- Die Auswirkungen der Darstellungspolitik auf die Qualität des politischen Diskurses
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit den dominanten Instrumenten der Darstellungspolitik und analysiert die Rolle der Personalisierung, Medienkompetenz und des Mediencharismas. Es wird gezeigt, dass die Personalisierung zwar notwendig ist, um komplexe politische Prozesse zu vereinfachen, aber gleichzeitig auch das Risiko der Manipulation birgt.
Das zweite Kapitel beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen Verhandlungsdemokratie und Mediendemokratie. Es wird argumentiert, dass die Darstellungspolitik zwar wichtig für den Machterwerb ist, aber auch die Entscheidungspolitik beeinflusst und nicht vernachlässigt werden darf.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem empirischen Vergleich der Strategien von Gerhard Schröder und Angela Merkel. Es wird festgestellt, dass Schröder ein Ungleichgewicht zwischen Darstellungs- und Entscheidungspolitik gezeigt hat, während Merkel eher ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen beiden Rollen verfolgt.
Schlüsselwörter
Darstellungspolitik, Mediendemokratie, Personalisierung, Medienkompetenz, Mediencharisma, Entscheidungspolitik, Verhandlungsdemokratie, Gerhard Schröder, Angela Merkel.
- Arbeit zitieren
- Tobias Betz (Autor:in), 2012, Instrumente der Darstellungspolitik: Eine Einordnung in die Logik des Politischen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205549