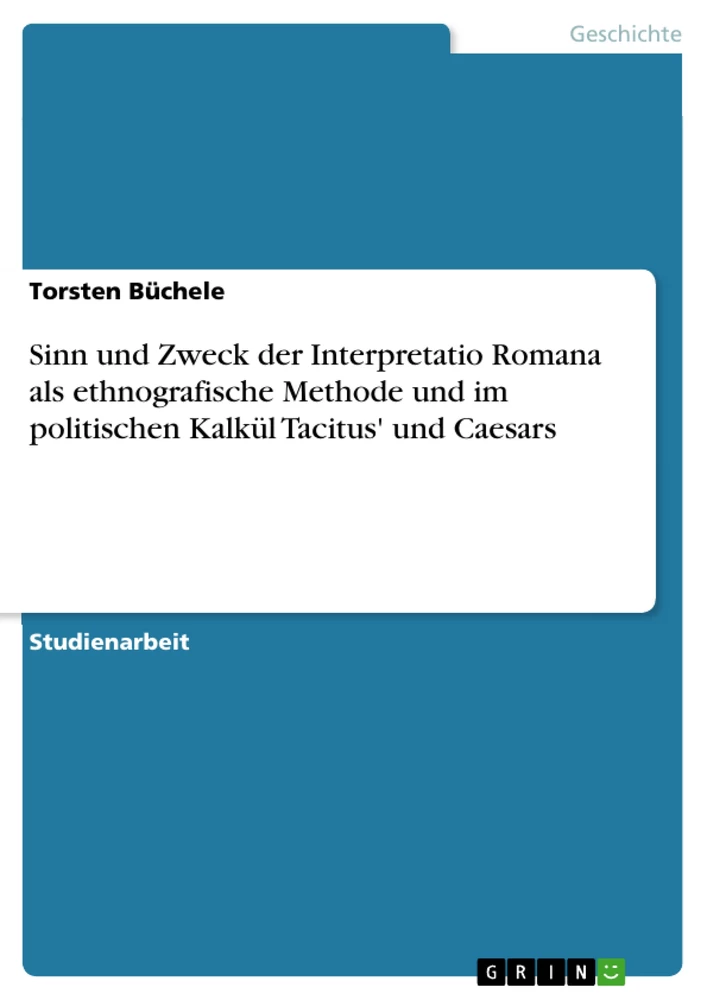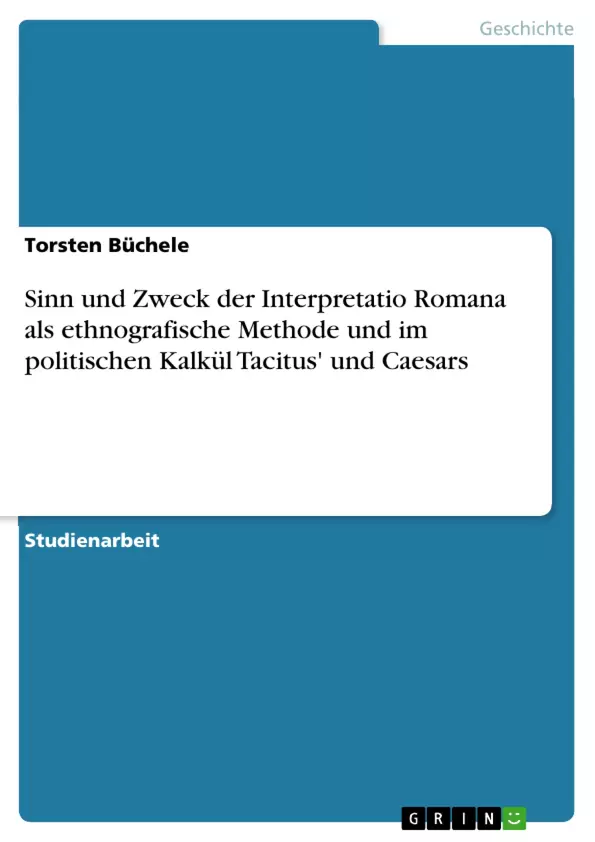Auszug aus der Einleitung:
„Deorum maxime Mercurium colunt“, schreibt Tacitus in seiner Ethnografie „De situ et moribus Germanorum“, im Folgenden „Germania“ genannt, über die Bewohner rechts des Rheines. Einen Mercurius verehrte jedoch kein einziger germanischer Stamm. Ein den Aufgaben nach mit Merkur vergleichbarer keltischer Gott wäre Wotan, und diesen hat Tacitus wohl auch gemeint. Eine solch vereinnahmende römische Interpretation von religiösen Phänomenen fremder Kulturen ist allerdings nicht nur bei Tacitus zu beobachten. Dieser selbst verwies zum Beispiel auf Gaius Iulius Caesar, der in seinen „Commentarii de bello Gallico“, im Folgenden als „Bellum Gallicum“ bezeichnet, die Bewohner links des Rheins schilderte, als Quelle seiner Aufzeichnungen sowie als „summus auctorum“ und zitierte diesen zum Teil wortwörtlich. Gerade Caesar machte von der Interpretatio Romana mannigfaltigen Gebrauch, auch in Bezug auf die den Galliern benachbarten Germanen. Beide Werke geben außerdem (bei Caesar in Auszügen) in Form einer Ethnografie Aufschluss über die Sitten, Bräuche und Kulturen von in Rom zum Großteil unbekannten Völkern, sodass Caesar mit Schilderungen über den Gallischen Krieg, etwa 150 Jahre vor Tacitus erschienen, methodisch und inhaltlich als dessen Vorgänger bezeichnet werden kann. Dies soll zum Anlass genommen werden, einen Vergleich in Caesars und Tacitus' Werken anzustellen über die jeweilige Umsetzung der ethnografischen Methode am Beispiel der Interpretatio Romana. Nach den einleitenden Betrachtungen zu Ursprung, Sinn und Zweck der Interpretatio Romana sowie deren Niederschlag in lokalen epigrafischen Quellen wird daher untersucht, inwieweit beide Autoren von der Interpretatio Romana Gebrauch gemacht haben, also fremdländische Merkmale, ganz egal ob gallisch oder germanisch, den römischen angeglichen haben, inwieweit sie auch bewusst Unterschiede der betrachteten Kulturen zu Rom ausgemacht haben und inwieweit Tacitus Caesars Ansichten über die Gallier und seine eigenen über die Germanen zu einer allumfassenden Darstellung eines nordischen Volkes vermischt hat. Neben der Untersuchung der präsentierten Fakten auf Wahrheitsgehalt werden auch Beweggründe untersucht, die beide Autoren zum Verfassen ihrer Werke angeregt haben.
Inhaltsverzeichnis
1. Caesars „Commentarii de bello Gallico“ als inhaltliche und methodische Quelle für Tacitus’ „De situ et moribus Germanorum“ - Hinführung zur Interpretatio Romana
2. Definition und Zweck der Interpretatio Romana
3. Epigrafische Quellen zur Interpretatio Romana: Eine Auswahl lokaler Beispiele an Bildwerken römisch interpretierter Gottheiten
4. Philologische Quellen zur Interpretatio Romana: Schilderungen der Wildheit der Barbaren durch die Interpretatio Romana bei Tacitus und Caesar
4.1 Schilderungen der Wildheit der Barbaren anhand der Beschreibung ihrer Religiosität in Caesars Gallischem Krieg als Tacitus’ Quelle
4.2 Schilderungen der Wildheit der Barbaren anhand der Beschreibung in Tacitus’ „Germania“ und Vergleich der ethnografischen Methode zu Caesar
5 Zweck der philologischen Anwendung der Interpretatio Romana. Ziele der Autoren
5.1 Zweck und Hintergedanken der Anwendung der Interpretatio Romana bei Caesar
5.2 Zweck und Hintergedanken der Anwendung der Interpretatio Romana bei Tacitus
6. Ethnografie und politisches Kalkül – Ein vergleichendes Fazit der Anwendung der Interpretatio Romana in den betrachteten Werken Caesars und Tacitus’
- Citar trabajo
- Torsten Büchele (Autor), 2012, Sinn und Zweck der Interpretatio Romana als ethnografische Methode und im politischen Kalkül Tacitus' und Caesars, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205636