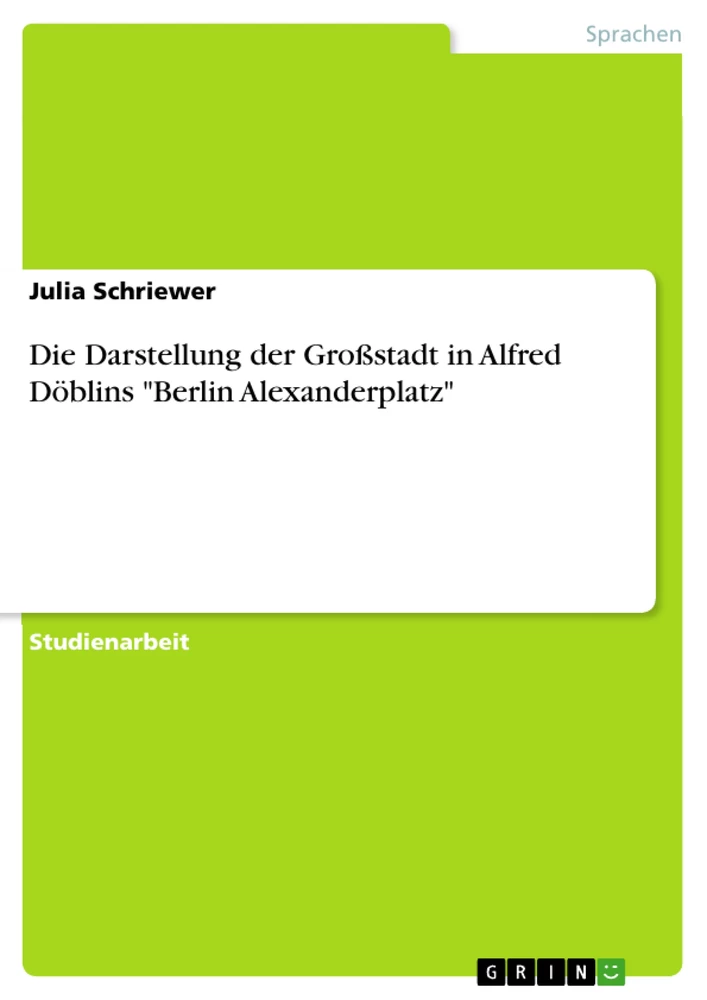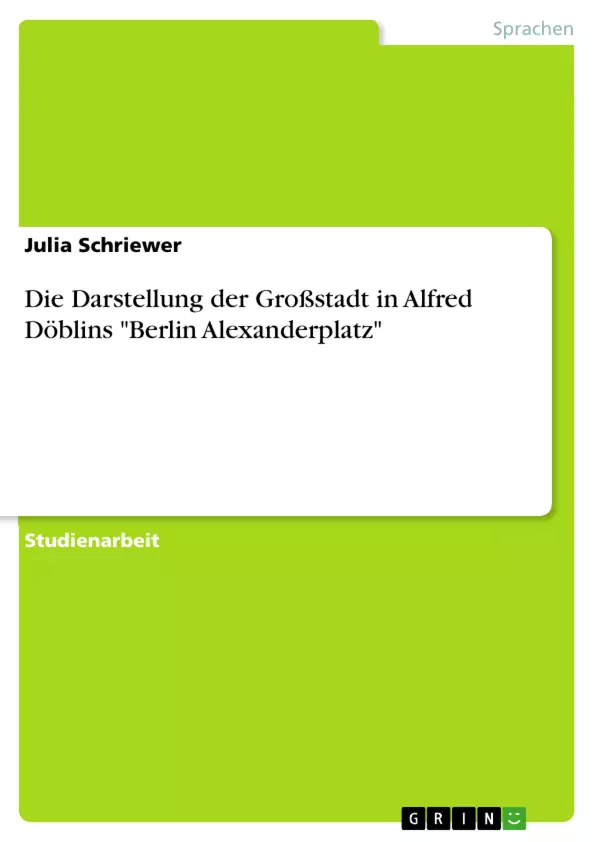Die Großstadt als Thema wurde vor allem im 19. und 20. Jahrhundert zu einem wichtigen Teilbereich der literarischen Produktion.
Im Zentrum der Großstadtliteratur stehen die unterschiedlichen Erfahrungen des Individuums in der modernen Großstadt. Aufgabe der Großstadtliteratur ist es, diese Erfahrungen literarisch umzusetzen.
Dabei ist die Großstadt nicht mehr bloß eine austauschbare Kulisse, sie steht vielmehr im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Das Thema Großstadt wurde bereits in literarischen Texten thematisiert, darunter in der Reiseliteratur, Lyrik und Essayistik. Versucht man jedoch der komplexen Thematik in der literarischen Darstellung gerecht zu werden, stößt man, wie Volker Klotz in seinem Werk „Die erzählte Stadt“ zeigt, schnell auf Grenzen: Das epische Theater, wie zum Beispiel Berthold Brechts „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (1928/29), hat sich dem Thema Stadt angenommen. Weitere Versuche wie Albert Camus „L’etat de siège“ (1847) belegen, dass es nahezu unmöglich ist, die Stadt in einem „Stadt-Drama“ auf die Bühne zu bringen. Diese Probleme sind der Tatsache geschuldet, dass es nötig gewesen wäre, die Regeln des Dramas aufzuheben. Wesentliche Strukturmerkmale des Dramas wie Dialog / Monolog, die Abgeschlossenheit der Handlung sowie Beschränkungen in Zeit und Raum bilden einen vorgegebenen Rahmen, in dem es nur schwer möglich ist, die Vielfältigkeit der Stadt angemessen darzustellen. Der Roman, losgelöst von der normativen Regelpoetik, bildet eine geeignetere Gattung. Seine gestalterische Offenheit ermöglicht es, die Großstadt authentischer darzustellen.
Wie im ersten Kapitel meiner Arbeit zu sehen sein wird, ist der Autor nicht auf bestimmte Darstellungsformen festgelegt. So wird in „Berlin Alexanderplatz“ die Großstadt nicht mehr als Teil eines sinnhaften Ganzen dargestellt. Gerade durch den Gebrauch von unterschiedlichen Erzähltechniken wie der Montage, dem Erzählerbericht oder auch inneren Monologen, werden dem Leser das Disparate und Widersprüchliche der Großstadt, die zahlreichen Verstrickungen im Stadtleben und die Reaktionen der Protagonisten vor Augen geführt.
In der Vermittlung zwischen Leser, der Hauptfigur Franz Biberkopf und der Stadt spielt der Erzähler eine bedeutende Rolle und es zeigt sich, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven der Stadt ein ambivalentes Bild verleihen.
Im zweiten Kapitel wende ich mich den Schauplätzen von „Berlin Alexanderplatz“ zu.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Erzähltechniken von „Berlin Alexanderplatz“
2.1 Das Montageverfahren
2.2 Der Erzähler
2.3 Die konkurrierenden Wahrnehmungsperspektiven der Großstadt
3. Die Schauplätze von „Berlin Alexanderplatz“
3.1 Das Milieu der Handlung
3.2 Die Risse im Stadtbild: Der Schlachthof und die Baustelle Alexanderplatz
4. Schluss
5. Verwendete Literatur
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Großstadt in "Berlin Alexanderplatz" dargestellt?
Die Stadt ist keine bloße Kulisse, sondern ein zentraler Akteur, der durch Montage und verschiedene Erzähltechniken in seiner ganzen Widersprüchlichkeit gezeigt wird.
Was versteht man unter dem Montageverfahren bei Döblin?
Döblin fügt Zeitungsberichte, Werbeslogans, Statistiken und Lieder in den Text ein, um die Reizüberflutung und Komplexität des modernen Berlins abzubilden.
Welche Rolle spielt Franz Biberkopf?
Franz Biberkopf ist der Protagonist, an dessen Schicksal der Kampf des Individuums gegen die überwältigenden Kräfte der Großstadt und des sozialen Milieus verdeutlicht wird.
Welche Schauplätze sind im Roman besonders wichtig?
Zentrale Orte sind der Alexanderplatz als Baustelle und Symbol des Wandels sowie der Schlachthof, der als Metapher für Gewalt und Existenzkampf dient.
Warum ist der Roman für die Großstadtliteratur so bedeutend?
Er brach mit traditionellen Erzählformen und schaffte es, die Dynamik und das Disparate der modernen Metropole literarisch authentisch umzusetzen.
- Quote paper
- Julia Schriewer (Author), 2010, Die Darstellung der Großstadt in Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205648