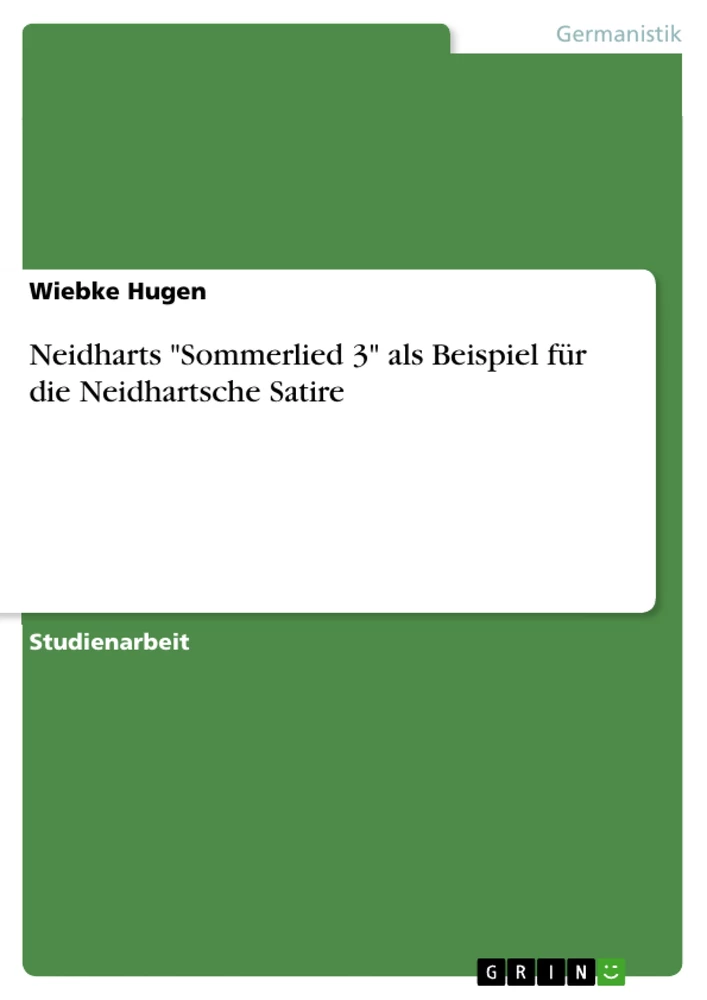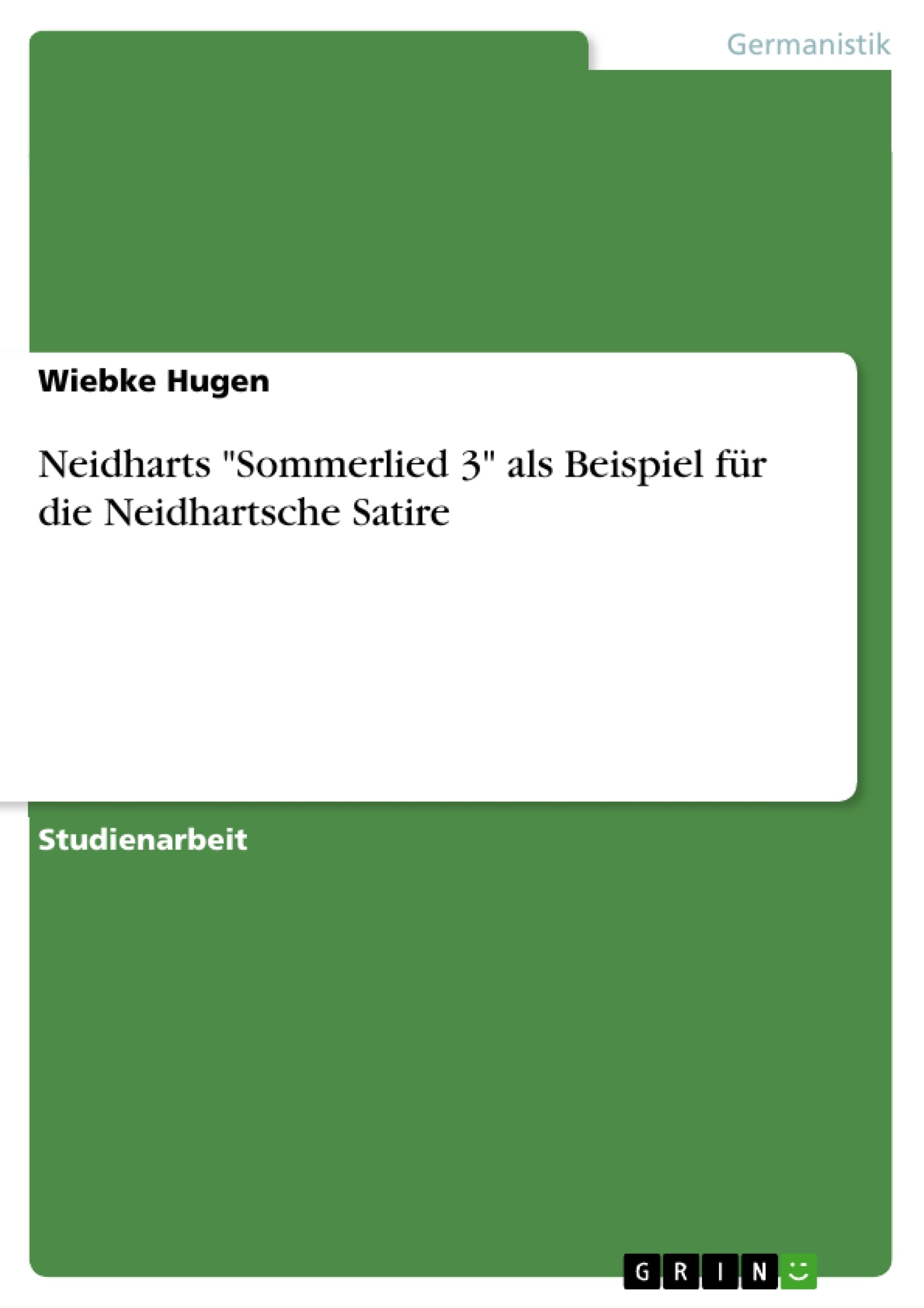Neidharts Lieder dürften seit jeher eine große Faszination auf die Zuhörerschaft ausgeübt haben, dies zeigt sich in der Kopie der Neidhartschen Marnier durch die sogenannten „Nardhartianer“ und im häufigen Auftreten seines Namens in zeitgenössischer und später erschienener Literatur. Ohne Frage ist der Dichter der Sommer- und Winterlieder, bekannt unter den Namen Nîthart und der vom Riuwental, in der Verwendung seiner außer-gewöhnlichen Motive auch heute noch eine höchst interessante Figur der mittelhochdeutschen Lyrik und regt bis in die Gegenwart immer wieder zur Kontroverse an. Wer war dieser urkundlich nicht zu erfassende Dichter mit den verschiedenen Identitäten innerhalb seiner Lieder? Was bewog ihn zur Erschaffung des dörperlichen, also des dörflichen Milieus als Schauplatz seiner Lieddichtung, die doch für die höfische Gesellschaft geschrieben war? Diese zweite Frage führt zum Kernthema dieser Arbeit, nämlich der Abbildung des Neidhartschen Satirestils, der sicher zum Bekanntheitsgrad seiner Lieder beigetragen haben dürfte. Exemplarisch vorgestellt wird dieser Stil anhand des Sommerlied 3, das durch einige entscheidende Merkmale ein Paradebeispiel für das Sommerlied im Allgemeinen und für das „Altenlied“ im Speziellen abgibt. Nach der Übersetzung dessen werden eine Angaben zu den formalen Aspekten gemacht, bevor schließlich eine inhaltliche Analyse erfolgt, die die Brücke zum Thema der Parodie und Satire bei Neidhart schlägt. Das darauffolgende Kapitel setzt sich zunächst mit der Verwendung und Funktion des Natureingangs bei Neidhart auseinander und leitet – da unmittelbar damit verbunden – über zum finalen Teil dieser Arbeit: der Analyse und Bewertung der Neidhartschen Mittel des Verspottens und gezielten Übens von Kritik an der höfischen Gesellschaft. In einem Schlussteil werden alle Ergebnisse zusammengetragen und zu einem abschließenden Gesamteindruck gefasst.
Beginnen werde ich mit einigen Angaben aus der Biographie Neidharts, soweit diese heute nachvollziehbar ist.
In der verwendeten Forschungsliteratur habe ich mich zu großen Teilen auf das Werk von Ulrich GAIER gestützt, daneben konnte ich einige sehr interessante Angaben von Jutta GOHEEN, Jessica WARNING und Petra GILOY-HIRTZ in meine Arbeit aufnehmen, um eine „multiperspektivische“ Sichtweise zu den Themengebieten zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zur Biographie Neidharts
3 Das Sommerlied 3 – Übersetzung
3.1 Diskussion strittiger Textstellen
4 Analyse und Interpretation
4.1 Formale Aspekte
4.2 Zur Überlieferung
4.3 Inhaltliche Aspekte
5 Darstellung des Zusammenhangs von Natur und menschlichem Verhalten als Mittel der Parodie
5.1 Der Natureingang bei Neidhart
5.2 Die Parodie bei Neidhart
5.2.1 Parodistische Techniken
6 Schluss
7 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wer war Neidhart von Reuental?
Neidhart war einer der bedeutendsten Lyriker des Mittelalters, bekannt für seine Sommer- und Winterlieder und die Erschaffung des "dörperlichen" Milieus.
Was zeichnet das "Sommerlied 3" aus?
Es gilt als Paradebeispiel für Neidharts Satirestil und ist speziell als "Altenlied" bekannt, das formale und inhaltliche Besonderheiten der Neidhartschen Manier vereint.
Was ist das Ziel von Neidharts Satire?
Neidhart nutzte das dörfliche Milieu, um die höfische Gesellschaft zu verspotten und Kritik an ihren Werten und Verhaltensweisen zu üben.
Welche Rolle spielt der Natureingang in seinen Liedern?
Der Natureingang dient bei Neidhart oft als Kontrast oder Einleitung, um den Zusammenhang zwischen Natur und menschlichem Verhalten parodistisch darzustellen.
Wer waren die "Neidhartianer"?
Dies war eine Gruppe von Nachahmern, die Neidharts Stil kopierten, was die enorme Popularität und Faszination seiner Werke belegt.
- Arbeit zitieren
- Wiebke Hugen (Autor:in), 2009, Neidharts "Sommerlied 3" als Beispiel für die Neidhartsche Satire, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205728