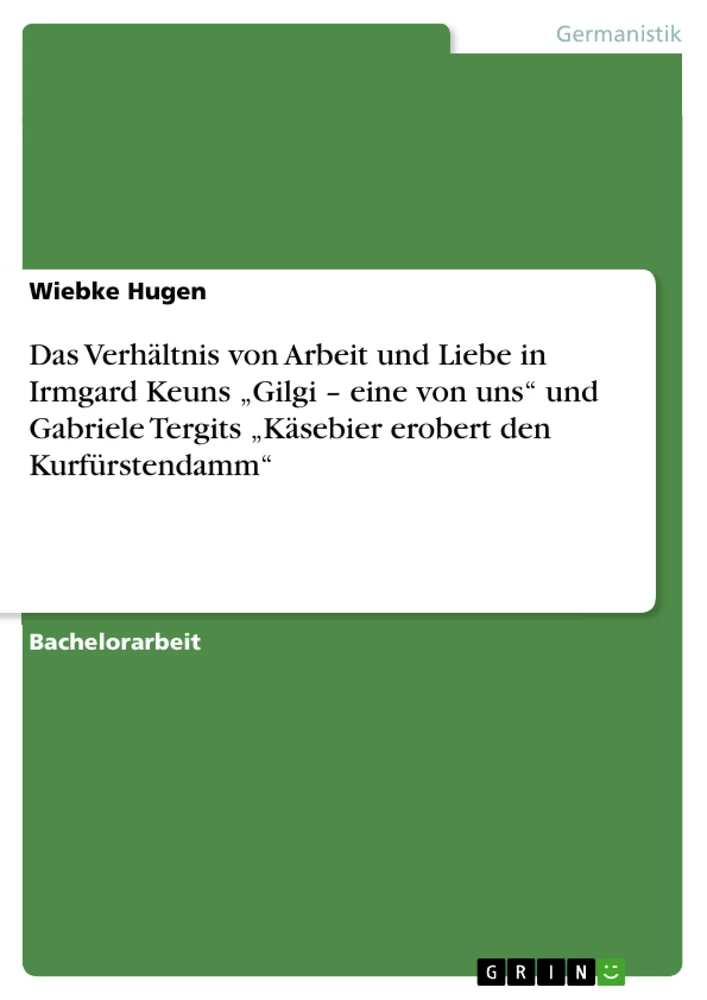Die Endphase der Weimarer Republik – die Goldenen Zwanziger sind längst vergangen, das Deutsche Reich ist gebeutelt durch Wirtschaftskrisen und Massenarbeitslosigkeit, die politische Landschaft geprägt von zunehmenden Erfolgen der Nationalsozialisten am Vorabend ihrer Machtübernahme. Bald schon wird unter der Leitung Adolf Hitlers die Rückkehr zu „deutschem Gedankengut“, „traditionellen“ Wertemodellen und „altbewährten“ Familienkonzepten propagiert werden und die emanzipierte Neue Frau Geschichte sein. Doch noch ist es allgegenwärtig: das Bild der unabhängigen, selbst-bewussten und modernen Frau, die in Gestalt der jungen Angestellten, Akademikerin und befreiten Liebhaberin das Großstadtleben prägt.
Die scharfsinnigen Beobachterinnen Gabriele Tergit und Irmgard Keun verstanden es, die Weiblichkeitsentwürfe aus Romanen, Filmen, Werbung und Illustrierten mit denen der (ihrer Wahrnehmung nach) reellen Verhältnisse literarisch zum Bild einer Neuen Frau zusammenzusetzen, deren eine oder andere Wunschvorstellung für das Leben als utopisch entlarvt werden muss. Ihre Repräsentantinnen zeitgenössischer Weiblichkeit sind geprägt durch einen Zusammenprall von gefestigten, bisher bewährten Lebenskonzepte mit den Anforderungen der modernen Gesellschaft oder dem Widerstand ihrer konservativen männlichen Zeitgenossen. Kernfragen der Arbeit: Schließen sich (echte) Liebe und die Erfüllung der Ansprüche, die die Arbeitswelt in der späten Weimarer Zeit an ihre Mitarbeiter stellt, in den untersuchten Romanen kategorisch aus? Bedeutet sachliches und aufstiegsorientiertes Denken Anfang der dreißiger Jahre zwangsläufig eine Absage an die Liebe? Wenn das der Fall ist: Kann es eine Lösung für dieses Dilemma geben?
Beiden Romanbearbeitungen wird eine kurze Einführung in Form einer Konzeptionsbeschreibung zugrunde gelegt. Im Falle des Keunschen Textes „Gilgi – eine von uns“ werden anhand der starken Entwicklung, die die Protagonistin durchlebt, zwei Haupterklärungen dafür geliefert, warum Arbeit und Liebe in ihrem Falle unvereinbar sind. Die Figuren Kohler und Herzfeld aus Tergits „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ werden, da ihre Charaktere völlig unterschiedlich angelegt sind, getrennt voneinander untersucht. Hierbei wird vor allem auf die individuellen Persönlichkeitsmerkmale und Lebensumstände der Figuren eingegangen, um ihre Fälle des Scheiterns der (wahren) Liebe unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
Lektürehinweise
1 Einleitung
2 Wie die Frau zur Neuen Frau wurde – Leben zwischen Medienmythos und Weimarer Wirklichkeit
3 Irmgard Keuns „Gilgi – eine von uns“
3.1 Konzeption des Romans
3.2 Die Entwicklung der Protagonistin
3.2.1 1. Phase: Die „Stenotypistin Gilgi“
3.2.2 2. Phase: Die „kleine Dame Gilgi“ in der Identitätskrise
3.2.3 3. Phase: „Läuterung“ und Rückbesinnung
3.3 Zwischenfazit I
4 Gabriele Tergits „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“
4.1 Konzeption des Romans
4.2 Arbeit und Liebe im „Käsebier“
4.3 Die Protagonistinnen
4.3.1 Fräulein Doktor Kohler – ein Leben in der falschen Zeit?.
4.3.2 Käte Herzfeld – das „körperbetonte Prinzip“
4.4 Zwischenfazit II
5 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wer war die "Neue Frau" in der Weimarer Republik?
Die "Neue Frau" war ein Bild der unabhängigen, berufstätigen und modern gekleideten Frau, die sich von traditionellen Rollenbildern emanzipierte.
Worum geht es in Irmgard Keuns "Gilgi – eine von uns"?
Der Roman beschreibt die Entwicklung der Stenotypistin Gilgi, die versucht, Arbeit, Unabhängigkeit und Liebe in der Krisenzeit der späten Weimarer Republik zu vereinbaren.
Welches Thema behandelt Gabriele Tergits "Käsebier erobert den Kurfürstendamm"?
Der Roman beleuchtet das Berliner Großstadtleben, den Medienrummel und das Scheitern von Lebensentwürfen am Vorabend der nationalsozialistischen Machtübernahme.
Sind Arbeit und Liebe in diesen Romanen vereinbar?
Die Arbeit zeigt auf, dass sachliches, aufstiegsorientiertes Denken oft in Konflikt mit emotionaler Erfüllung steht und die gesellschaftlichen Umstände wahre Liebe erschweren.
Welche Rolle spielen die Medien in den Romanen?
Medien wie Filme und Illustrierte prägten Wunschbilder der "Neuen Frau", die im Zusammenprall mit der harten wirtschaftlichen Realität oft als Utopie entlarvt wurden.
- Quote paper
- Wiebke Hugen (Author), 2011, Das Verhältnis von Arbeit und Liebe in Irmgard Keuns „Gilgi – eine von uns“ und Gabriele Tergits „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205730