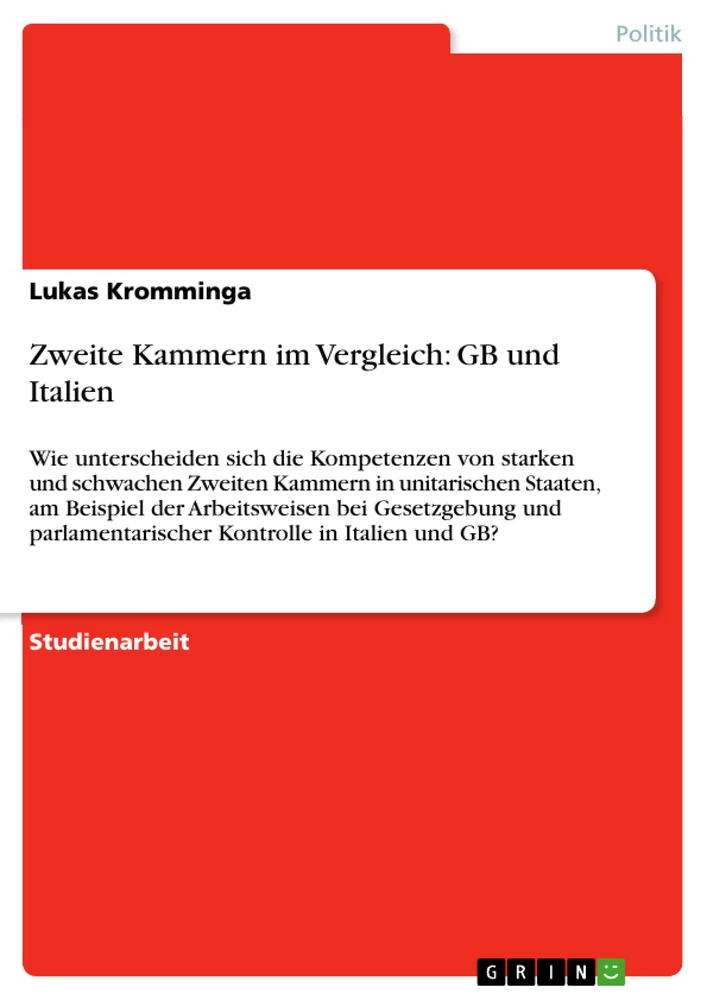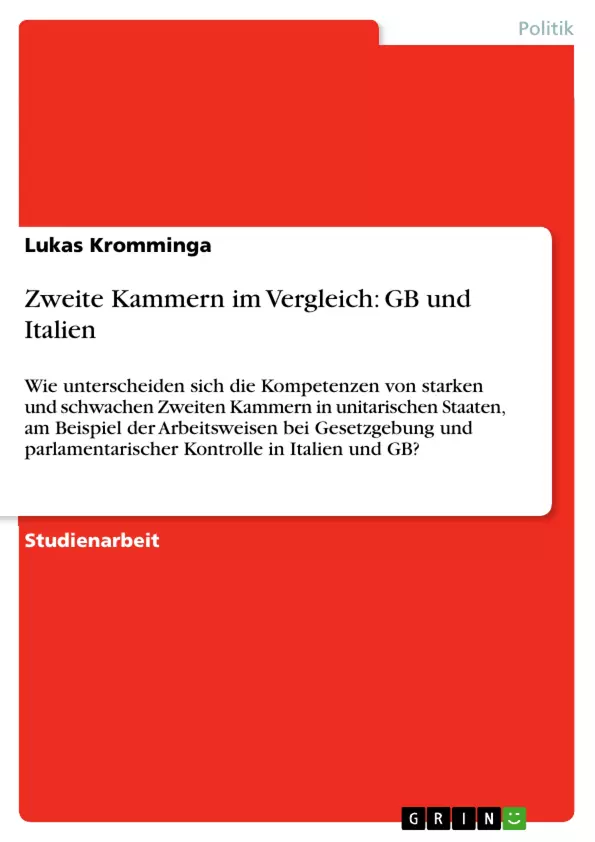In der folgenden Arbeit soll beleuchtet werden, wie sich Kompetenzen von Zweiten Kammern in unitarischen Staaten unterscheiden. Anhand von Arbeitsweisen in den Bereichen der Gesetzgebung und der parlamentarischen Kontrolle, lassen sich Unterschiede deutlich aufzeigen. Als zu Grunde liegende Beispiele dienen die bikameralistischen Systeme Italiens und Großbritanniens.
Italien als Beispiel für eine starke Zweite Kammer. Ein international einzigartiges politisches System, mit einem Senat mit weitgehenden Kompetenzen in den beleuchteten Arbeitsgebieten. Auf der anderen Seite Großbritannien. Ein Beispiel für eine eher repräsentative, schwächere Zweite Kammer. Doch wo liegen eventuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Arbeitsweisen? Wo lassen sich Rückschlüsse auf die allgemeine Stellung der Zweiten Kammer im politischen System der jeweiligen Länder finden?
Betrachtet werden soll dabei im Weiteren zunächst das Länderparlament allgemein. Die Zusammensetzung mit Erster und Zweiter Kammer und ihre interne Struktur. Dazu nähere Betrachtungen der Arbeitsweisen der Zweiten Kammer. Welche Aufgaben im Prozess der Gesetzgebung haben der Senat in Italien und das Oberhaus in Großbritannien? Wo liegen ihre Kompetenzen im Bereich der Regierungskontrolle? Anschließend der Vergleich, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten, der auf dem Papier so unterschiedlichen Arten Zweiter Kammern zu benennen. Dazu eine Einordnung im jeweiligen System des Landes, liegt ein Konfliktverhältnis vor oder verhalten sich die Kammern Partnerschaftlich?
Gliederung:
1. Einleitung
2. Definition Zweikammernsysteme
3.1 Das italienische Parlament
3.2 Arbeitsweisen der Zweiten Kammer:
3.2.1 Gesetzgebung
3.2.2 Parlamentarische Kontrolle
4.1 Das Britische Parlament
4.2 Arbeitsweisen der Zweiten Kammer
4.2.1 Gesetzgebung
4.2.2 Parlamentarische Kontrolle
5. Vergleich der Arbeitsweisen
6. Fazit
7. Anhang
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In der folgenden Arbeit soll beleuchtet werden, wie sich Kompetenzen von Zweiten Kammer in unitarischen Staaten unterscheiden. Anhand von Arbeitsweisen in den Bereichen der Gesetzgebung und der parlamentarischen Kontrolle, lassen sich Unterschiede deutlich aufzeigen. Als zu Grunde liegende Beispiele dienen die bikameralistischen Systeme Italiens und Großbritanniens.
Italien als Beispiel für eine starke Zweite Kammer. Ein international einzigartiges politisches System, mit einem Senat mit weitgehenden Kompetenzen in den beleuchteten Arbeitsgebieten. Auf der anderen Seite Großbritannien. Ein Beispiel für eine eher repräsentative, schwächere Zweite Kammer. Doch wo liegen eventuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Arbeitsweisen? Wo lassen sich Rückschlüsse auf die allgemeine Stellung der Zweiten Kammer im politischen System der jeweiligen Länder finden?
Betrachtet werden soll dabei im Weiteren zunächst das Länderparlament allgemein. Die Zusammensetzung mit Erster und Zweiter Kammer und ihre interne Struktur. Dazu nähere Betrachtungen der Arbeitsweisen der Zweiten Kammer. Welche Aufgaben im Prozess der Gesetzgebung haben der Senat in Italien und das Oberhaus in Großbritannien? Wo liegen ihre Kompetenzen im Bereich der Regierungskontrolle? Anschließend der Vergleich, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten, der auf dem Papier so unterschiedlichen Arten Zweiter Kammern zu benennen. Dazu eine Einordnung im jeweiligen System des Landes, liegt ein Konfliktverhältnis vor oder verhalten sich die Kammern Partnerschaftlich?
2. Definition Zweite Kammern
„Die Verfassung rund eines Drittels aller Staaten schreiben für die Ausformung ihres politischen Systems eine zweigliedrige Parlamentsstruktur vor. In diesen Fällen wird von Bikameralismus oder auch einem Zweikammersystem gesprochen.“[1]
Eine Zweite Kammer ist im Allgemeinen die Kammer, die nicht die direkte Volksvertretung darstellt. Am deutschen Beispiel wäre die Zweite Kammer der Bundesrat, da im Bundestag die gewählten Volksvertreter sitzen. In der Folge werden starke und schwache Zweite Kammern betrachtet. Die Stärke lässt sich bestimmen, anhand der Stellung im System.
3.1 Das italienische Parlament
Italien ist seit der Nachkriegszeit (seit 1946) eine parlamentarische Republik. Ihr Staatsoberhaupt ist der Staatspräsident. Er übernimmt hauptsächlich repräsentative Funktionen, dies ist eine direkte Folge des Faschismus. Der Präsident sollte keine zu große Macht mehr übertragen bekommen.
Das italienische Parlament besteht aus zwei Kammern. Spricht man vom Parlament in Italien ist die Gesamtheit dieser beiden Kammern gemeint.
Die erste Kammer ist die Abgeordnetenkammer, die so genannte „Camera dei Deputati“. Zusammengesetzt aus 630 Abgeordneten, steht sie im öffentlichen Fokus. Unter den Abgeordneten sitzen hier die Vorsitzenden der einzelnen Parteien und andere politische „Schwergewichte“. Dementsprechend bilden politische Funktionäre die größte Berufsgruppe in der ersten Kammer. Auch die häufigen Übertragungen von Sitzungen im italienischen Fernsehen, lassen die Abgeordnetenkammer in das Blickfeld der Bevölkerung rücken.
Auf der anderen Seite steht die zweite Kammer, der Senat oder „Senato“. Er wird gebildet durch 315 Senatoren und einigen Senatoren auf Lebenszeit, ernannt vom Staatspräsidenten. „Die Grundidee der Verfassungsgeber, den Senat als „Kammer der Erfahrung“ anzulegen, spiegelt sich noch heute in der Alters- und Sozialstruktur der Senatoren wieder.“[2] „Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Tage der Abstimmung das 25. Lebensjahr das 25. Lebensjahr (Abgeordnetenkammer) bzw. das 40. Lebensjahr (Senat) vollendet haben.“[3] Entsprechend liegt der Altersschnitt in dieser Kammer bei ca. 51 Jahren (stand 2001). Die Abgeordnetenkammer hingegen weißt einen Schnitt von ca. 45 Jahren auf. Die größten vertretenen Berufsgruppen im Senat sind Universitätsprofessoren und Rechtsanwälte. Im Allgemeinen gilt der „Senato“ als Kammer der erfahrenen Staatsmänner, ebenfalls begründet im niedrigen Frauenanteil.
Die Zusammensetzung der Kammern wird in einem gemeinsamen Wahltermin bestimmt. Normalerweise tagen beide Kammern separat, zur Wahl des Staatspräsidenten gibt es eine gemeinsame Sitzung.
[...]
[1] Vgl. Riescher/Ruß/Haas; 2000; Zweite Kammern, Seite 2
[2] Vgl. Riescher/Ruß/Haas; 2000; Zweite Kammern, Seite 208
[3] Vgl. Köppel, Stefan; 2000; Das politische System Italiens; Seite 120
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen den Zweiten Kammern in Italien und Großbritannien?
Italien besitzt mit dem Senat eine sehr starke Zweite Kammer mit weitreichenden Kompetenzen, während das britische Oberhaus (House of Lords) eher repräsentativ und schwächer positioniert ist.
Wie setzt sich das italienische Parlament zusammen?
Es besteht aus der Abgeordnetenkammer (630 Mitglieder) und dem Senat (315 Senatoren plus Senatoren auf Lebenszeit).
Warum wird der italienische Senat als "Kammer der Erfahrung" bezeichnet?
Dies liegt an der Altersstruktur (Wählbarkeit erst ab 40 Jahren) und der sozialen Struktur, in der viele Professoren und Rechtsanwälte vertreten sind.
Welche Aufgaben haben Zweite Kammern allgemein?
Ihre Hauptaufgaben liegen in der Mitwirkung bei der Gesetzgebung und der parlamentarischen Kontrolle der Regierung.
Was bedeutet "Bikameralismus"?
Bikameralismus bezeichnet ein politisches System mit einer zweigliedrigen Parlamentsstruktur, bestehend aus zwei Kammern.
- Quote paper
- Lukas Kromminga (Author), 2011, Zweite Kammern im Vergleich: GB und Italien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205785