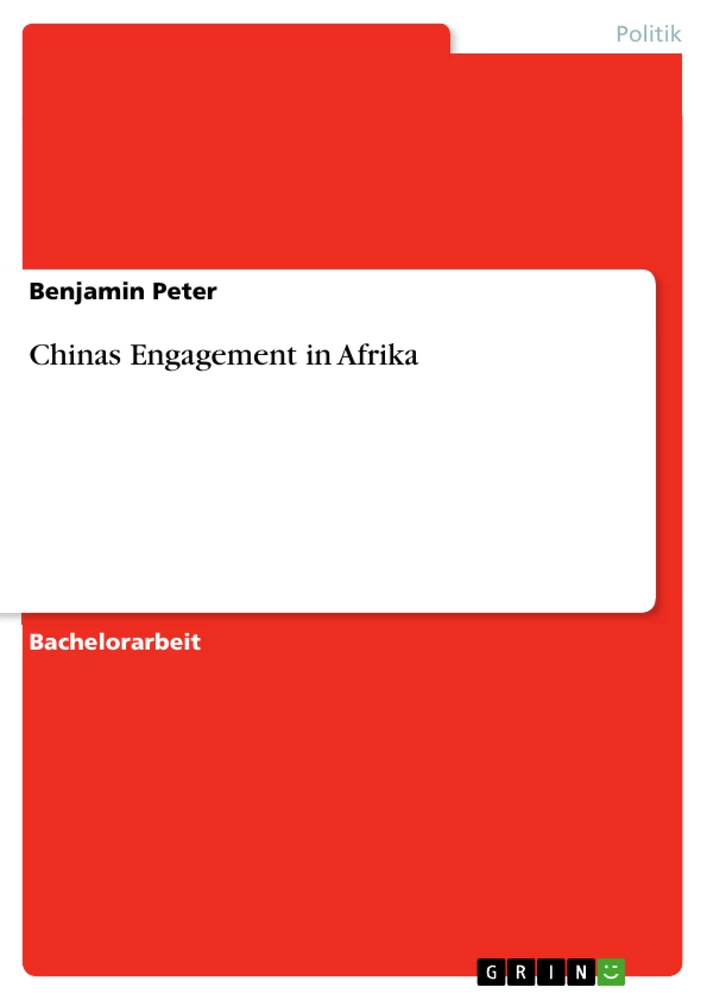Auf die Frage, ob die chinesisch-afrikanischen Beziehungen Afrika stärken oder daran
hindern sein Potential auszuschöpfen, antwortet He Wenping, eine Mitarbeiterin der „Chinese
Academy of Social Sciences“: „China‟s behavior in Africa is no worse and, on balance,
probably far better than that of the West” (2007: 29). US-Präsident Barack Obama nennt
Chinas wachsenden Einfluss in Afrika „among the most significant developments on the
continent since the end of the Cold War” (Shinn 2009: 9).
Ob diese Ansichten des chinesischen Engagements in Afrika der Wahrheit entsprechen, soll in
dieser Arbeit untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Frühe chinesische Afrikapolitik
3. Chinas Afrikapolitik seit 1970
3.1 Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)
3.2 China‟s Africa Policy
4. Zwischenfazit
5. Aspekte chinesischer Außenpolitik
5.1 Rohstoffpolitische Dimension
5.1.1 Öl
5.1.2 Weitere Ressourcen
5.2 Sicherheitspolitische Dimension
5.2.1 Waffenhandel
5.2.2 Peacekeeping
6. Fazit
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Benjamin Peter (Autor:in), 2012, Chinas Engagement in Afrika, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205956