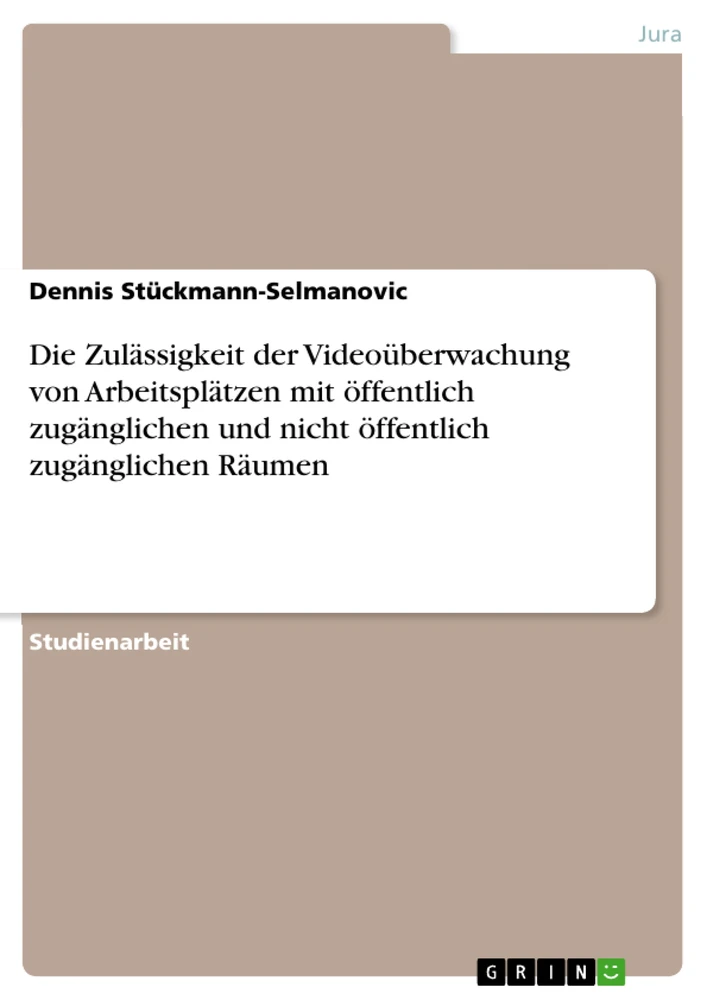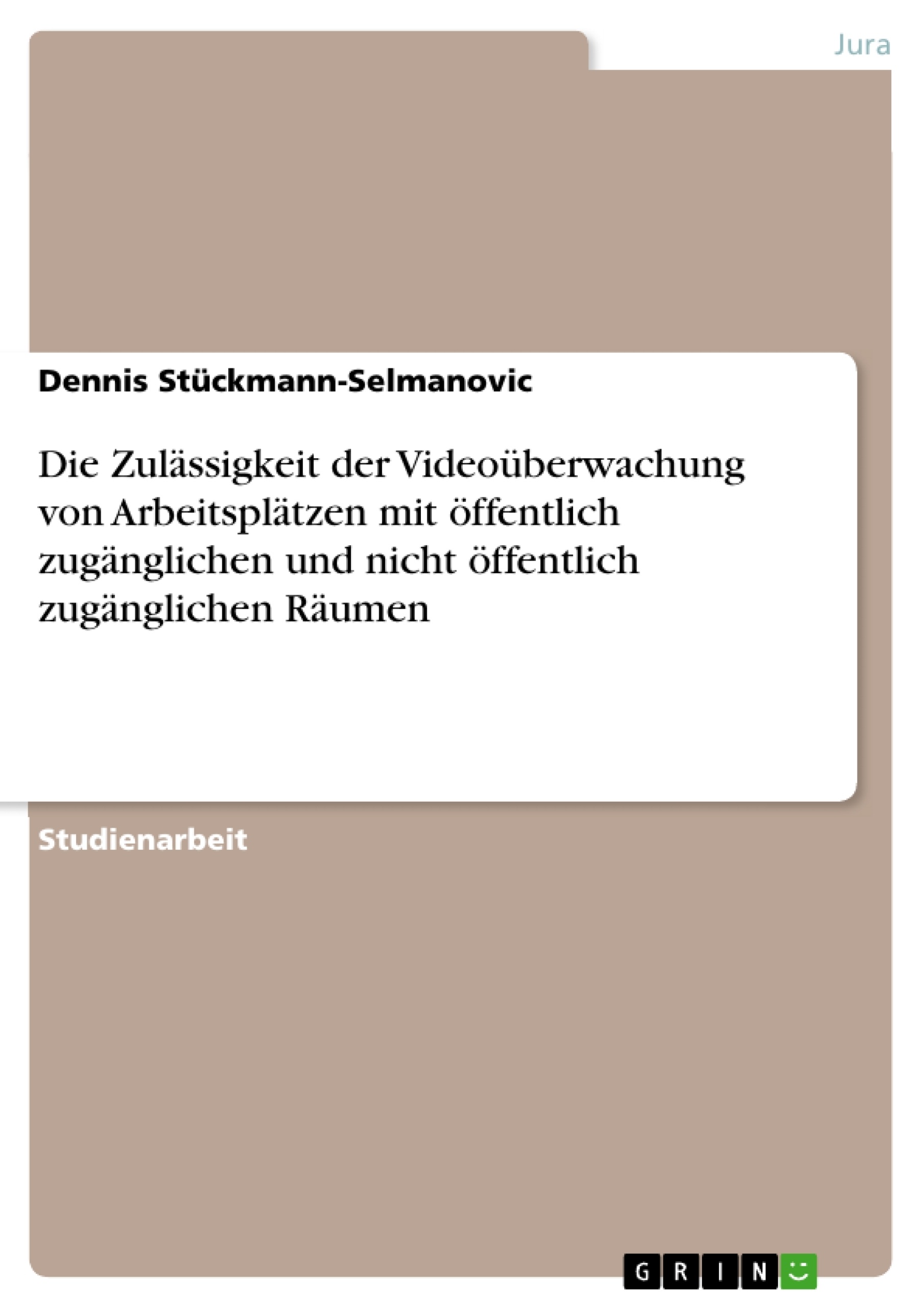In den letzten Jahren ist ein sprunghafter Anstieg der Videoüberwachung zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich zu beobachten. Grund hierfür, stellen zum einen der technische Fortschritt, der die Installierung immer kleinerer und leistungsfähigerer Geräte zu verhältnismäßig geringen Kosten ermöglicht , als auch das steigende Sicherheitsbedürfnis der Bürger dar .
In öffentlichen Bereichen wird die Videotechnik bereits seit einigen Jahren zur Überwachung von öffentlichen Straßen und Plätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen, zur Prävention und Repression von Straftaten eingesetzt. Aber auch private Stellen setzen Videotechnik für diese Zwecke ein (...)
Im Arbeitsleben machen sich Arbeitgeber diese technische Möglichkeit gern zunutze.
Allerdings rückten in den letzten Jahren Skandale der heimlichen
Mitarbeiterüberwachung bei Lidl5, Burger King und Ikea6 ins Licht der Öffentlichkeit.
Dabei wurde nicht nur die Arbeitsleistung dokumentiert, sondern auch Toilettengänge
oder Liebesverhältnisse unter den Mitarbeitern.7 Somit wurden intimste Bereiche der
Mitarbeiter berührt.
Ziel dieser Arbeit ist es, festzustellen ob die Videoüberwachung am Arbeitsplatz
überhaupt zulässig ist und welchen Zulässigkeitsvoraussetzungen sie unterliegt.
Insbesondere soll der Frage nachgegangen werden, ob eine heimliche
Videoüberwachung von Mitarbeitern, wie sie in den oben genannten Beispielen
durchgeführt wurde, rechtlich zulässig ist. Anhand von Gerichtsentscheidungen des
Bundesarbeitsgerichts und der Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes soll diese
Frage beantwortet werden.
Nachdem der Zweck der Videoüberwachung aus Arbeitgebersicht erläutert wird, soll
zunächst eine Darstellung der Grundrechtsproblematik erfolgen. Im darauffolgenden
Abschnitt wird das einschlägige Gesetz behandelt, welches die
Zulässigkeitsvoraussetzungen regelt. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die
Videoüberwachung durch private Arbeitgeber an Arbeitsplätzen mit öffentlich
zugänglichen und nicht öffentlich zugänglichen Räumen. Wobei die bloße
Überwachung des Arbeitsplatzes, als auch die gezielte Mitarbeiterüberwachung
behandelt wird. Weiterhin wird die Videoüberwachung durch eine hoheitliche Stelle
anhand des Beispiels der Verkehrskontrolle durch die Polizei dargestellt. Kern dieser
Arbeit soll dennoch nur die private Videoüberwachung sein.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung.
- B. Zweck der Videoüberwachung am Arbeitsplatz.
- C. Zulässigkeit der Videoüberwachung am Arbeitsplatz
- I. Grundrechtseingriffe
- II. Bundesdatenschutzgesetz
- 1. Anwendungsbereich des BDSG.
- 2. Zulässigkeitstatbestände nach dem BDSG.
- a) Verhältnis von Einwilligung und Rechtsvorschrift.
- b) Andere Rechtsvorschrift..
- c) Einwilligung...
- 3. Zulässigkeit der Videoüberwachung im betrieblichen Bereich.
- a) Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.
- aa) Legitimer Zweck
- (1) Zweck der Aufgabenerfüllung § 6b I Nr. 1 BDSG.
- (2) Wahrnehmung des Hausrechts § 6b I Nr. 2 BDSG
- (3) Wahrnehmung berechtigter Interessen § 6b I Nr. 3 BDSG
- bb) Verhältnismäßigkeit.
- cc) Zulässigkeitserfordernis der Hinweispflicht aus § 6b II BDSG……………………………..
- dd) Rechtmäßigkeit der weiteren Verwendung § 6b III-V BDSG.….……………….….….…………..\n
- ee) Anhörung des Betriebsrates........
- ff) Überwachung betriebsfremder Dritter und Mitüberwachung der Mitarbeiter.....
- ee) Gezielte Mitarbeiterüberwachung.
- ff) Videoaufzeichnung bei Verkehrskontrollen durch die Polizei\n
- aa) Legitimer Zweck
- b) Überwachung nicht öffentlich zugänglicher Bereiche.
- aa) Analoge Anwendung des § 6b BDSG.
- bb) Der neue § 32 BDSG
- a) Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.
- III.
- D. Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zulässigkeit der Videoüberwachung von Arbeitsplätzen, sowohl in öffentlich zugänglichen als auch in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen. Die Arbeit analysiert dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen und die möglichen Grundrechtseingriffe, die mit der Videoüberwachung verbunden sind. Insbesondere wird die Frage beleuchtet, ob eine heimliche Videoüberwachung von Mitarbeitern rechtlich zulässig ist, wie in einigen bekannten Fällen aufgezeigt wurde.
- Grundrechtseingriffe durch Videoüberwachung am Arbeitsplatz
- Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) auf Videoüberwachung
- Zulässigkeitsvoraussetzungen für Videoüberwachung im betrieblichen Bereich
- Unterscheidung der Überwachung öffentlich zugänglicher und nicht öffentlich zugänglicher Bereiche
- Rechtliche Aspekte der Mitarbeiterüberwachung durch Videoaufzeichnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Videoüberwachung von Arbeitsplätzen ein, beleuchtet den aktuellen Stand der Technik und die steigende Verbreitung von Videoüberwachungsanlagen. Außerdem werden die Skandale der heimlichen Mitarbeiterüberwachung in verschiedenen Unternehmen erwähnt und die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
Kapitel B behandelt den Zweck der Videoüberwachung am Arbeitsplatz aus Sicht des Arbeitgebers. Dabei werden die verschiedenen Gründe für den Einsatz von Videoüberwachungssystemen, wie die Mitarbeiterkontrolle, die Sicherung der Produktionsabläufe und die Prävention von Straftaten, aufgezeigt.
Kapitel C befasst sich mit der Zulässigkeit der Videoüberwachung am Arbeitsplatz. Zunächst werden die relevanten Grundrechtseingriffe und die Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erläutert. Im Fokus steht die Zulässigkeit der Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen und nicht öffentlich zugänglichen Bereichen.
Schlüsselwörter
Videoüberwachung, Arbeitsplatz, Datenschutz, Grundrechte, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Mitarbeiterüberwachung, Rechtmäßigkeit, Zulässigkeit, öffentlich zugänglicher Bereich, nicht öffentlich zugänglicher Bereich, Verhältnismäßigkeit, Hinweispflicht, Rechtmäßigkeit der weiteren Verwendung, Anhörung des Betriebsrates, Verkehrskontrolle, Polizei.
Häufig gestellte Fragen
Ist heimliche Mitarbeiterüberwachung per Video erlaubt?
In der Regel nein. Die Arbeit untersucht Fälle wie Lidl oder Ikea und zeigt, dass heimliche Überwachung oft schwerwiegend in die Grundrechte eingreift und nur in extremen Ausnahmefällen (z. B. konkreter Straftatverdacht) zulässig sein kann.
Welches Gesetz regelt die Videoüberwachung am Arbeitsplatz?
Primär das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), wobei zwischen öffentlich zugänglichen (§ 6b a.F.) und nicht öffentlich zugänglichen Räumen unterschieden wird.
Was sind legitime Zwecke für eine Videoüberwachung?
Dazu gehören die Aufgabenerfüllung, die Wahrnehmung des Hausrechts oder der Schutz berechtigter Interessen (z. B. Diebstahlschutz).
Muss der Betriebsrat bei Videoüberwachung zustimmen?
Ja, die Einführung von Videoüberwachungssystemen unterliegt der Mitbestimmung des Betriebsrates.
Gibt es eine Hinweispflicht bei Videoüberwachung?
In öffentlich zugänglichen Bereichen ist die Hinweispflicht (z. B. durch Schilder) zwingend erforderlich, um die Rechtmäßigkeit der Maßnahme zu wahren.
- Arbeit zitieren
- Dennis Stückmann-Selmanovic (Autor:in), 2012, Die Zulässigkeit der Videoüberwachung von Arbeitsplätzen mit öffentlich zugänglichen und nicht öffentlich zugänglichen Räumen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206003