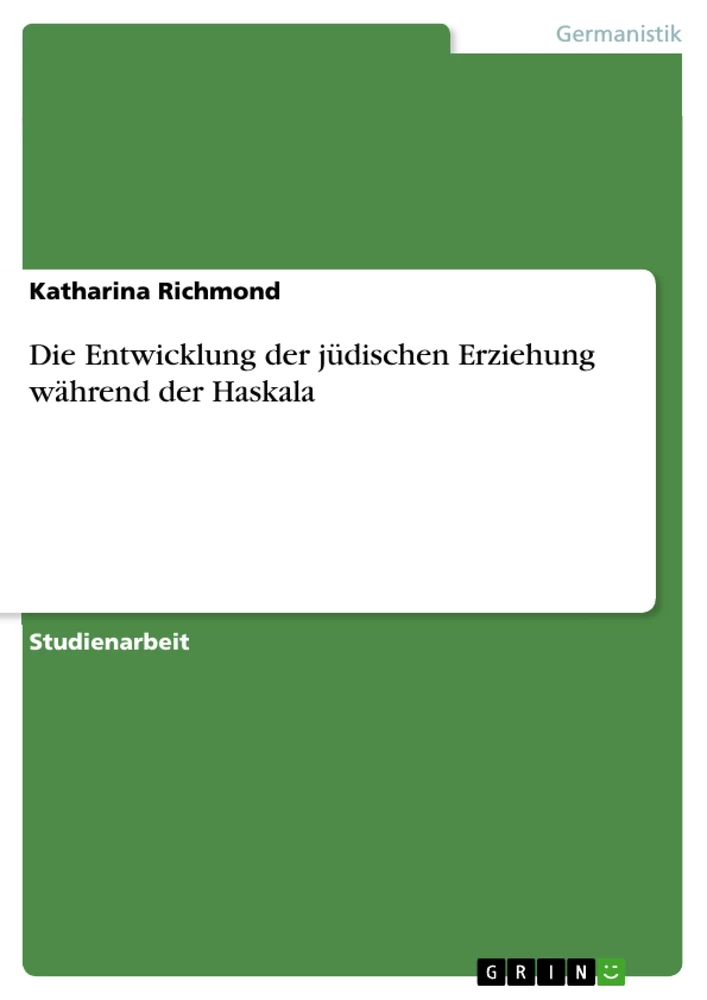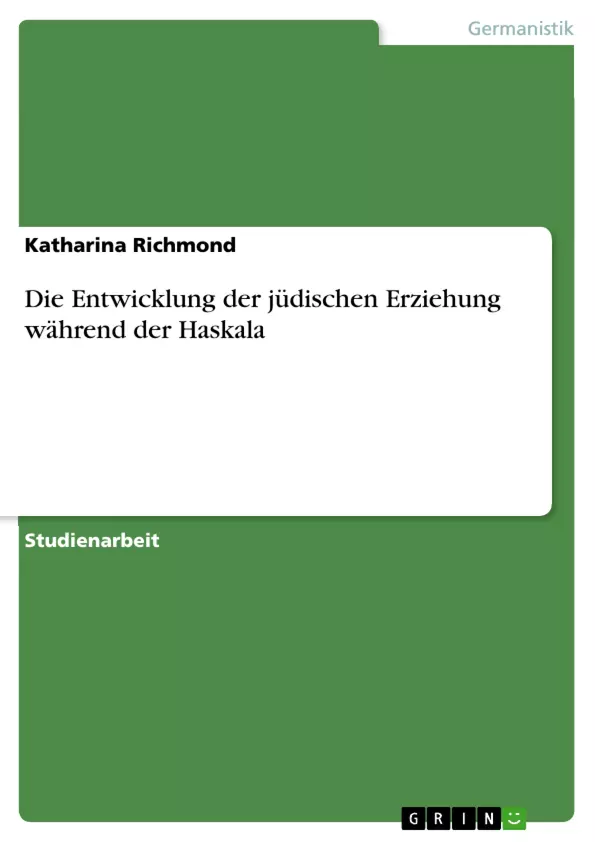„Für die Juden war bis ins 18. Jahrhundert die religiöse, soziale und kulturelle Welt
identisch“, schreibt Ingrid Belke in ihrem Aufsatz Die soziale Lage der deutschen Juden im
18. und 19. Jahrhundert. An diesem Zitat allein erkennt man die Gewichtung des religiösen
Gesetzes, das alle Aspekte des Lebens bestimmte, sei es Arbeit oder Freizeit.
In ganz Europa basierten die Schulen auf religiösen Grundsätzen, die streng voneinander
abgegrenzt wurden und sich so in ihrem pädagogischen Maßnahmen stark unterschieden. Für
jüdische Kinder bestand die Ausbildung grundsätzlich aus der religiösen Schul, die zwar
grundlegende Bildungsinhalte vermittelte, jedoch nur jene, die für das tägliche Überleben
zwingend notwendig waren. Für Jungen war außerdem die Jeschiwa-Ausbildung vorgesehen,
während die Ausbildung der Mädchen häuslich blieb, da sie in der patriarchlichen
Gesellschaft kaum Schulbildung erhielten, obwohl die Lesefähigkeit allein aus ökonomischer
Sicht sinnvoll für Frauen war. Das Judentum beinhaltet traditionellerweise lebenslanges
Lernen und Studieren, so hatte das Lernen der Kinder keinen eigenen besonderen Platz in der
Welt der Erwachsenen - in der Tat kam die „Kindheit“ im Sinne des heutigen Konzepts erst
durch die Aufklärung in Westeuropa auf. Kinder, zumindest Jungen, wurden schon im Alter
von drei Jahren selbstverständlich in die traditionelle Gelehrsamkeit integriert. [...]
Inhalt
1. Die Entstehung eines neuen Bildungsideals
1.1 Die traditionelle Ausgangssituation
1.2 Die Ideale der Haskala
2. Erziehung in der Haskala
2.1 Reformgedanken
2.2 Die Freischule in Berlin
3. Fazit
Anhang
1. Die Entstehung eines neuen Bildungsideals
1.1 Die traditionelle Ausgangssituation
„Für die Juden war bis ins 18. Jahrhundert die religiöse, soziale und kulturelle Welt identisch“, schreibt Ingrid Belke in ihrem Aufsatz Die soziale Lage der deutschen Juden im 18. und 19. Jahrhundert[1]. An diesem Zitat allein erkennt man die Gewichtung des religiösen Gesetzes, das alle Aspekte des Lebens bestimmte, sei es Arbeit oder Freizeit.
In ganz Europa basierten die Schulen auf religiösen Grundsätzen[2], die streng voneinander abgegrenzt wurden und sich so in ihrem pädagogischen Maßnahmen stark unterschieden. Für jüdische Kinder bestand die Ausbildung grundsätzlich aus der religiösen Schul [3], die zwar grundlegende Bildungsinhalte vermittelte, jedoch nur jene, die für das tägliche Überleben zwingend notwendig waren. Für Jungen war außerdem die Jeschiwa -Ausbildung vorgesehen, während die Ausbildung der Mädchen häuslich blieb, da sie in der patriarchlichen Gesellschaft kaum Schulbildung erhielten, obwohl die Lesefähigkeit allein aus ökonomischer Sicht sinnvoll für Frauen war. Das Judentum beinhaltet traditionellerweise lebenslanges Lernen und Studieren, so hatte das Lernen der Kinder keinen eigenen besonderen Platz in der Welt der Erwachsenen[4] - in der Tat kam die „Kindheit“ im Sinne des heutigen Konzepts erst durch die Aufklärung in Westeuropa auf. Kinder, zumindest Jungen, wurden schon im Alter von drei Jahren selbstverständlich in die traditionelle Gelehrsamkeit integriert.
Trotz der Kritik an weltlichem Unterricht seitens der Rabbiner, ließen wohlhabende „Hofjuden“[5] ihre Kinder häufig neben der Jeschiwa von jüdischen und nicht-jüdischen Privatlehrern in Fremdsprachen und weiteren geschäftlich und gesellschaftlich nützlichen Fächern unterweisen, die für den gesellschaftlichen Aufstieg der Hofjuden maßgeblich war. Rotraud Ries benennt den Konflikt dieser Entscheidung, da dieser Lebensstil dazu führte, dass die Hofjuden nicht mehr als „richtige“ Juden empfunden wurden[6], besonders von Seiten der traditionellen Rabbiner. Dennoch war dieser Unterricht abhängig von der Bildung des Lehrers, die nicht zwangsläufig ausreichend war. Scharfer Kritik ausgesetzt waren die polnischen Lehrer, deren Verhalten, Kleidung und Bildung in den Augen der Maskilim unzureichend war, da die Haskala die osteuropäischen Juden nicht erreichte[7]. Besonders der Umstand, dass die Unterrichtssprache im Cheder Jiddisch war, erschien den Vertretern der Aufklärung als Problem, da dies für sie das größte Hindernis darstellte, sich der deutschen Kultur anzunähern und sich damit zu emanzipieren.[8] Der Reichtum der Hofjuden ermöglichte es den Kindern also sich der nicht-jüdischen Gesellschaft zu nähern, was den Idealen der Haskala-Befürwortern entsprach.
1.2 Die Ideale der Haskala
Die Haskala blickte als relativ späte Aufklärungsbewegung laut Schulte[9] zu den Zielen der anderen europäischen Aufklärungsbewegungen empor, die ihr in vieler Hinsicht, nicht zuletzt zeitlich, voraus war. Des weiteren beschreibt Schulte, dass es keine geistigen Vorbilder gab, auf deren Ideale man sich hätte berufen können, sodass die jüdische Aufklärungstradition zwischen mittelalterlichen Philosophen wie Maimonides und nicht-jüdischen Aufklärern stand. Aus diesem Umstand heraus lässt sich auch das Hauptziel der jüdischen Aufklärung erkennen: Bildung zwecks der Emanzipation des frei denkenden Individuums. Juden wie Christen sollten idealerweise zu selbstständig denkenden Menschen erzogen werden und endlich zur Erkenntnis gelangen, dass alle Religionen gleichberechtigt seien.
Dass die traditionelle jüdische Erziehung mit diesem Ideal im Konflikt stand, ist offensichtlich. Das Ideal des jüdischen Mannes war bis dato das eines tief Religiösen, der sich strikt an die religiösen Gesetze hielt und sich ganz dem Talmudstudium opferte. Doch nun verlangte die Gesellschaft nach einem neuen Typen, nämlich dem des wissenschaftlich gebildeten Mannes, der Hochdeutsch sprach und damit den Weg aus der unterdrückten Randgruppe zur den Christen gleichberechtigten Gemeinde bahnen sollte.
Dem jüdischen Aufgeklärten war die Religion zwar immer noch ein wichtiger Anker, jedoch befürwortete er die Trennung von Religion und Staat. Der Glaube eines Menschen sollte nunmehr aus freien Stücken entstehen: „[…] religious faith acquired through free choice, a religion that the believer adheres to of his own free choice, is preferable to religious conduct resulting from coercion and habit.“[10] In diesem Sinne sollte auch das strikte religiöse Gesetz, das das alltägliche Leben maßregelte, nicht als Hindernis des nützlichen Staatsbürgers fungieren.
[...]
[1] Pleticha, Heinrich, [Hrsgb]: Das Bild des Juden in der Volks- und Jugendliteratur vom 18. Jahrhundert bis 1945. Königshausen & Neumann, 1985, S. 13
[2] Behm, Britta [Hrsgb]: Jüdische Erziehung und aufklärerische Schulreform. Waxmann, 2002, S. 14
[3] Schulte, Christoph: Die jüdische Aufklärung. C.H. Beck oHG, 2002, S. 24
[4] Herzig, Arno, Horch, Hans Otto, Jütte, Robert [Hrsgb]: Judentum und Aufklärung. Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, S. 53
[5] Behm, S. 72
[6] Herzig, Horch & Jütte, S. 30
[7] Allerhand, Jacob: Das Judentum in der Aufklärung. Fromman-Holzboog, 1980, S. 47
[8] Eliav, Mordechai: Jüdische Erziehung in Deutschland im Zeitalter der Aufklärung und Emanzipation. Waxmann, 2001, S. 185
[9] Schulte, S. 18 - 19
[10] Feiner, Shmuel: The Jewish Enlightenment. University of Pennsylvania Press, 2002, S. 59
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der Haskala (jüdische Aufklärung)?
Das Ziel war die Bildung zur Emanzipation des Individuums, um Juden den Weg in die christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft zu ebnen.
Wie sah die traditionelle jüdische Erziehung vor der Aufklärung aus?
Sie war rein religiös geprägt; Jungen besuchten die religiöse „Schul“ und später die Jeschiwa, während Mädchen meist nur häuslich unterrichtet wurden.
Wer waren die „Hofjuden“ und welche Rolle spielten sie?
Wohlhabende Juden, die ihren Kindern durch Privatlehrer auch weltliche Fächer und Fremdsprachen ermöglichten, was oft zu Konflikten mit traditionellen Rabbinern führte.
Warum war die deutsche Sprache für die Maskilim so wichtig?
Hochdeutsch galt als Schlüssel zur kulturellen Annäherung und Emanzipation, während Jiddisch von den Aufklärern als Hindernis gesehen wurde.
Was änderte sich am Konzept der „Kindheit“?
Ein eigenständiges Konzept von Kindheit entstand erst durch die Aufklärung; vorher wurden Kinder (besonders Jungen) schon sehr früh in die Welt der Erwachsenen und Gelehrten integriert.
- Quote paper
- Katharina Richmond (Author), 2012, Die Entwicklung der jüdischen Erziehung während der Haskala, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206017