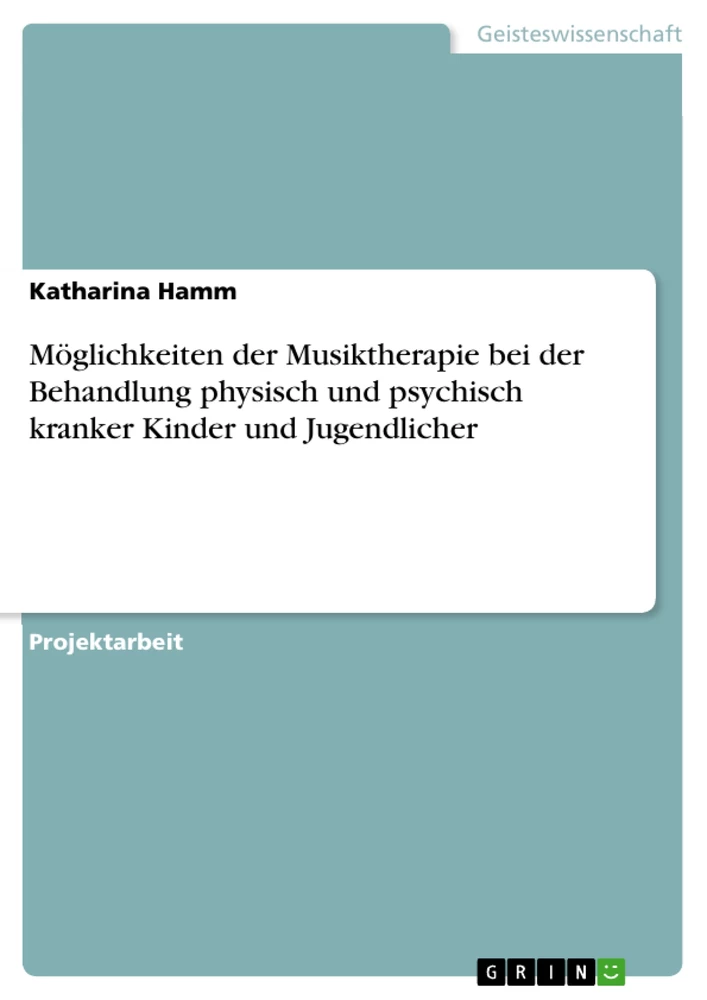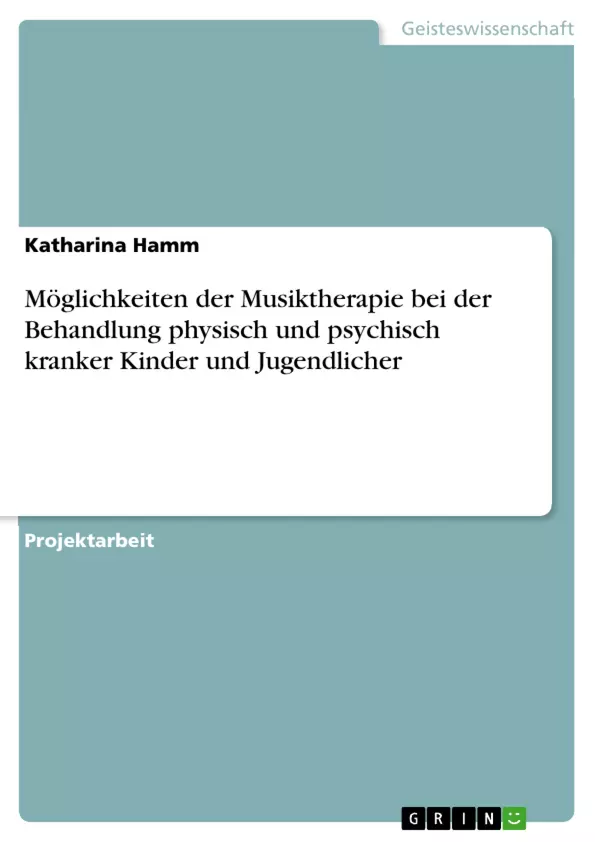Die Arbeit befasst sich mit dem Einsatz der Musiktherapie in der Bahandlung von Kindern und Jugendlichen. Dabei stützt sich die Arbeit auf berichte und ERfahrungen von verschiedenen Musiktherapeuten.
Inhaltsverzeichnis
1. Musik, eine geeignete Therapie
2. Definitionen der Musiktherapie
3. Die Bedeutung der Musik für die Entwicklung
4. Die Entwicklung der Musiktherapie
5. Forschung in der Musiktherapie
6. Die Formen der Musiktherapie
7. Der Verlauf der Therapie
8. Der Therapieraum
9. Die Instrumente und ihre Bedeutung in der Musiktherapie
10. Die Einsatzbereiche der Musiktherapie
10.1 Der Einsatz der Musiktherapie bei Kindern und Jugendlichen mit physischen Krankheiten
10.2 Der Einsatz der Musiktherapie bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Krankheiten
10.2.1 Lernbehinderungen
10.2.2 Autismus
10.2.3 Aggressionen
10.2.4 Essstörungen
10.2.5 Schizophrenie
10.2.6 Zwänge
10.2.7 Mutismus
10.2.8 Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen auf Grund sexuellen Missbrauchs
11. Musiktherapie als geeigneter Ansatz der Behandlung physischer und psychischer Krankheiten
12. Die Zukunft der Musiktherapie
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Bei welchen Krankheiten kann Musiktherapie Kindern helfen?
Die Therapie wird sowohl bei physischen als auch bei psychischen Erkrankungen eingesetzt, darunter Autismus, Essstörungen, Schizophrenie, Lernbehinderungen und Mutismus.
Welche Rolle spielen Instrumente in der Musiktherapie?
Instrumente dienen als Medium zur Kommunikation und zum Ausdruck von Emotionen, besonders wenn verbale Kommunikation für die Kinder schwierig oder unmöglich ist.
Hilft Musiktherapie auch bei traumatisierten Kindern?
Ja, ein spezifischer Einsatzbereich ist die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die psychische Störungen aufgrund von sexuellem Missbrauch entwickelt haben.
Wie sieht ein typischer Therapieverlauf aus?
Die Arbeit beschreibt den Verlauf der Therapie von der ersten Kontaktaufnahme über die aktive Behandlungsphase bis hin zur Evaluation der Fortschritte.
Können Aggressionen durch Musiktherapie gemildert werden?
Ja, Musiktherapie bietet Kindern einen geschützten Raum, um Aggressionen kanalisiert auszudrücken und alternative Verhaltensmuster zu erlernen.
- Quote paper
- Katharina Hamm (Author), 2009, Möglichkeiten der Musiktherapie bei der Behandlung physisch und psychisch kranker Kinder und Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206088