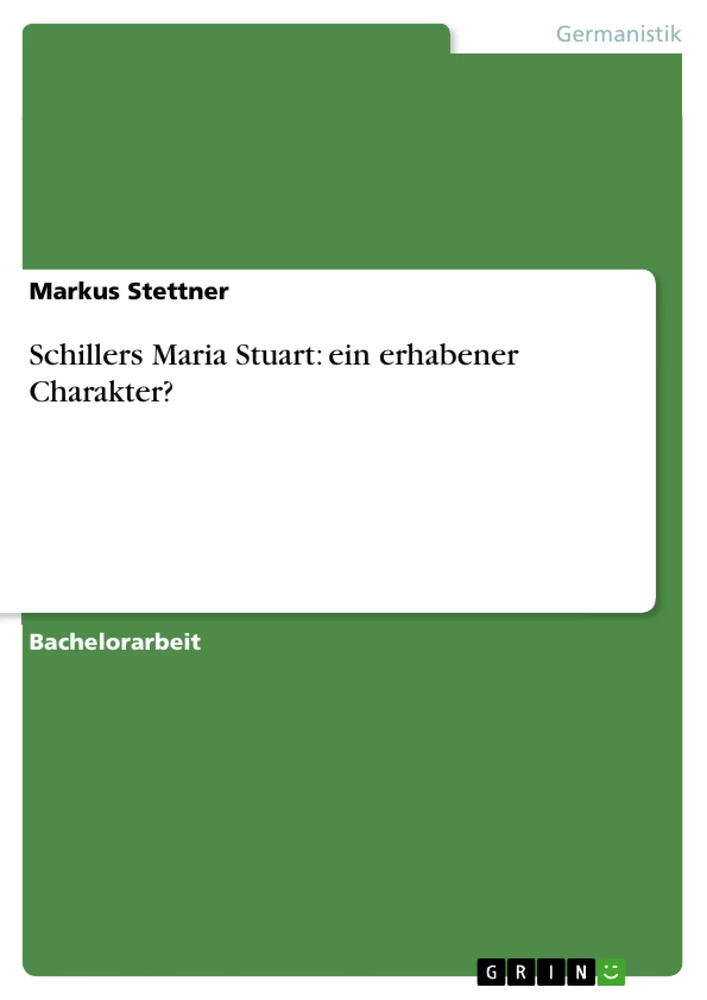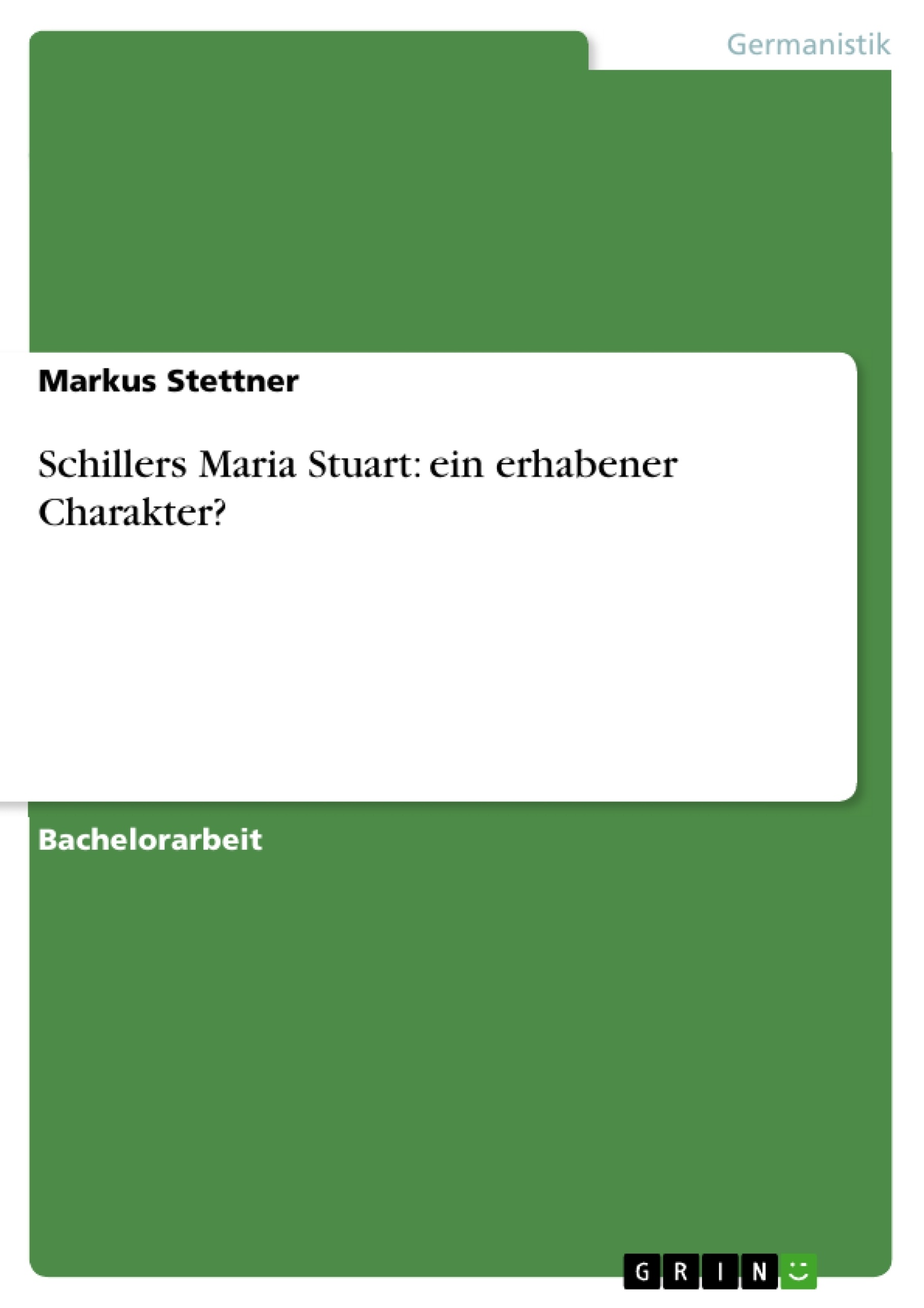Friedrich Schiller (1759-1805) ist einer derjenigen Autoren, die sich nicht nur literarisch, sondern auch theoretisch, der Dichtung gewidmet haben. Die Theorie lässt sich jedoch nicht immer problemlos auf die Literarischen Werke anwenden, und genau das macht sie so spannend. Eines dieser Theorie-Literatur-Verbindungen soll in dieser Arbeit betrachtet werden, nämlich die philosophische Theorie „Über das Erhabene“ im Bezug auf das Drama „Maria Stuart“.
Inhalt
Einleitung
1. Das Erhabene
1.1 Schillers theoretische Reflexionen „Über das Erhabene“
1.2 Kritik an Schillers System des Erhabenen
2. „Maria Stuart“
2.1 Maria vor der Wandlung
2.2 Maria im fünften Akt
3. Das Gender-Argument
Schluss
Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Friedrich Schiller unter dem „Erhabenen“?
Das Erhabene ist ein Zustand, in dem der Mensch seine moralische Freiheit gegenüber der überwältigenden Macht der Natur oder des Schicksals behauptet.
Ist Maria Stuart ein „erhabener Charakter“?
Die Arbeit untersucht, ob Maria Stuart, besonders im 5. Akt vor ihrer Hinrichtung, Schillers theoretische Forderungen an einen erhabenen Charakter erfüllt.
Wie wandelt sich Maria Stuart im Laufe des Dramas?
Von einer Frau, die in weltliche Leidenschaften und Schuld verstrickt ist, entwickelt sie sich hin zu einer Person, die ihr Schicksal (den Tod) gefasst und würdevoll annimmt.
Was ist das „Gender-Argument“ in Bezug auf das Erhabene?
Es wird diskutiert, ob Schillers Konzept des Erhabenen geschlechtsspezifisch geprägt ist und wie dies die Darstellung seiner weiblichen Protagonistin beeinflusst.
Wie verhält sich Schillers Theorie zu seiner literarischen Praxis?
Die Arbeit zeigt auf, dass die Anwendung der philosophischen Theorie „Über das Erhabene“ auf das konkrete Drama „Maria Stuart“ komplex ist und nicht immer reibungslos verläuft.
- Arbeit zitieren
- Markus Stettner (Autor:in), 2012, Schillers Maria Stuart: ein erhabener Charakter?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206132