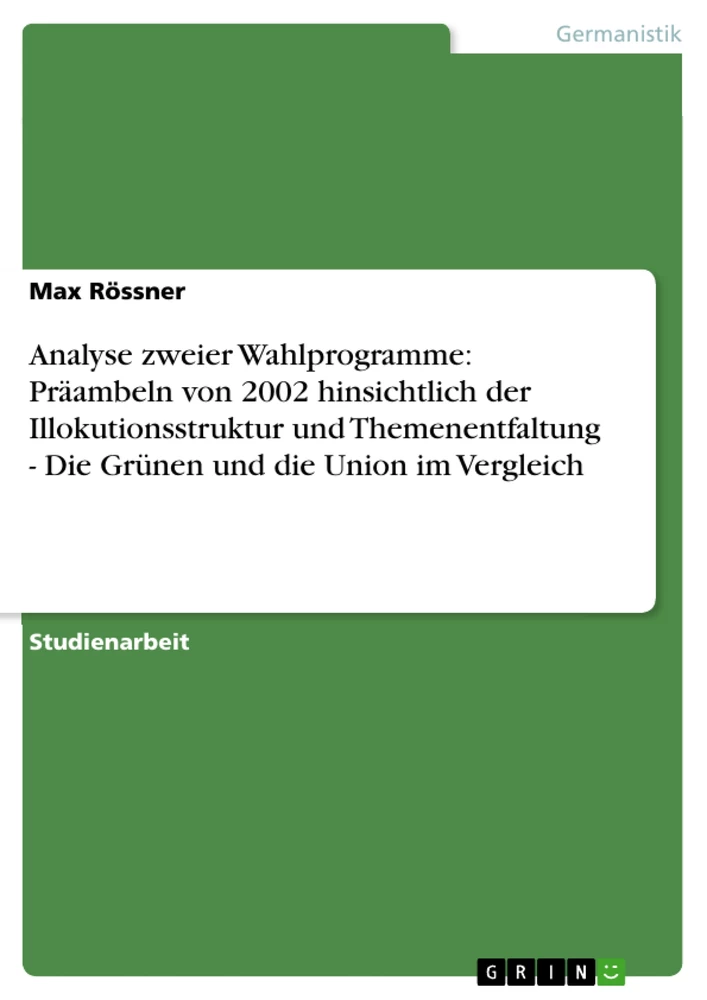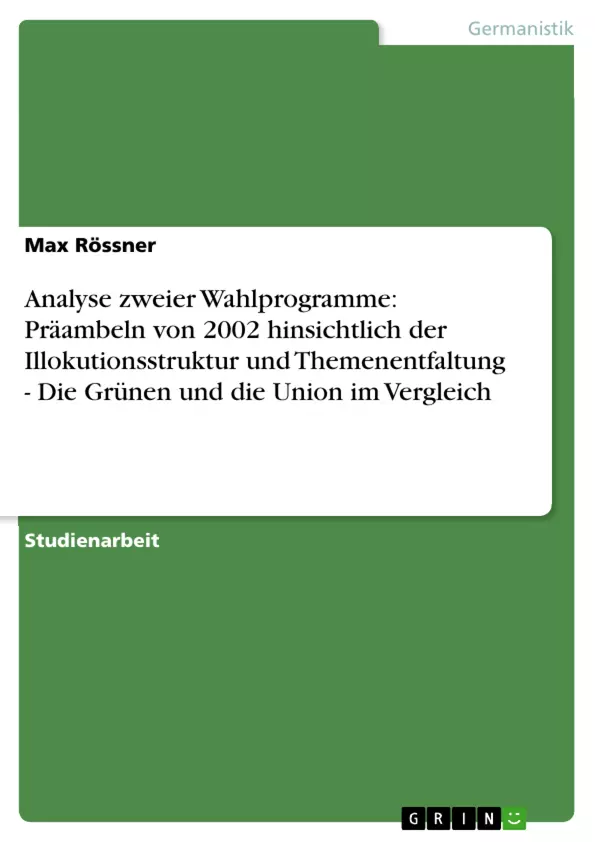Eine linguistische Untersuchung auf dem Gebiet der Politik scheint äußerst reizvoll- haben doch vor kurzem noch Millionen Kinogäste auf der ganzen Welt über die Sprachtherapie eines stotternden Staatsoberhauptes geschmunzelt. Die res publica benötigt erstklassige Rhetorik, so könnte das Credo des Kinojahres lauten; denn um die komplexen Themenlandschaften der vielfältigen Ressorts unter das Volk zu bringen, bedarf es klarer Worte.
Freilich gilt das nicht nur im Kinosaal, auch der deutsche Bürger will mit weisen Worten bezirzt und durch starke Argumente in eines der vielen Lager gezogen werden. Besonders in Zeiten einer Bundestagswahl schnellt die Anzahl der medienwirksam inszenierten Debatten in die Höhe. Dass es dabei nicht primär um die Feinheiten der Programme geht, liegt auf der Hand. Die gesprochene Rede greift in wesentlich größerem Umfang auf die Elemente der Polemik und der raschen emotiven Hinwendung zurück als das ein schriftlicher Text tut. Ein an Literatur schier überbordender Forschungszweig befasst sich daher auch mit dem Verhältnis von Politik und individueller Politikerpersönlichkeit einerseits, mit dem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis von massenmedialer Präsentation und programmatischer Substanz andererseits. Die Wahlprogramme der Parteien fristen neben diesen attraktiven, öffentlichkeitstauglicheren Bereichen der Politik nur ein Schattendasein. Ungerechtfertigterweise- denn in ihnen präsentiert jede zur Bundestagswahl zugelassene Partei, unabhängig von der Strahlkraft Ihrer Führungskader, ihr möglichst unverwechselbares Gesicht.
Daher befasst sich diese Arbeit mit der Textsorte des Wahlprogramms, genauer mit der vorgelagerten Präambel. Diese „[…] enthält Hinweise auf Motive und Ziele sowie den historischen Hintergrund […] staatlicher Schreiben, wodurch sie sich gerade in der Drastik der Darstellungsmittel vom detaillierten Punkt-Für-Punkt-Programm abhebt. Um ein weiteres gewinnbringendes Spannungsfeld hinsichtlich der Themenentfaltung zu provozieren, beschäftigt sich die Analyse einerseits mit einer Regierungspartei von 2002- Bündnis 90/ Die Grünen-, andererseits mit einer Oppositionspartei von 2002 – CDU/CSU.
Gliederung
1. Die Präambel und die Politik
2.1. Die Textfunktion der Präambel- der Kontext
2.2. Die Textfunktion der Präambel- die Illokutionsstruktur
2.2.1. Die Illokutionsstruktur der Präambel der Union
2.2.2. Die Illokutionsstruktur der Präambel der Grünen
2.3. Die Themenentfaltung
2.3.1. Die Themenentfaltung der Union
2.3.2. Die Themenentfaltung der Grünen
3. Gegenüberstellung und Fazit
4. Anhang
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Funktion einer Präambel in einem Wahlprogramm?
Die Präambel enthält Hinweise auf Motive, Ziele und den historischen Hintergrund einer Partei und nutzt oft drastischere Darstellungsmittel als das Detailprogramm.
Was bedeutet Illokutionsstruktur in der Linguistik?
Die Illokutionsstruktur analysiert die Absicht hinter sprachlichen Äußerungen – also ob etwas versprochen, gefordert oder festgestellt wird.
Wie unterschieden sich die Wahlprogramme von Union und Grünen im Jahr 2002?
Die Analyse vergleicht die Themenentfaltung einer Regierungspartei (Grüne) mit der einer Oppositionspartei (CDU/CSU) hinsichtlich ihrer rhetorischen Strategien.
Warum spielen Emotionen in Wahlprogrammen eine Rolle?
Politische Sprache nutzt Elemente der Polemik und emotive Hinwendung, um Bürger zu überzeugen und sie für ein politisches Lager zu gewinnen.
Was ist das Ziel einer linguistischen Untersuchung von Politik?
Ziel ist es zu verstehen, wie komplexe Themen durch Rhetorik vermittelt werden und wie Parteien ihr „unverwechselbares Gesicht“ textlich konstruieren.
Welche Rolle spielt der massenmediale Kontext für Programme?
Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen der programmatischen Substanz und ihrer medialen Präsentation, wobei die Präambel oft als Brücke dient.
- Quote paper
- Max Rössner (Author), 2011, Analyse zweier Wahlprogramme: Präambeln von 2002 hinsichtlich der Illokutionsstruktur und Themenentfaltung - Die Grünen und die Union im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206186