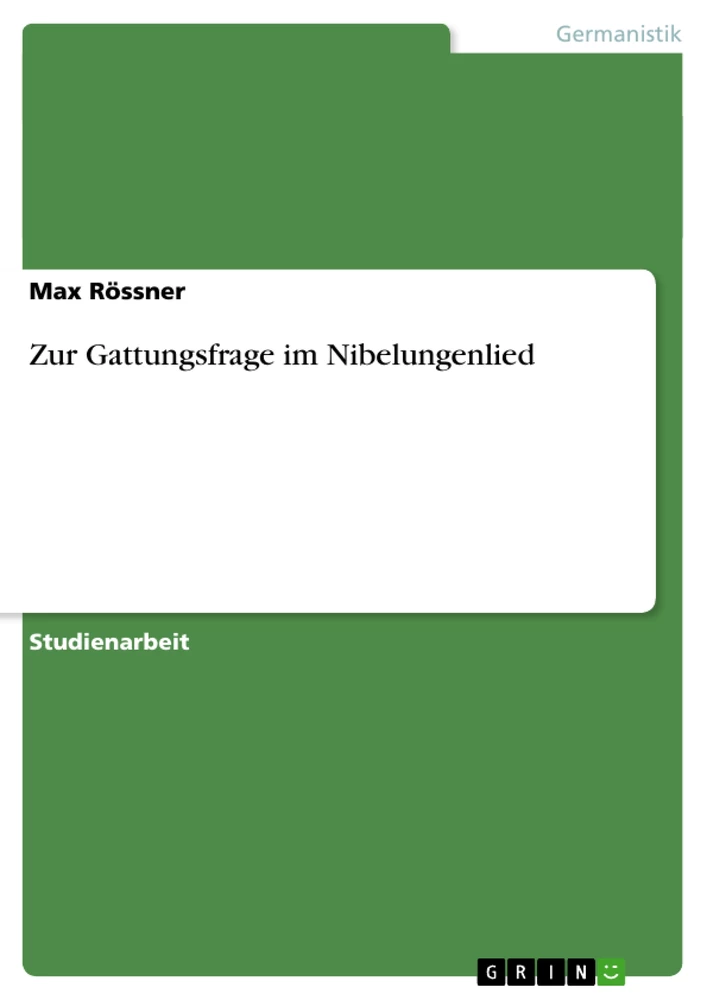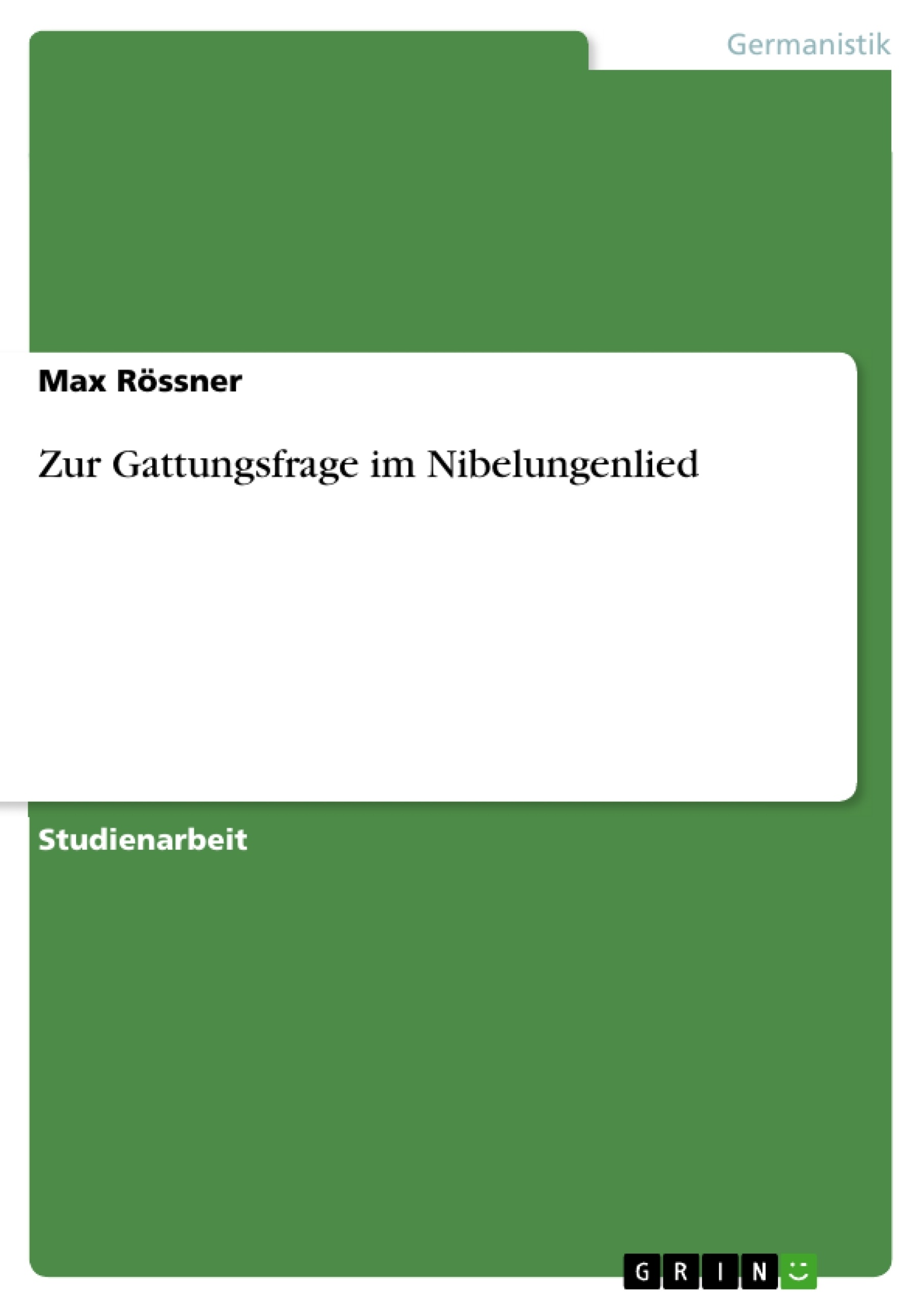Aus heutiger Sichtweise und literarischer Tradition erscheint die Frage nach der Gattung des Nibelungenliedes eigenartig überholt-scheint doch kaum jemand einen Zweifel daran zu haben, dass es sich um ein Epos, genauer: um das deutsche Nationalepos handelt. Dieser Befund ist freilich eine Tatsache; aber er ist eben nur eine historisch erwachsene Tatsache. Die eigentliche Frage kann daher nicht lauten, welchen Begriff wir dem mittelalterlichen Text heute zuschreiben, sondern von welchen zeitgenössischen Traditionslinien sich der oder die Autoren beeinflusst sahen und von welchen bekannten Gattungsmerkmalen sie sich abgrenzen wollten. Wie Heymes konstatiert, “[…] lässt sich Gattung vielleicht am klarsten als eine Art Vertrag zwischen dem Autor und seinem Publikum verstehen.“ Aus diesem Grund sind die vielfältigen Lesarten des Nibelungenliedes als Roman, wie sie Otfried Ehrismann zusammenfasst , für ein tiefer gehendes Verständnis eher hinderlich. Sie nivellieren die Textrezeption des 12. Jahrhunderts zugunsten eines modernen Schlagwortes.
Vorzuziehen ist daher eine synchrone Analyse der mittelalterlichen Textarten, denn nur dann, wenn man dem von Haymes so bezeichneten Vertrag historisch nachspüren kann, lässt sich die Gattungsfrage adäquat beantworten. Jeder Text steht im Bannfeld der Tradition, nur über die „Anpassung und Abweichung von überkommenen Normen […]“ definiert sich das Kunstwerk. Um 800 Jahre nach Verfertigung des Epos den Grad der Verschiebungen verstehen zu können, müssen zuerst einmal die einst gängigen Arten von Literatur beleuchtet werden.
Gliederung
1. Zur Gattungsfrage im Nibelungenlied: Vorüberlegungen
2.1. Die scheiternde Domestizierung Siegfrieds
2.2. Der Königinnenstreit als Aporie der Wertkonzepte
2.3. Kriemhilds Rache als Scheitern der suone
3. Die Spielregeln der Gattungen als semantische Stützen
Literaturverzeichnis
1. Zur Gattungsfrage im Nibelungenlied: Vorüberlegungen
Aus heutiger Sichtweise und literarischer Tradition erscheint die Frage nach der Gattung des Nibelungenliedes eigenartig überholt-scheint doch kaum jemand einen Zweifel daran zu haben, dass es sich um ein Epos, genauer: um das deutsche Nationalepos handelt. Dieser Befund ist freilich eine Tatsache; aber er ist eben nur eine historisch erwachsene Tatsache. Die eigentliche Frage kann daher nicht lauten, welchen Begriff wir dem mittelalterlichen Text heute zuschreiben, sondern von welchen zeitgenössischen Traditionslinien sich der oder die Autoren beeinflusst sahen und von welchen bekannten Gattungsmerkmalen sie sich abgrenzen wollten. Wie Heymes konstatiert, “[…] lässt sich Gattung vielleicht am klarsten als eine Art Vertrag zwischen dem Autor und seinem Publikum verstehen.“[1] Aus diesem Grund sind die vielfältigen Lesarten des Nibelungenliedes als Roman, wie sie Otfried Ehrismann zusammenfasst[2], für ein tiefer gehendes Verständnis eher hinderlich. Sie nivellieren die Textrezeption des 12. Jahrhunderts zugunsten eines modernen Schlagwortes.
Vorzuziehen ist daher eine synchrone Analyse der mittelalterlichen Textarten, denn nur dann, wenn man dem von Haymes so bezeichneten Vertrag historisch nachspüren kann, lässt sich die Gattungsfrage adäquat beantworten. Jeder Text steht im Bannfeld der Tradition, nur über die „Anpassung und Abweichung von überkommenen Normen […]“[3] definiert sich das Kunstwerk. Um 800 Jahre nach Verfertigung des Epos den Grad der Verschiebungen verstehen zu können, müssen zuerst einmal die einst gängigen Arten von Literatur beleuchtet werden.
Zum einen wäre der Minnesang zu nennen, der nach heutigen Maßstäben der Lyrik zugerechnet wird. In meist gesungener Form wird darin die treue, selbstlose Liebe zu einer adligen Frau ausgedrückt. Den damaligen Zeitgeist traf in besonderer Weise der höfische Roman, der eine Herrscherfamilie in meist günstigem Licht darstellte und an ihren Mitgliedern den Wertekanon manifestierte. Neben Versatzstücken dieser zwei schriftlich angelegten Gattungen finden sich im Nibelungenlied auch „[…] Rückgriffe auf die germanische Sagenwelt […]“[4], die im Mittelalter hauptsächlich mündlich tradiert wurden. Eines dieser mythischen Motive war auch der im Nibelungenlied thematisierte Drachentöter Siegfried.
Die Aufgabe zeitgenössischer wie auch heutiger Interpreten besteht nun darin, die collagenartige Zusammenmischung der verschiedenen Stile im Nibelungenlied zu identifizieren und die daraus resultierende Wirkung zu beschreiben. Sicherlich ist vor diesem Hintergrund Christian Niedling zuzustimmen, wenn er als warnendes Vorwort zu bedenken gibt, „[…] dass sich das Nibelungenlied einer eindeutigen Gattungszuordnung […] entzieht.“[5] Aber gerade diese schwebende Unsicherheit macht das Epos der Deutschen so reizvoll; außerdem lässt sich –wie noch zu zeigen sein wird- anhand einiger, exemplarischer Bruchstellen im Text auf den dahinterliegenden Bedeutungsgehalt schließen. Und so ist die Suche nach der passenden Form weit mehr als nur ein stilistisches Nebengeplänkel; viel mehr eröffnet gerade der Blick für das Nebeneinander und die gegenseitige Überlagerung der Erzählweisen das Verständnis um die literarische Brillanz des Nibelungenlieds.
2.1 Die scheiternde Domestizierung Siegfrieds
Der wohl populärste Charakter des Liedes ist Siegfried. Man kann davon ausgehen, dass der heroische Drachentöter im kulturellen Wissen des mittelalterlichen Zuhörers verankert ist. Umso auffälliger ist seine untypische Attribuierung; denn nicht etwa an wagemutige Heldentaten denkt er zu Beginn der dritten Aventiure, sondern an die „[…] hohe minne […]“[6], mit der er die schöne Kriemhild zu erobern sucht. Dieser Herzenswunsch rückt ihn gleich unverkennbar in die Nähe der höfischen Rittervorstellung, die dann jedoch noch in der gleichen Aventiure konterkariert wird: ganz in der Manier des martialischen Haudegens fordert er seinen Gastgeber Gunther zu einem Zweikampf heraus, um das Burgundenreich zu erzwingen. Jan- Dirk Müller spricht hier ganz richtig von einer „[…] gegensätzliche[n] Determination […]“[7] Siegfrieds, von sich eigentlich gegenseitig ausschließenden Eigenschaften des Heros. Besonders gravierend für den Verlauf der Handlung scheint auch die Unfähigkeit der burgundischen Hofgesellschaft, Siegfrieds aggressives Verhalten grundlegend auszuräumen; lediglich für den Moment kann es kanalisiert werden. Somit stehen sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt zwei unvereinbare Konzepte gegenüber: einerseits das pazifizierte Wertesystem des Hofes, andererseits die Kraft-und Stärkebetonung des archaischen Einzelkämpfers. Abzulehnen ist daher Julian Stechs Vorschlag, Siegfried definiere sich beim Empfang in Worms „[…] über seine Sexualität, [...] um die Frau seiner Wahl zu bekommen.“[8] Wäre das tatsächlich der Fall, würde die Minne- Konzentration Siegfrieds, die ihm kurz zuvor zugeschrieben wurde, in sich zusammenfallen. Plausibler ist ein absichtlich eingeflochtener, grundlegender Zwiespalt des Heros, den er aber kaum reflektieren und erst recht nicht beseitigen kann. Haymes schreibt hierzu, gerade durch die Widersprüche werde „[…] die Aufmerksamkeit des Publikums auf eben diese Elemente gelenkt […]“[9] und dadurch für eine Interpretation gewissermaßen vorpräpariert. Siegfried weiß zwar um die Ideale der höfischen Gesellschaft, ist aber ebenso unveränderlich in der alten, mythischen Welt verankert. Mit genau berechnetem Kalkül präsentiert der Autor des Nibelungenliedes mal die friedliche, mal die potente Janusseite des Helden.
[...]
[1] Haymes, Edward: Das Nibelungenlied: Geschichte und Interpretation. 1. Auflage. München: Fink- Verlag 1999 (= Uni- Taschenbücher; Bd. 2070). (S. 54)
[2] Vgl.: Ehrismann, Otfried: Nibelungenlied: Epoche- Werk- Wirkung. 2., neu bearb. Auflage. München: Beck- Verlag 2002 (= Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte). (S. 148/149)
[3] Haymes, Edward (S. 55)
[4] Firges, Jean: Das Nibelungenlied : Ein Epos der Stauferzeit. 1. Auflage. Annweiler am Trifels: Sonnenberg- Verlag 2001 (= Exemplarische Reihe Literatur und Philosophie; Bd. 5). (S. 12)
[5] Niedling, Christian: Zur Bedeutung von Nationalepen im 19. Jahrhundert: Das Beispiel von Kalevala und Nibelungenlied. 1. Auflage. Köln: SAXA- Verlag 2007 (= Universitätsschriften; Bd. 2). (S. 42)
[6] Das Nibelungenlied: Mittelhochdeutsch/ Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor, ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. 1. Auflage. Stuttgart: Reclam Verlag 2005. (47,1)
[7] Müller, Jan- Dirk: Das Nibelungenlied. 3., neu bearb. Und erw. Auflage. Berlin: Schmidt- Verlag 2009 (= Klassiker- Lektüren; Bd. 5). (S. 83)
[8] Stech, Julian: Das Nibelungenlied: Appellstrukturen und Mythosthematik in der mittelhochdeutschen Dichtung. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Lang- Verlag 1993 (= Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1410). (S. 170)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes über das Nibelungenlied?
Der Text untersucht die Gattungsfrage des Nibelungenliedes und argumentiert, dass eine synchrone Analyse der mittelalterlichen Textarten notwendig ist, um die literarische Brillanz des Epos zu verstehen. Er diskutiert die Einflüsse von Minnesang, höfischem Roman und germanischer Sagenwelt.
Welche Gattungsfrage wird im Bezug auf das Nibelungenlied untersucht?
Die Frage, inwiefern sich das Nibelungenlied von zeitgenössischen Traditionslinien beeinflusst sah und von welchen bekannten Gattungsmerkmalen es sich abgrenzen wollte. Der Text stellt die übliche Kategorisierung als reines Nationalepos in Frage und fordert eine differenziertere Betrachtung.
Welche literarischen Gattungen werden im Kontext des Nibelungenliedes genannt?
Minnesang, höfischer Roman und germanische Sagenwelt (die mündlich überliefert wurden).
Wie wird Siegfried im Text charakterisiert?
Siegfried wird als widersprüchlicher Charakter dargestellt, der sowohl Züge des höfischen Ritters (Minne, Liebe zu Kriemhild) als auch des martialischen Haudegens (Zweikampf mit Gunther) aufweist. Seine Unfähigkeit, diese Gegensätze aufzulösen, ist ein zentrales Thema.
Welche Kritik wird an der Interpretation Siegfrieds über seine Sexualität geübt?
Die Interpretation, dass Siegfried sich in Worms über seine Sexualität definiert, wird abgelehnt, da dies im Widerspruch zu seiner zuvor gezeigten Minne-Konzentration stünde. Stattdessen wird ein tiefer liegender Zwiespalt betont.
Was bedeutet "Scheitern der suone" im Kontext der Gliederungspunkte?
Suone bezieht sich auf Sühne. Das Scheitern der Sühne, also der Versöhnung oder Wiedergutmachung, als Folge von Kriemhilds Rache ist ein zentraler Aspekt der Tragödie des Nibelungenlieds.
Welche Autoren werden im Text zitiert oder erwähnt?
Edward Haymes, Otfried Ehrismann, Jean Firges, Christian Niedling, Siegfried Grosse, Jan-Dirk Müller und Julian Stech.
Was wird über die Bedeutung von Gattungen gesagt?
Es wird argumentiert, dass Gattungen als eine Art Vertrag zwischen Autor und Publikum verstanden werden können und dass die Anpassung und Abweichung von überkommenen Normen ein Kunstwerk definiert. Die Analyse der Gattungsfrage ermöglicht ein tieferes Verständnis der literarischen Brillanz des Nibelungenliedes.
Was wird zum Schluss über die Gattungszuordnung gesagt?
Es wird erwähnt, dass sich das Nibelungenlied einer eindeutigen Gattungszuordnung entzieht, aber genau diese schwebende Unsicherheit macht das Epos so reizvoll.
- Quote paper
- Max Rössner (Author), 2011, Zur Gattungsfrage im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206187