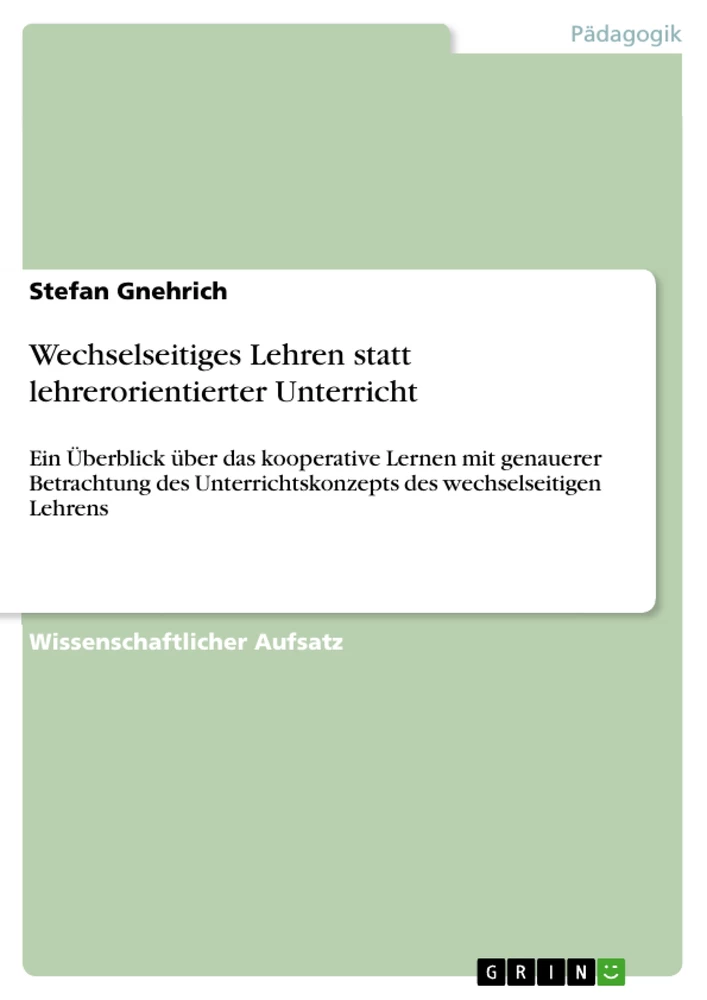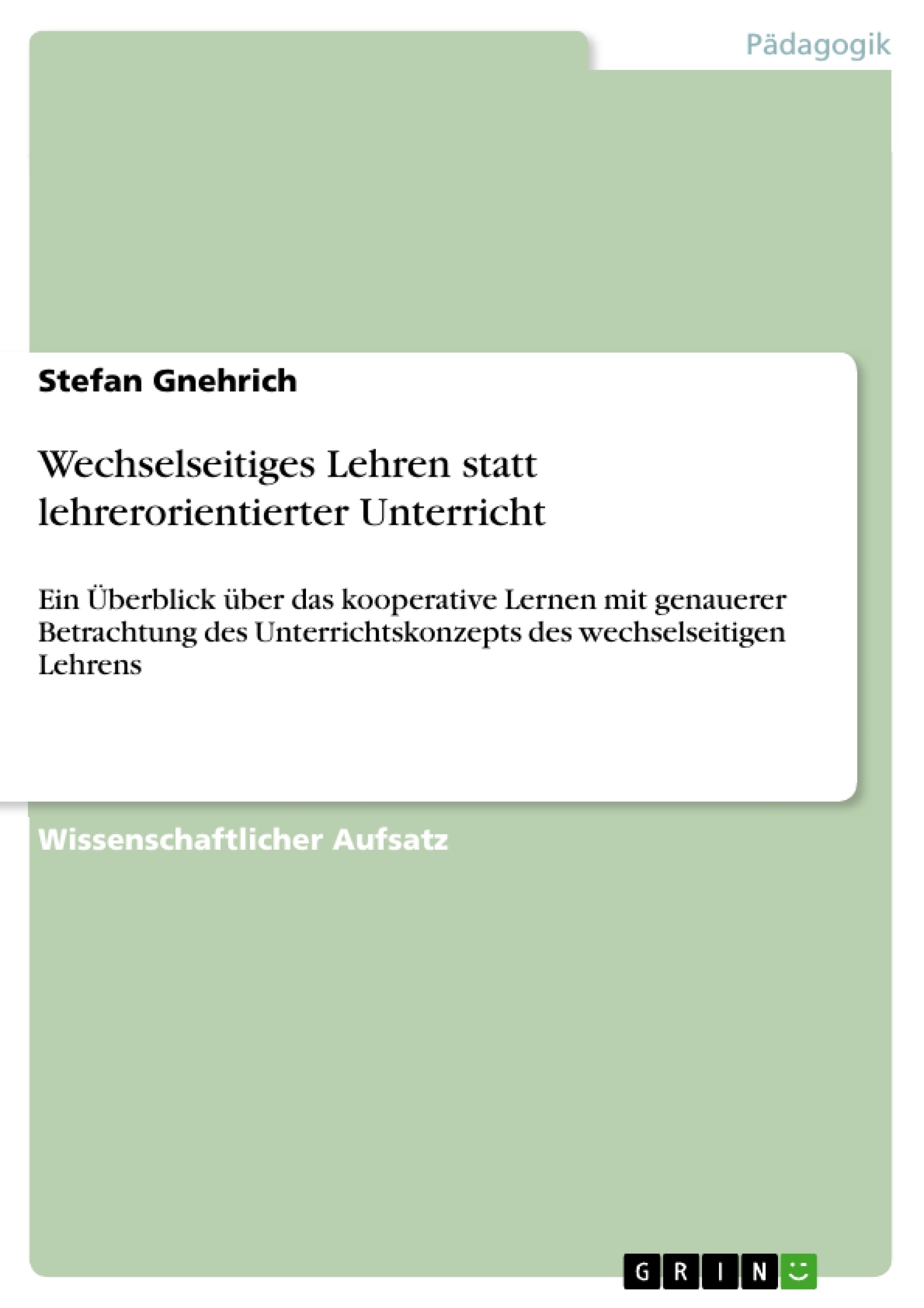Didaktische Kreativität sowie der Mut zur „[…] Abkehr vom stark lehrerorientierten Unterricht [...]“ prägen den zentralen Punkt meines wissenschaftlichen Kommentars. In jenem beschäftige ich mich mit der Thematik des kooperativen Lernens und werde dabei die Methode des wechselseitigen Lehrens genauer erklären. Hierfür ist es natürlich notwendig, im Vorfeld einen groben Überblick über das kooperative Lernen zu erhalten, um somit das Konzept des wechselseitigen Lehrens zu verstehen. Dabei sollen die Schwerpunkte im Wesentlichen auf zwei verschiedenen Formen des kooperativen Lernens liegen. Zum einem beschäftige ich mich nach einer kurzen Darstellung zum kooperativen Lernen mit der Form des selbstorganisierten Lernens (SOL) und werde danach auf die Form des Lernens durch wechselseitiges Lehren (WELL) genauer eingehen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kooperatives Lernen
Darstellung des Selbstorganisierten Lernens (SOL)
Darstellung des Lernens durch wechselseitiges Lehren (WELL)
Die Methoden des Lernens durch wechselseitiges Lehren
Unterrichtsbeispiel für Gemeinschaftskunde Klasse 12
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Didaktische Kreativität sowie der Mut zur „[…] Abkehr vom stark lehrerorientierten Unterricht [...]“[1] prägen den zentralen Punkt meines wissenschaftlichen Kommentars. In jenem beschäftige ich mich mit der Thematik des kooperativen Lernens und werde dabei die Methode des wechselseitigen Lehrens genauer erklären. Hierfür ist es natürlich notwendig, im Vorfeld einen groben Überblick über das kooperative Lernen zu erhalten, um somit das Konzept des wechselseitigen Lehrens zu verstehen. Dabei sollen die Schwerpunkte im Wesentlichen auf zwei verschiedenen Formen des kooperativen Lernens liegen. Zum einem beschäftige ich mich nach einer kurzen Darstellung zum kooperativen Lernen mit der Form des selbstorganisierten Lernens (SOL) und werde danach auf die Form des Lernens durch wechselseitiges Lehren (WELL) genauer eingehen. Im zweiten Teil erfolgt dann ein von mir konstruiertes Beispiel für das Unterrichtsfach Gemeinschaftskunde. Ich stütze mich bei meiner Darstellung zu den verschiedenen Lernmethoden vor allem auf das Konzept von Roland Hepting, einem Schulleiter aus Baden-Württemberg, der in seinem Buch „Zeitgemäße Methodenkompetenz im Unterricht“ eine hervorragende und zugleich gut verständliche Darstellung der Thematik bietet. Ein weiterer Grund für die Wahl dieses Buches war die beigelegte CD-ROM zum Buch, die seine Ausführungen anhand von zahlreichen Unterrichtsvideos hervorragend ergänzten. Desweiteren beziehe ich mich auf Anne A. Huber, die in ihrem Buch „Bedingungen effektiven Lernens in Kleingruppen unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Lernskripten“ interessante Erkenntnisse über das effektive Lernen in Kleingruppen beschreibt.
Kooperatives Lernen
„Zeitgemäßes Lehren und Lernen erfordert zeitgemäße Formen des Unterrichtens.“[2] Mit dieser Aussage steigt Roland Hepting in die Thematik des kooperativen Lernens ein. Er verdeutlicht dem Leser allerdings bereits zu Beginn seiner Ausführungen, dass es nicht die richtige Methode des Unterrichtens geben kann. Vielmehr geht es um ein Initiieren des Lernprozesses, der sich ganz im Sinne des Schülers als effektiv erweisen soll. Es kann also nur der Lehrer entscheiden, in welchen Umfang er sich im Bereich des kooperativen Lernens bewegen will. Hepting stellt allerdings auch fest, dass es in einer stark lehrerzentrierten Lernumgebung nicht zwangsweise zum gewünschten Lernerfolg der Schüler kommen muss. Nach Hepting bezeichnen kooperative Lern- und Arbeitsformen grundsätzlich Arbeitsweisen, in denen Schüler im Miteinander Lernprozesse gestalten. Allerdings sollte der Lehrer diverse Kriterien bei solchen Interaktionsabläufen berücksichtigen, um so einen möglichst effektiven Unterricht den Schüler zu bieten. Die Autoren Klaus Konrad und Silke Traub geben dabei sechs Kriterien an, die bei den Abläufen im Bereich des kooperativen Lernens zu berücksichtigen sind. Als Beispiel möchte ich hierfür die positive Wechselbeziehung nennen, bei der die Schüler zusammenwirken müssen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Dieses Zusammenwirken begünstigt die Sozialkompetenz, denn die Schüler werden angehalten, andere Perspektiven als ausschließlich die Ihrige einzunehmen. Somit muss ich Roland Hepting zustimmen, wenn er von der Förderung einer Vielzahl von Kompetenzen spricht. Der Schüler erhält dadurch einen Zuwachs der Methoden-, Sozial- und Sprachkompetenz. Auch Herbert Gudjons, ein weiterer Erziehungswissenschaftler, spricht sich für „die eigentätige, viele Sinne umfassende Auseinandersetzung und aktive Aneignung eines Lerngegenstandes“[3] aus. Somit ergibt sich für mich das folgende Zwischenfazit: es sind viele Unterrichtsmethoden existent. Allerdings sollte der Lehrer mutig sein und sie gebrauchen beziehungsweise sie probieren und für sich entscheiden, welche Methode wirkungsvoll ist.
Darstellung des Selbstorganisierten Lernens (SOL)
Im nun folgenden Teil gehe ich näher auf zwei Formen des kooperativen Unterrichts ein. Zuerst erkläre ich die Form des Selbstorganisierten Lernens (SOL), die von Herold und Landherr 2003 entwickelt wurde. Dabei geht es um die Eigeninitiative des Schülers, der selbstverantwortlich arbeiten soll. Es wird also ein Dogmenwechsel initiiert, der lehrerzentrierte Unterricht entwickelt sich zum schüleraktiven Unterricht, mit dem Hauptelement des selbstorganisierten Lernens.
Die Begründer dieser Methode beschreiben das selbstorganisierte Lernen als keine neue methodische Variante, sondern eher als einen Ansatz, der mit neuen Methoden arbeitet, um die Lern-und Unterrichtskultur praktisch umzusetzen. Dabei gibt es verschiedene Anwendungsformen, die über einen beliebigen Zeitraum anwendbar sind. SOL basiert auf dem Grundprinzip des Gruppenpuzzles, sodass jede Gruppe von Schülern auf die Ergebnisse einer anderen Gruppe angewiesen ist. Im Bereich der Methodik ist SOL als eine Art Sandwich zu verstehen. Es beinhaltet einen Phasenwechsel zwischen individuellen und kollektiven Phasen. Der Schüler erarbeitet zunächst ein Thema für sich, er befindet sich hierbei in der individuellen Phase, und wertet es im Nachgang mit seiner Gruppe aus, woran die kollektive Phase sichtbar wird. Dem Lehrer kommt dabei die Aufgabe zu, die Lerninhalte zunächst in eine nicht-lineare, also ungeordnete, Struktur zu bringen, sodass die Schüler dieses Puzzle wieder zusammensetzen müssen. Er muss sich allerdings immer als eine hilfestellende Person anbieten. So kommt es zu einem veränderten Rollenverständnis, bei dem der Lehrer in die Passivität gestellt wird, sodass die Schüler vom rezeptiven zum aktiven Subjekt werden und der Lehrer eine Art Lernbegleiter darstellt. Dieser Schritt in Richtung der Passivität fällt den meisten Lehrern schwer, da sie diese Methode als zu wenig arbeitshaltig ansehen. Vielleicht sollten sie einsehen, dass diese Form des Unterrichts eine willkommene Abwechslung sowie Entlastung darstellt. Durch die Selbstorientierung der Schüler kommt es zu einer nachhaltigen und wirkungsvollen Ergebnissicherung, wobei auch hier wieder der Hinweis gelten soll, dass es zu einer zahlreichen Kompetenzentwicklung der Schüler kommt. Hepting stellt schlussendlich fest: „Nach meiner Auffassung ist das die Zielformulierung für einen qualitativ guten Unterricht, den wir heute als Maßstab unserer Unterrichtsarbeit vorgeben sollten!“[4] Dieser Aussage kann ich nur zustimmen, da eine hohe Qualität des Unterrichts als oberste Maxime stehen sollte.
[...]
[1] Hepting, Roland: Zeitgemäße Methodenkompetenz im Unterricht. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag 2004. S. 83.
[2] Hepting, Roland: Zeitgemäße Methodenkompetenz im Unterricht. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag 2004. S. 56.
[3] Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert Lehren und Lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit. Bad Heilbrunn / Obb. 2001. S.10.
[4] Hepting, Roland: Zeitgemäße Methodenkompetenz im Unterricht. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag 2004. S. 71.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept WELL im Unterricht?
WELL steht für „Lernen durch wechselseitiges Lehren“. Es ist eine Form des kooperativen Lernens, bei der Schüler sich gegenseitig Inhalte vermitteln.
Was ist der Unterschied zwischen SOL und WELL?
SOL (Selbstorganisiertes Lernen) fokussiert auf die Eigeninitiative und Selbstverantwortung des Schülers beim Wissenserwerb, während WELL speziell den Prozess des gegenseitigen Lehrens betont.
Welche Kompetenzen werden durch WELL gefördert?
Neben der Fachkompetenz entwickeln Schüler verstärkt Methoden-, Sozial- und Sprachkompetenz durch die aktive Auseinandersetzung und Interaktion in Kleingruppen.
Welche Rolle nimmt die Lehrkraft beim kooperativen Lernen ein?
Die Lehrkraft tritt aus dem Zentrum des Geschehens zurück und fungiert eher als Lernbegleiter oder Coach, der den Rahmen schafft und bei Bedarf Hilfestellung gibt.
Für welches Unterrichtsfach wird ein konkretes Beispiel gegeben?
Die Arbeit enthält ein konstruiertes Unterrichtsbeispiel für das Fach Gemeinschaftskunde in einer 12. Klasse.
- Quote paper
- Stefan Gnehrich (Author), 2009, Das Unterrichtskonzept Lernen durch wechselseitiges Lehren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206236