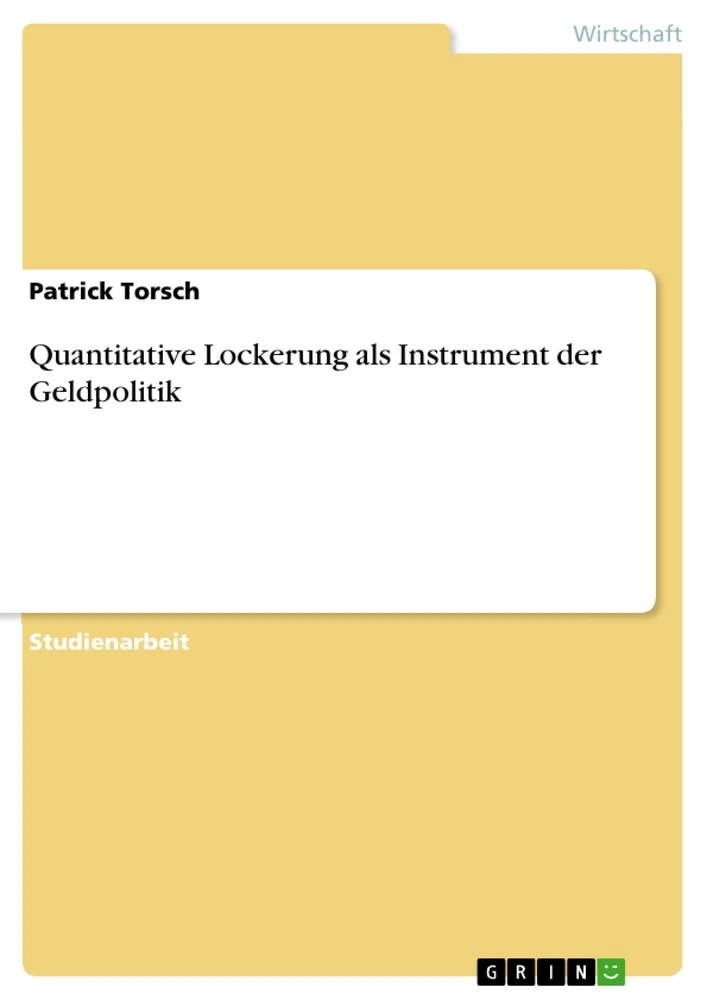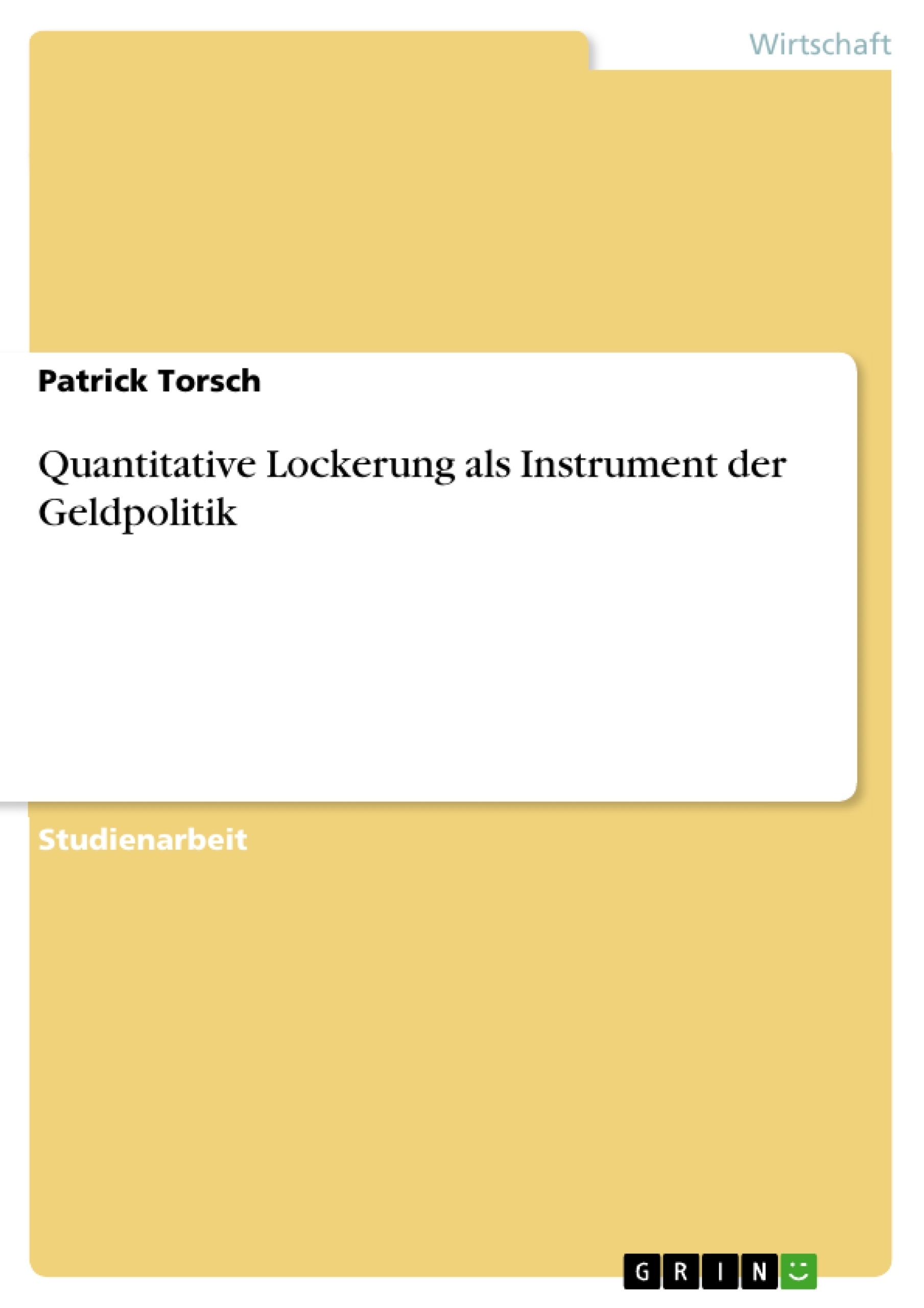Umgangssprachlich häufig als „Geld drucken“ missverstanden, basiert der Gedanke der
quantitativen Lockerung auf der Idee des „helicopter drop of money“ des Wirtschaftsnobelpreisträgers
Milton Friedman. Der Abwurf des Geldes aus einem Helikopter ist eine
Metapher für eine Geldmengenausweitung durch das Federal Reserve System, um eine
Deflation zu vermeiden. Im Gegensatz zur Inflation ist bei der Deflation zu wenig Geld in
Umlauf. In der Folge sinken die Preise, was wiederum dazu führt, dass viele Unternehmen
Pleite gehen, Arbeitslosigkeit und Monopolbildung sind die Konsequenzen. Monetarist
Friedman geht im Gegensatz zu Keynes davon aus, dass eine Notenbank über die
Geldmenge Inflation bzw. Deflation einer Volkswirtschaft beeinflussen kann.1 Lässt der
Friedman’sche Helikopter die Geldmenge ansteigen, steigt das Preisniveau und eine
drohende Deflation kann abgewehrt werden. Weil er dieses suggestive Sprachbild des
Ökonomen in einer Rede vor dem National Economist Club in Washington 2002 aufgriff,
ist der derzeitige Vorsitzende des Federal Reserve Systems Ben Bernanke mittlerweile
auch unter dem Spitznamen „helicopter Ben“ bekannt. Eben jener Bernanke hat in seiner
Amtszeit als Chef der US-Notenbank bereits mehrere Programme zum Ankauf von
Staatsanleihen und anderer Wertpapiere aus Angst vor Deflation erlassen. Meine Arbeit
wird im nächsten Abschnitt konventionelle geldpolitische Praktiken und über deren Grenzen
die Möglichkeiten des Einsatzes unkonventioneller Methoden erläutern. Im anschließenden
Kapitel werde ich mit Fokussierung auf die quantitative Lockerung die unkonventionelle
Geldpolitik der Bank of Japan, des Federal Reserve Systems und der europäischen
Zentralbank sowie deren Wirkungen beschreiben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Rettung vor der Deflation: Friedmans Helikopter
- 2 Geldpolitische Konzepte
- 2.1 Konventionelle Geldpolitik
- 2.2 Grenzen konventioneller Geldpolitik
- 2.3 Unkonventionelle geldpolitische Instrumente
- 2.3.1 Verpflichtung zur Beibehaltung niedriger Zinsen
- 2.3.2 Qualitative Easing
- 2.3.3 Liquidity Easing
- 2.3.4 Credit Easing
- 2.3.5 Quantitative Easing
- 3 Empirie des Quantitative Easing
- 3.1 Bank of Japan
- 3.1.1 Umfeld und Inhalte der quantitativen Lockerung
- 3.1.2 Wirksamkeit der Maßnahmen
- 3.2 Federal Reserve System
- 3.2.1 Unkonventionelle Maßnahmen seit der Finanzkrise
- 3.2.2 Auswirkungen der unkonventionellen Geldpolitik
- 3.3 Europäische Zentralbank
- 3.3.1 Veränderte Geldpolitik im Kontext der Finanz- und Schuldenkrise
- 3.3.2 Bewertung der Maßnahmen in der Eurozone
- 3.1 Bank of Japan
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die quantitative Lockerung (QE) als unkonventionelles geldpolitisches Instrument. Die Zielsetzung besteht darin, die Wirksamkeit von QE anhand von Fallstudien verschiedener Zentralbanken (Bank of Japan, Federal Reserve System, Europäische Zentralbank) zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung von QE im Kontext spezifischer wirtschaftlicher Herausforderungen.
- Wirksamkeit der quantitativen Lockerung
- Vergleich der QE-Strategien verschiedener Zentralbanken
- Kontext der Anwendung von QE in Krisenzeiten
- Grenzen konventioneller Geldpolitik
- Alternative geldpolitische Instrumente
Zusammenfassung der Kapitel
1 Rettung vor der Deflation: Friedmans Helikopter: Dieses Kapitel legt vermutlich den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar, indem es das Konzept der quantitativen Lockerung im Kontext der Deflationsbekämpfung einführt. Es wird wahrscheinlich auf Milton Friedmans Helikoptergeld-Modell Bezug nehmen, um die Notwendigkeit unkonventioneller geldpolitischer Maßnahmen in Situationen mit anhaltend niedriger Inflation zu veranschaulichen. Der Fokus liegt vermutlich auf der Darstellung der theoretischen Grundlagen und der Herausforderungen, die eine Deflation mit sich bringt.
2 Geldpolitische Konzepte: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über konventionelle und unkonventionelle geldpolitische Instrumente. Es analysiert die Grenzen konventioneller Geldpolitik, insbesondere bei sehr niedrigen oder gar negativen Zinsen. Die verschiedenen Arten unkonventioneller Maßnahmen, wie z.B. Qualitative Easing, Liquidity Easing, Credit Easing und vor allem Quantitative Easing, werden detailliert beschrieben und ihre Wirkungsmechanismen erklärt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der theoretischen Grundlagen und der Unterschiede zwischen den verschiedenen Instrumenten.
3 Empirie des Quantitative Easing: Dieses Kapitel präsentiert empirische Evidenz zur Wirksamkeit von QE anhand von Fallstudien der Bank of Japan, des Federal Reserve Systems und der Europäischen Zentralbank. Für jede Zentralbank wird der Kontext der jeweiligen QE-Maßnahmen, die Umsetzung und die beobachteten Auswirkungen analysiert. Die Kapitelteile vergleichen die Strategien und Ergebnisse der drei Zentralbanken und untersuchen die Unterschiede im Hinblick auf den jeweiligen wirtschaftlichen Kontext und die Struktur der jeweiligen Finanzmärkte. Der Vergleich erlaubt es, die Effektivität von QE unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten.
Schlüsselwörter
Quantitative Lockerung, Geldpolitik, Deflation, Zentralbanken, unkonventionelle Geldpolitik, Bank of Japan, Federal Reserve System, Europäische Zentralbank, Finanzkrise, Wirksamkeit, empirische Analyse, Konjunkturpolitik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der quantitativen Lockerung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die quantitative Lockerung (QE) als unkonventionelles geldpolitisches Instrument und untersucht deren Wirksamkeit anhand von Fallstudien verschiedener Zentralbanken (Bank of Japan, Federal Reserve System, Europäische Zentralbank).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wirksamkeit von QE, einen Vergleich der QE-Strategien verschiedener Zentralbanken, den Kontext der Anwendung von QE in Krisenzeiten, die Grenzen konventioneller Geldpolitik und alternative geldpolitische Instrumente. Sie beleuchtet auch die Anwendung von QE im Kontext spezifischer wirtschaftlicher Herausforderungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Rettung vor der Deflation: Friedmans Helikopter; 2. Geldpolitische Konzepte; 3. Empirie des Quantitative Easing; und 4. Fazit.
Was wird im Kapitel "Rettung vor der Deflation: Friedmans Helikopter" behandelt?
Dieses Kapitel legt den theoretischen Hintergrund dar, indem es das Konzept der quantitativen Lockerung im Kontext der Deflationsbekämpfung einführt und sich wahrscheinlich auf Milton Friedmans Helikoptergeld-Modell bezieht.
Worüber informiert das Kapitel "Geldpolitische Konzepte"?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über konventionelle und unkonventionelle geldpolitische Instrumente, analysiert die Grenzen konventioneller Geldpolitik und beschreibt detailliert verschiedene unkonventionelle Maßnahmen wie Qualitative Easing, Liquidity Easing, Credit Easing und Quantitative Easing.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Empirie des Quantitative Easing"?
Dieses Kapitel präsentiert empirische Evidenz zur Wirksamkeit von QE anhand von Fallstudien der Bank of Japan, des Federal Reserve Systems und der Europäischen Zentralbank. Es analysiert den Kontext der jeweiligen QE-Maßnahmen, deren Umsetzung und die beobachteten Auswirkungen und vergleicht die Strategien und Ergebnisse der drei Zentralbanken.
Welche Zentralbanken werden in der empirischen Analyse untersucht?
Die empirische Analyse untersucht die quantitative Lockerung der Bank of Japan, des Federal Reserve Systems und der Europäischen Zentralbank.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Quantitative Lockerung, Geldpolitik, Deflation, Zentralbanken, unkonventionelle Geldpolitik, Bank of Japan, Federal Reserve System, Europäische Zentralbank, Finanzkrise, Wirksamkeit, empirische Analyse, Konjunkturpolitik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die Wirksamkeit von QE anhand von Fallstudien verschiedener Zentralbanken zu analysieren und die Anwendung von QE im Kontext spezifischer wirtschaftlicher Herausforderungen zu beleuchten.
- Quote paper
- Patrick Torsch (Author), 2012, Quantitative Lockerung als Instrument der Geldpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206597