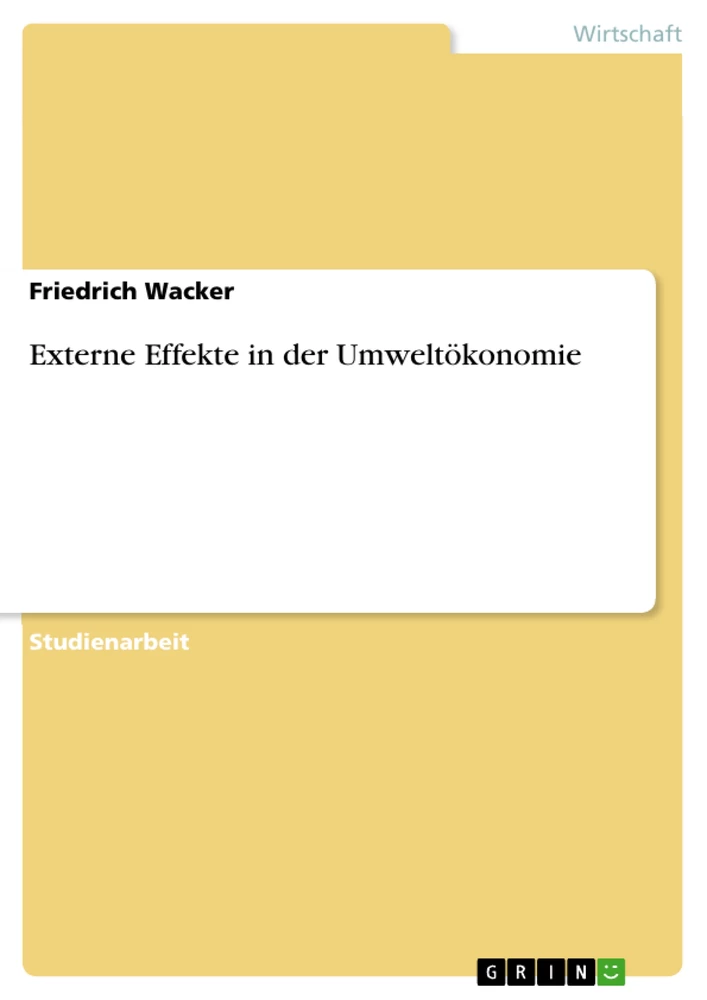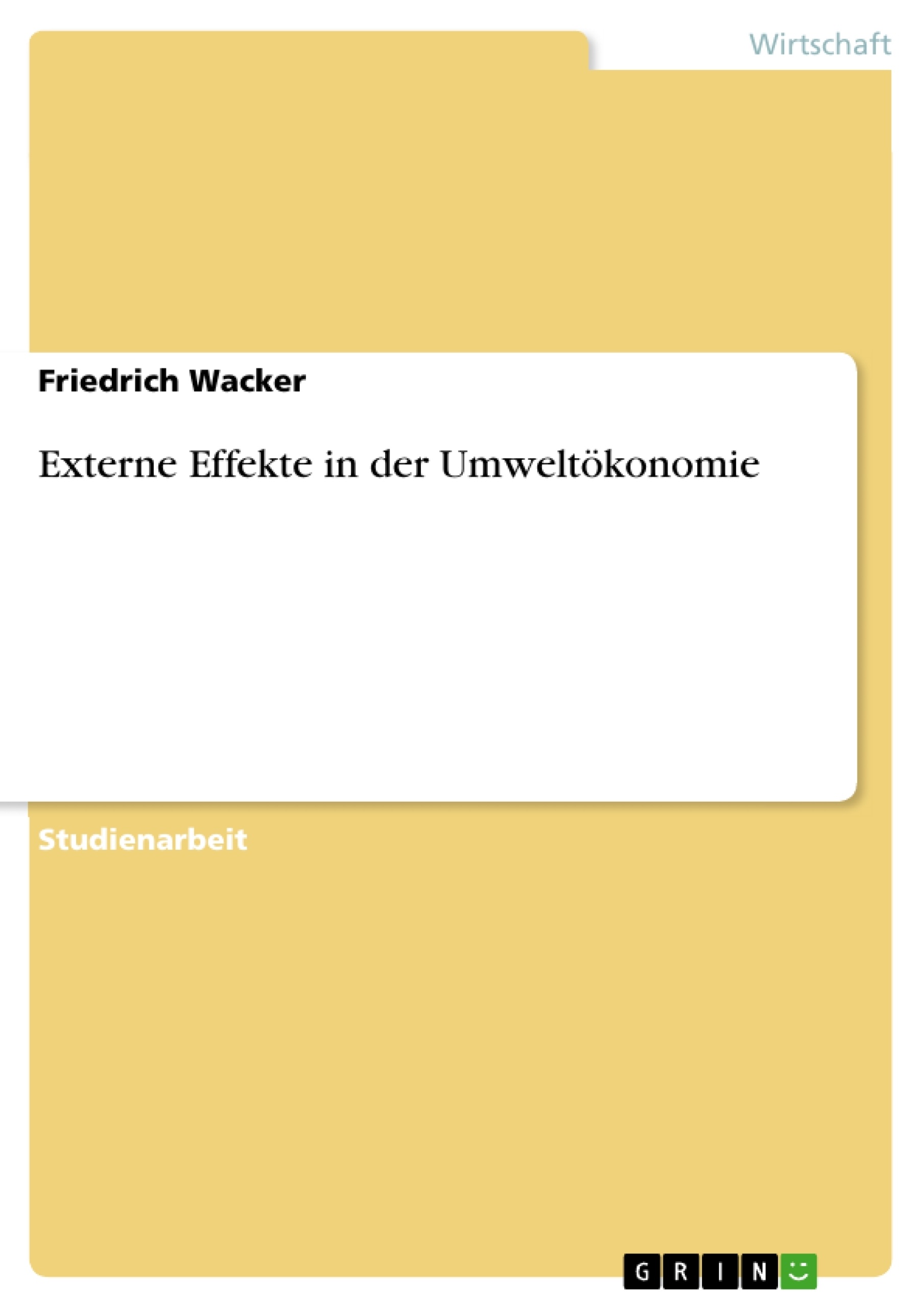In einer hoch technologischen Welt spielt das Thema Umwelt in den
letzten Jahren eine so bedeutende Rolle, wie nie zuvor. Es ist nicht damit
zu rechnen, dass sich die Relevanz dieser Thematik in nächster Zeit
reduzieren wird. Die mit der Umweltproblematik verbundenen Fragen und
deren Dringlichkeit zur Lösung, führten zum Aufkommen zahlreicher
umweltökonomischer Literatur, die versucht, Klarheit in die umfangreiche
Problematik zu bringen1.
Die Umweltökonomie befasst sich vornehmlich mit Lösungsmöglichkeiten
von Umweltproblemen. Hauptproblem ist hierbei, dass freie Güter wie Luft,
Wasser oder Natur als natürliche Ressourcen frei zugänglich für jeden, in
einer Form genutzt werden, dass sie nicht mehr als unbegrenzt
anzusehen sind.
Hier greift die Problematik der sogenannten externen Effekte ein. Die
vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit genau diesen externen
Effekten in der Umweltökonomie und deren Wirkung auf Unternehmen.
Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst externe Effekte in erster Art
betrachtet und definiert.
Anschließend werden Arten von externen Effekten vorgestellt und deren
Wirkungsweise aufgezeigt. Darauf aufbauend werden negative und
positive externe Effekte präsentiert und anhand von Graphiken
differenziert.
Besonders die Produktionsentscheidung von Unternehmen wird durch
Berücksichtigung externe Effekte stark verändert. In Kapitel drei wird
deswegen genau geprüft, inwieweit sich eine Produktionsentscheidung
ohne Berücksichtigung und mit Berücksichtigung externer Effekte, auf die
Kostenplanung des Unternehmens auswirkt.
In Kapitel vier wird dann ein passendes Internalisierungsinstrument
vorgestellt, dessen Wirkungsweise in Form einer Steuer dazu führt, dass
Unternehmen innovationsfreudiger am Markt agieren. Zu gleich führt
dieses Instrument aber auch zu einer Art von „Kostensperre“, besonders
im Bereich der Produktion, in der geringe Änderungen der
Deckungsbeiträge enorme Auswirkungen auf die Preiskalkulation haben.
Die Arbeit schließt mit einem zusammenfassenden Fazit in Kapitel 5.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs-und Tabellenverzeichnis
1. Einleitung (Umwelt und Ökonomie)
2. Externe Effekte, eine makroökonomische Betrachtung
2.1 Arten von externen Effekten
2.1.1 Positive externe Effekte
2.1.2 Negative externe Effekte
2.1.3 Wer ist Verursacher eines externen Effektes?
3. Externe Effekte als Bedeutung für die Produktionsentscheidung
3.1 Entscheidung ohne Bedeutung externer Effekte
3.2 Entscheidung mit Bedeutung externer Effekte
4. Beleuchtung eines Internalisierungsinstrumentes
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind externe Effekte in der Umweltökonomie?
Es sind Auswirkungen ökonomischer Aktivitäten auf unbeteiligte Dritte, die nicht im Marktpreis berücksichtigt werden (z. B. Luftverschmutzung durch eine Fabrik).
Was ist der Unterschied zwischen positiven und negativen externen Effekten?
Negative Effekte schaden Dritten (z.B. Lärm), während positive Effekte Nutzen stiften, für den der Verursacher keine Entschädigung erhält (z.B. Forschung).
Wie beeinflussen externe Effekte die Produktionsentscheidung?
Ohne Berücksichtigung externer Kosten produzieren Unternehmen oft mehr als gesellschaftlich optimal wäre, da sie die Umweltkosten nicht selbst tragen.
Was versteht man unter 'Internalisierung'?
Internalisierung bedeutet, externe Kosten durch Instrumente wie Steuern (Ökosteuer) oder Zertifikate in die Preiskalkulation der Verursacher einzubeziehen.
Warum werden Umweltressourcen wie Luft oft übernutzt?
Da sie als freie Güter gelten und keinen Marktpreis haben, besteht kein ökonomischer Anreiz, sparsam mit ihnen umzugehen.
- Quote paper
- Friedrich Wacker (Author), 2013, Externe Effekte in der Umweltökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206674