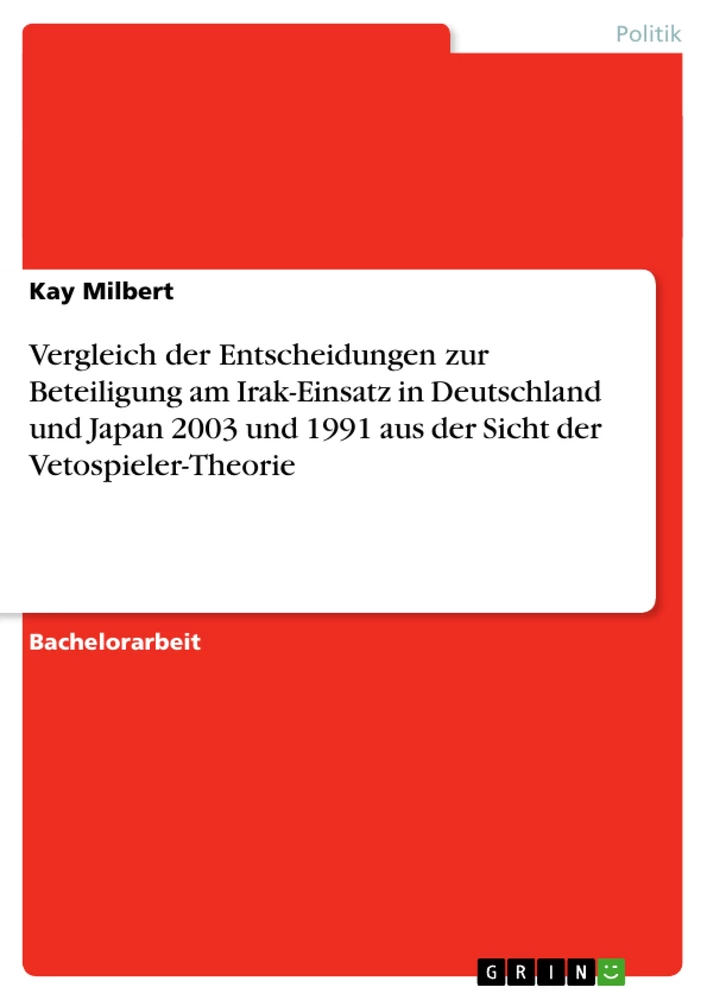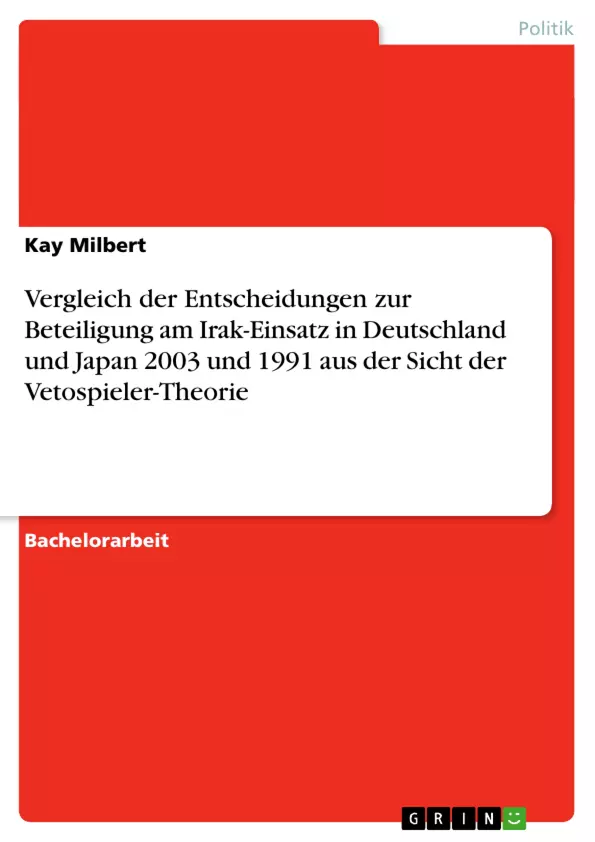Die Arbeit vergleicht das Zustandekommen der Beschlüsse zur Beteiligung am internationalen Einsatz im Irak 1991 und 2003 in Deutschland und Japan aus der Sicht des Vetospieler-Ansatzes.
Inhalt
Abkürzungen
1. Einführung
1.1. Arbeitsweise
1.2 Verwendete Literatur
2 Was ist der Vetospieler-Ansatz?
2.1 Welche Arten von Vetospielern gibt es?
2.2 Was ist das Winset?
2.3. Alternativen zum Vetospieler-Ansatz
3 Wie funktioniert Gesetzgebung in Deutschland und Japan?
3.1. Parlamentarisches System
3.2 Der Einfluss des Parteiensystems
3.3 Die Gesetzgebung in Deutschland
3.3.1 Bundestag und Bundesrat:
3.3.2 Verfassungsgericht
3.3.3 Koalitionen
3.3.4 Abgeordnete
3.3.5 Parteien:
3.3.6 Rollenverteilung Bundestag & Bundesregierung:
3.4 Gesetzgebung in Japan
3.4.1 Unterhaus & Oberhaus
3.4.2 Oberstes Gericht
3.4.3 Ministerialbürokratie
3.4.4 Parteien
3.4.5 Wahlsysteme
4 Die Beschlüsse in Deutschland und Japan zum Einsatz im Irak 1991
4.1 Historischer Hintergrund
4.2 Situation in Deutschland
4.2.1 Entwicklung des legislativen Status quo
4.3 Situation in Japan
4.3.1 Entwicklung des legislativen Status quo
5 Die Beschlüsse in Deutschland und Japan zum Einsatz im Irak 2003
5.1 Historischer Hintergrund
5.2 Situation in Deutschland
5.2.1. Entwicklung des legislativen Status quo
5.3 Situation Japan
5.3.1 Entwicklung des legislativen Status quo
6 Vergleiche der Fallbeispiele
6.1. Vergleich des legislativen Status quo 1991
6.2 Vergleich des legislativen Status quo 2003
6..3 Vergleich des legislativen Status quo in Japan 1991 und 2003
6.4 Vergleich des legislativen Status quo in Deutschland 1991 und 2003
6.5 Ergänzungen zum Vetospieler-Ansatz
Quellen
Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich der Entscheidungen im Hinblick auf die Einsätze der Streitkräfte am Irak-Krieg 1991 und 2003 in Japan und Deutschland. Die Fallbeispiele werden mit dem Vetospieler-Ansatz nach Tsebelis(2002) analysiert und miteinander verglichen.
Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Japan im Bezug auf die Geschichte nach dem zweiten Weltkrieg. Dies gilt auch für die Entwicklung der Sicherheitspolitik. Von 1949-1990 waren weder die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte (SDF) noch die Bundeswehr an bewaffneten Auslandseinsätzen beteiligt[1]. Auch beim politischen System gibt es Parallelen in Japan und Deutschland. Beide Staaten haben ein parlamentarisches System. Sowohl das Parlament in Japan als auch in Deutschland haben zwei Kammern.
1.1. Arbeitsweise
Auf Grund der Parallelen im Bezug auf das politische System und die Geschichte eignen sich beide Staaten zum Vergleich. Um einen besseren Überblick zu geben wird die Geschichte der Entwicklung der Streitkräfte in Japan und Deutschland in drei Phasen unterteilt:
1. Ostwest-Konfrontation (1945-1990)
2. Ende der Ostwest-Konfrontation(ab 1990)
3. Kampf gegen den internationalen Terrorismus(ab 1.11.2001)
Die Phasen dienen zur besseren Orientierung im Rahmen der Entwicklung des legislativen Status quo bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte(SDF). Die ersten beiden Phasen werden in einem Kapitel zusammen behandelt. Für Deutschland wird auf diese Abschnitte der Geschichte in dem Kapitel 4.2. Bezug genommen und in Japan im Kapitel 4.3. Auf die dritte Phase wird für Deutschland im Kapitel 5.2 und für Japan im Kapitel 5.3 eingegangen. Die Gründe für die internationalen Einsätze und der Verlauf der Einsätze werden für 1991 im Kapitel 4.1 und für 2003 im Kapitel 5.1 aufgezeigt.
Im Kapitel Zwei wird der Vetospieler-Ansatz vorgestellt. In Kapitel 3 wird in die Prozesse der Gesetzgebung von Deutschland und Japan eingeführt. Die Akteure, die an der Gesetzgebung beteiligt sind, werden aus der Sicht des Vetospieler-Ansatzes betrachtet. Die Kapitel Vier und Fünf stellen jeweils die historischen Hintergründe für die Kriege im Irak 1990 und 2003 vor. Außerdem werden dort die jeweiligen Situationen in Deutschland und Japan, die zu den Entscheidungen über den Einsatz im Irak geführt haben, aufgeführt. Am Schluss jedes Fallbeispiels wird es mit dem Vetospieler-Ansatz analysiert. In Kapitel Sechs werden die Situationen der verschiedenen Fallspiele im Bezug auf den legislativen Status quo, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede verglichen. Zum Schluss werden die Grenzen des Vetospieler - Ansatzes aufgezeigt.
1.2 Verwendete Literatur
Die Quellen stammen aus der Zentral-Bibliothek und den Fach-Bibliotheken der Universität Bochum und der Stadtbücherei in Soest. Berücksichtigt werden Monographien, Artikel aus Sammelbänden und Fachzeitschriften sowie Lehrbücher zur Geschichte der Sicherheitspolitik Japans und Deutschlands und zu den Entscheidungen über Auslandseinsätze in den beiden Ländern. Außerdem wurden ausgewählte wissenschaftliche Werke durch die Google-Büchersuche gefunden und verwendet..
2 Was ist der Vetospieler-Ansatz?
Der Vetospieler-Ansatz (auch Vetospieler-Theorie) nach Tsebelis(2002) beschäftigt sich mit der Stabilität des legislativen Status quo (Abromeit/Stoiber 2006: S. 62-81). Vetospieler sind Akteure, die das Beschließen von Gesetzen verhindern können.
2.1 Welche Arten von Vetospielern gibt es?
Der Vetospieler-Ansatz unterteilt die Akteure in folgende Arten:
-Die Vetospieler, die von der Verfassung vorgesehen sind, um Gesetzesentwürfe zu kontrollieren und zu blockieren. Diese werden institutionelle Vetospieler genannt(Abromeit/Stoiber 2006: S. 62-81).
-Akteure, die in bestimmten Situationen Gesetze blockieren können werden als situative Vetospieler bezeichnet.
Außerdem werden individuelle und kollektive Vetospieler unterschieden (Abromeit/Stoiber 2006: S. 62-81):
-Individuelle Veto-Spieler sind Einzelakteure, die den legislativen Status quo beeinflussen können(Tsebelis 2002: S. 19-24). Ein Beispiel: Wenn die Mehrheiten in einem Parlament knapp sind, dann ist in manchen Fällen eine Stimme entscheidend. Verweigert ein Abgeordneter der Regierungsparteien die Stimme, kann der Gesetzentwurf scheitern.
-Kollektive Vetospieler sind Gruppen, die den Beschluss eines Gesetzes verhindern oder beschließen können. Ein Beispiel sind die Parteien an der Regierung im Bundestag(Abromeit/Stoiber 2006: S. 62-81).
Neben den Vetospieler kennt der Vetospieler-Ansatz Agenda-Setzer als Akteure. Die Agenda-Setzer machen Vorschläge zu den Gesetzesentwürfen.
2.2 Was ist das Winset?
Das Winset ist der Bereich in den ein möglicher Kompromiss der unterschiedlichen Vetospieler liegt. Wenn es keine Möglichkeit für einen Kompromiss gibt, bleibt der legislative Status quo erhalten. Tsebelis(2002: S. 17) geht von folgenden Gedanken aus: Je weiter die Positionen der Vetospieler auseinander liegen, desto unwahrscheinlicher ist ein Kompromiss. Mit anderen Worten: Desto weiter die Positionen der unterschiedlichen Vetospieler von einander weg sind, so stabiler ist der politische Status quo. Nach der Vetospieler-Theorie versucht jeder Vetospieler ein Ergebnis zu erreichen, das möglichst nah an seiner Position liegt. Alle Beteiligten streben nach Tsebelis eine Verbesserung gegenüber den Status quo an. Der Raum, in den ein möglicher Kompromiss liegt, wird als Winset bezeichnet (Abromeit/Stoiber 2006: S. 64-65). Der Kompromiss darf höchstens gleich weit von der Idealposition des Vetospielers entfernt sein, wie der legislative Status quo. Wenn es keine Möglichkeit zum Kompromiss gibt, bleibt das Winset leer. Tsebelis stellt das Winset durch ein grafisches Modell dar. Die Positionen der Vetospieler werden durch Kreise repräsentiert. Im Mittelpunkt des jeweiligen Kreises befindet sich die Idealposition des Vetospielers. Das Winset wird durch die Schnittmenge der Kreise bestimmt(Tsebelis 2002: 19-ff)[2].
Agenda-Setzer werden die Akteure genannt, die Vorschläge zur Veränderung des legislativen Status quo machen. Nach Tsebelis kennen sie die Idealposition im Winset.
2.3. Alternativen zum Vetospieler-Ansatz
Auch auf Alternativen, die sich an den Veotpspieler-Ansatz orientieren, wird in dieser Arbeit zurückgegriffen. Ein Grund hierfür ist beispielsweise, dass Tsebelis bei allen Akteuren die Vertretung ihre idealen Position voraussetzt (Abromeit/Stoiber 2006: S. 68-69). Im politischen Alltag ist es aber fraglich, ob die Zusammenführung der Idealpositionen der Vetospieler immer zu den jeweiligen Beschlüssen führen; oder ob andere Gründe, wie zum Beispiel das Interesse an der Wiederwahl, auch eine Rolle spielen können. Ein weiteres Beispiel für eine ähnliche Situation ist die Verknüpfung der Entscheidung über den Einsatz in Afghanistan mit der Vertrauensfrage(5.2.). Auch hier stellt sich die Frage, ob die beteiligen Vetospieler ihre Idealposition eingebracht haben oder ob es wichtiger war weiter zu regieren.
3 Wie funktioniert Gesetzgebung in Deutschland und Japan?
Bevor auf Deutschland und Japan speziell eingegangen wird, sollen zwei Fachbegriffe des politischen Systems erklärt werden. Der Begriff des parlamentarischen System wird erläutert. Außerdem zeigt die Betrachtung zu den Parteiensystemen zusätzliche Einflussfaktoren auf die Zusammensetzung der Vetospieler. Diese Einflussfaktoren werden vom Vetospieler-Ansatz nicht berücksichtigt.
3.1. Parlamentarisches System
Das parlamentarisches System ist eine Herrschaftsform bei der das Volk durch von ihm gewählte Abgeordnete in der Volksvertretung, auch Parlament genannt, vertreten wird(Schreyer/Schwarzmeier 2005: S. 159). In Deutschland und in Japan wird die Gesetzgebung in großen Teilen von den beiden Kammern des Parlaments und der Regierung bestimmt. In Deutschland heißen die beiden Kammern des Parlaments Bundestag und Bundesrat, in Japan Oberhaus und Unterhaus(vgl. 3.3.1. und. 3.4.1). In beiden Ländern werden die Vorlagen für die Gesetze in den Ausschüssen des Parlaments und im Regierungskabinett entworfen, bevor sie den Parlament zur Entscheidung vorgelegt werden(ebd.).
3.2 Der Einfluss des Parteiensystems
Das Parteiensystem gehört zu den Faktoren, die auf den politischen Status quo Auswirkungen haben können. In dem Zusammenhang ist es wichtig, wie viele Parteien notwendig sind, um eine regierungsfähige Regierung zu bilden. Außerdem spielt es eine Rolle, wie weit die Parteien ideologisch auseinander liegen. Um eine Orientierung im Bezug auf die Anzahl der Parteien und ihre ideologische Entfernung zueinander zu haben, richtet sich diese Arbeit nach Sartori. Sartori untersucht die Fragmentierung und die Polarisierung der Parteiensysteme. Die Fragmentierung entspricht der Anzahl der Parteien. Die Polarisierung entspricht ihrer ideologischen Entfernung zu einander. Die Unterteilung der Parteiensysteme nach Sartori beginnt beim Einparteiensystem, in dem nur eine Partei allein regiert. In diesem System gibt es keine Polarisierung und keine Fragmentierung. Sartoris Unterteilung der Parteiensysteme endet beim atomtisierten Parteien System. In diesem System regieren sehr viele Parteien, die ideologische sehr weit von einander entfernt sind. Wichtig für diese Arbeit ist nicht, welches Parteisystem Japan und Deutschland nach Sartori haben, sondern wie sich die Fragmentierung und Polarisierung auf den legislativen Status quo auswirken. Des Weiteren sollte berücksichtigt werden, dass Parteien oft bestimmte Interessengruppen vertreten. Die Interessengruppen haben so einen indirekten Einfluss auf die Politik. Allerdings werden sie vom Vetospieler-Ansatz nicht berücksichtigt.[3]
3.3 Die Gesetzgebung in Deutschland
3.3.1 Bundestag und Bundesrat:
Die beiden Kammern haben gemeinsam, dass sie in den meisten Fällen nur Gesetzesvorlagen, die aus der Regierung kommen, annehmen oder ablehnen dürfen. Der größte Teil der Vorlagen dürfen von dem deutschen Parlament nicht ergänzt oder geändert werden[4] (Gareis 2005: S. 35-41). Mit anderen Worten: Im Normalfall arbeitet allein die Regierung die Einzelheiten eines Gesetzes aus, und das Parlament entscheidet nur, ob der Gesetzentwurf beschlossen wird. In Deutschland werden die meisten Gesetze im Bundestag verabschiedet. Falls Gesetzesinitiativen in dieser Kammer abgelehnt werden, kommen sie erst gar nicht in den Bundesrat. Der Bundestag hat im Bezug auf die Außen – und Sicherheitspolitik besondere Befugnisse. Auf diese Befugnisse wird in Kapitel 3.3.6 eingegangen. Dort wird die Verteilung von außen– und sicherheitspolitischen Kompetenzen zwischen Regierung und Bundestag vorgestellt. Der Bundesrat als Vertretung der Bundesländer hat eine Kontrollfunktion bei der Gesetzgebung. Bei der Kontrollfunktion des Bundesrates muss zwischen Zustimmungsgesetzen und Einspruchsgesetzen unterschieden werden. Zustimmungsgesetze sind Gesetze, bei denen der Bundesrat zustimmen muss(Schubert/Klein 2006: S. 336). Bei Einspruchsgesetzen ist die Zustimmung des Bundesrat nicht erforderlich(Schubert/Klein 2006: S. 86). Gesetze, die die Verwaltungshoheit[5] der Länder betreffen oder ihre Finanzen, sind Zustimmungsgesetze. Bei ihnen ist die Zustimmung der Bundesländer notwendig. Auch Änderungen der Verfassung sind Zustimmungsgesetze. Neben den Zustimmungsgesetzen gibt es auch Gesetzesvorlagen, bei denen der Bundesrat nur ein Einspruchsrecht hat. Außerdem hat der Bundesrat ein Recht zur eigenen Gesetzesinitiative.
Wie sieht der Vetospieler-Ansatz das Zusammenspiel der Akteure Regierung , Bundestag und Bundesrat? Theoretisch können der Bundestag und der Bundesrat Gesetzesentwürfe aufhalten. Sie sind also potenzielle legislative Vetospieler. In der Praxis hat meistens die Regierungspartei oder die Regierungskoalition die Mehrheit im Bundestag. Deshalb werden nur in sehr wenigen Fällen Gesetze der Regierung vom Bundestag blockiert. Die eigentlichen Vetospieler, also die Akteure, die über den legislativen Status quo entscheiden, sitzen meistens im Kabinett der Regierung. Die hier aufgeführten Fallbeispiele sind Indizien dafür[6]. Da die Auslandseinsätze nicht zu den Kompetenzen der Länder gehören, spielt der Bundesrat für den legislativen Statut quo im Bezug auf die Entscheidung über die Einsätze keine zwingende Rolle.
[...]
[1] Beide Staaten werden wegen ihrer militärischen Zurückhaltung und ihrer Bedeutung für die Weltwirtschaft als Zivilmacht bezeichnet. Mit dem Beginn der Beteiligung an bewaffneten Auslandseinsätzen begann die Diskussion, ob die Rolle Deutschlands und Japans als Zivilmacht zu Ende sei.
[2] In der Praxis ist es sehr schwer die Idealposition des Vetospielers zu bestimmen. Deshalb wird in dieser Arbeit auf grafische Modelle verzichtet. Mehr zu der Frage in Kapitel 2.2. und 6.2.
[3] Die Ausführungen des Kapitels folgen Nohlen (1989: S. 48-54)
[4] Diese Regel gilt auch für völkerrechtliche Verträge oder für die Beteiligung der Bundeswehr an internationalen Militärmissionen.
[5] Dazu gehören auch völkerrechtliche Verträge wenn sie die Interessen der Länder berühren(Gareis 2005: S39)
[6] Dies gilt auch für Japan.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Vetospieler-Theorie nach Tsebelis?
Sie analysiert die Stabilität des politischen Status quo basierend auf der Anzahl und den Positionen der Akteure (Vetospieler), die einer Gesetzesänderung zustimmen müssen.
Wer sind institutionelle Vetospieler?
Akteure, die durch die Verfassung festgelegt sind, wie zum Beispiel der Bundesrat in Deutschland oder die zweite Kammer in Japan.
Wie unterschieden sich die Entscheidungen zum Irak-Krieg 1991 und 2003?
Die Arbeit vergleicht, wie die politischen Systeme in Deutschland und Japan unter verschiedenen Mehrheitsverhältnissen und historischen Bedingungen über Militäreinsätze entschieden haben.
Was versteht man unter dem „Winset“?
Das Winset ist der Bereich möglicher Kompromisse zwischen den Vetospielern. Ist das Winset leer, bleibt der aktuelle Zustand (Status quo) unverändert.
Welche Parallelen gibt es zwischen Deutschland und Japan nach 1945?
Beide Länder entwickelten nach dem Zweiten Weltkrieg eine stark zurückhaltende Sicherheitspolitik und haben heute vergleichbare parlamentarische Zweikammersysteme.
- Arbeit zitieren
- Kay Milbert (Autor:in), 2012, Vergleich der Entscheidungen zur Beteiligung am Irak-Einsatz in Deutschland und Japan 2003 und 1991 aus der Sicht der Vetospieler-Theorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206773