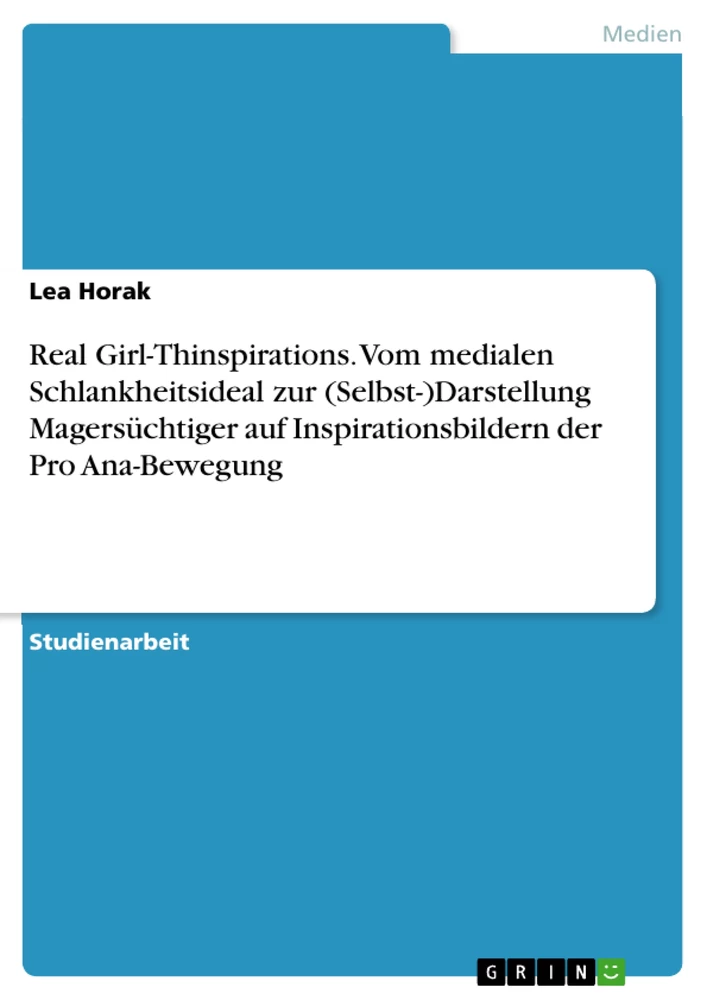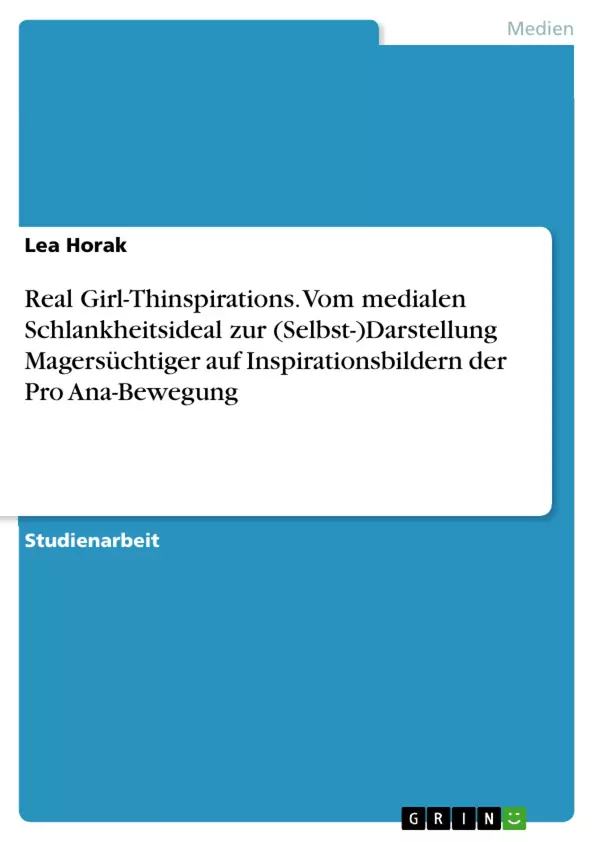In der vorliegenden Arbeit soll neben der Darstellung unterschiedlicher Bildkategorien verstärkt auf die Fotos von Real Girls eingegangen werden. Anhand dieser wird im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse der Frage nachgegangen, wie die (Selbst-)Darstellung magersüchtiger Mädchen und Frauen auf den Fotos der Pro Ana-Bewegung ist.
Inhaltsverzeichnis
- Themenstellung
- Theoretischer Hintergrund und Kontext der Thinspirations
- Körperbild, Körperunzufriedenheit und der Einfluss der Medien
- Die Medien als 'Schlankheitsfalle'?
- Hintergrund und Einflussfaktoren der Magersucht
- Pro Ana - Magersucht als Lifestyle
- Überblick über Pro Ana-Homepages
- Formale und inhaltliche Analyse der Thinspirations
- Stars, Models und Real Girls
- Darstellungen schlanker bis magerer Personen
- Fokussierung auf unterschiedliche Körperregionen
- Weitere Trends der Thinspirations
- Zwischenfazit
- Die (Selbst-)Darstellung Magersüchtiger auf Thinspirations
- Vorgehensweise bei der Fotoanalyse
- Kontextuelle Einordnung der Real Girl-Fotos
- Analyse der Selbstdarstellung Magersüchtiger auf Fotos
- Ganzkörperaufnahmen
- Darstellungen einzelner Körperteile
- Künstlerisch-emotionale Bilder
- Fazit zu den Darstellungen von Real Girls
- Abschließende Bewertung: Pro Ana als extreme Form des 'Schlankheitswahnes'
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von "Thinspirations" innerhalb der Pro Ana-Bewegung. Ziel ist es, die (Selbst-)Darstellung magersüchtiger Mädchen und Frauen auf Fotos dieser Bewegung zu analysieren und in den Kontext der medialen Schlankheitsideale einzuordnen.
- Der Einfluss der Medien auf das Körperbild und die Körperwahrnehmung
- Die Entstehung und Verbreitung von Pro Ana-Bewegungen im Internet
- Die Funktion von "Thinspirations" als Inspirationsquelle und Motivationsinstrument für Magersüchtige
- Die Analyse der (Selbst-)Darstellung magersüchtiger Frauen auf "Real Girl"-Fotos
- Die Verbindung von medialer Schlankheitsidealen und der Pro Ana-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik der medialen Schlankheitsideale und deren Einfluss auf das Körperbild von Frauen ein. Kapitel zwei beleuchtet die Entstehung und Bedeutung der Pro Ana-Bewegung und erklärt die Rolle von "Thinspirations". Das dritte Kapitel fokussiert sich auf die Analyse von "Real Girl"-Fotos, die von Magersüchtigen selbst erstellt werden.
Schlüsselwörter
Pro Ana, Thinspirations, Magersucht, Körperbild, Körperunzufriedenheit, Medien, Selbstbild, Selbstdarstellung, Qualitative Inhaltsanalyse, Fotoanalyse.
- Quote paper
- Lea Horak (Author), 2011, Real Girl-Thinspirations. Vom medialen Schlankheitsideal zur (Selbst-)Darstellung Magersüchtiger auf Inspirationsbildern der Pro Ana-Bewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207010