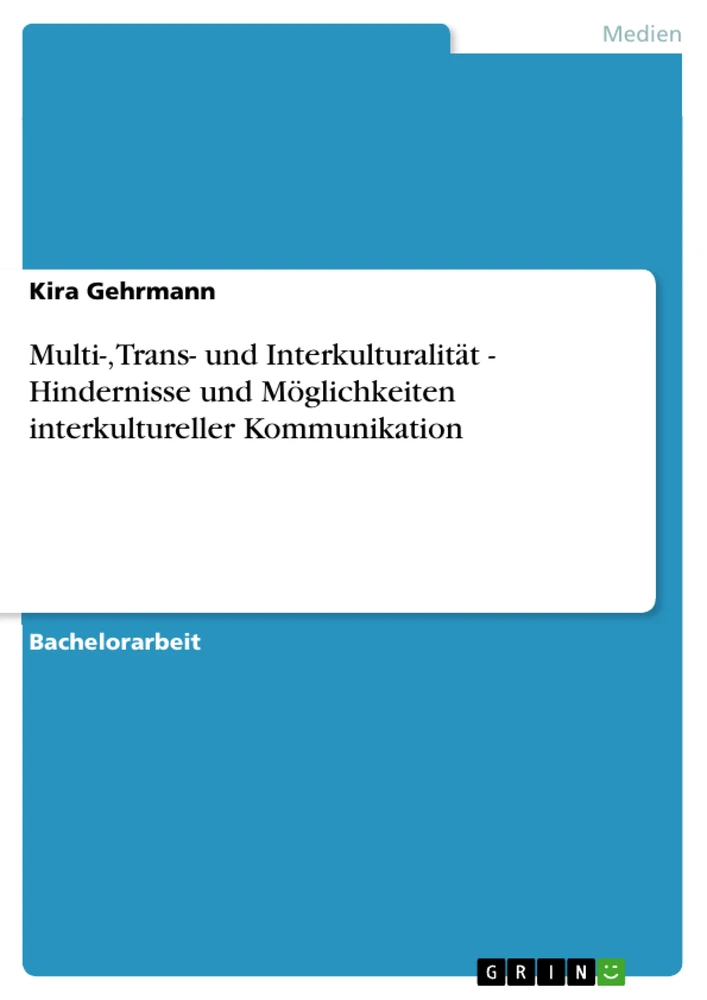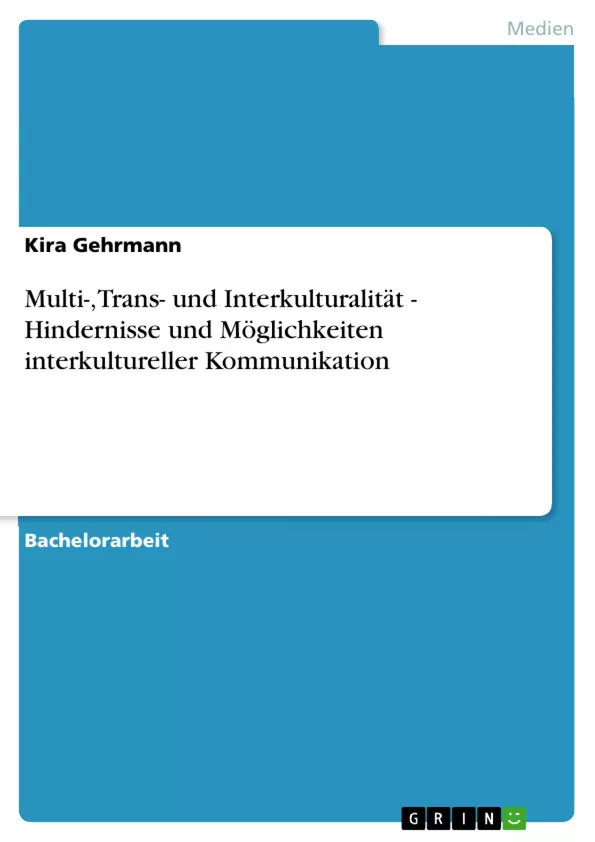Wie der Titel ›Multi-, Trans- und Interkulturalität. Ein kulturwissenschaftlicher Vergleich‹ bereits erahnen lässt, geht es im Folgenden um die Beschreibung sowie den analytischen Vergleich der drei soeben genannten Modelle der Multi-, Trans- und Interkulturalität. Gehen die Vorstellungen von Interaktion der Kulturen bei den Modellen auseinander, so sind sie dennoch alle Ergebnisse der Entwicklung der pluralistischen Sichtweise von Kultur.
Alle versuchen über die Beseitigung des Kulturbegriffs im Singular hinaus Kulturen jenseits des Verständnisses von ›dem Eigenen und dem Anderen‹ zu begreifen. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welchen Prämissen die gegensätzlichen Modelle folgen und zu welchen Ergebnissen sie an Hand dieser gelangen. Durch die Analyse der Multi-, Trans- und Interkulturalität lassen sich deren Konvergenzen sowie Divergenzen bestimmen. Ziel der Arbeit ist es letztendlich jenen Ansatz zu finden, welcher am Ehesten zur Realisierung interkultureller Kommunikation beitragen kann.
Zum besseren Verständnis dieser Arbeit sei hier kurz der Begriff und vor allem die Perspektive der ›Kulturwissenschaft‹ erläutert.
Mit dem Ziel einer Internationalisierung sowie Modernisierung der Geisteswissenschaften entstand das Konzept der Kulturwissenschaften. Nach dem Soziologen Max Weber (1864-1920) sind die Kulturwissenschaften ein Komplex aller wissenschaftlichen Disziplinen, welche sich mit den Handlungen des menschlichen Lebens unter Berücksichtigung ihrer Kulturbedeutung beschäftigen. Seit Mitte der 80er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts existiert in Deutschland neben dem disziplinübergreifenden Begriff der Kulturwissenschaften auch die ›Kulturwissenschaft‹ als Einzelfach mit inter-, bzw. transdisziplinärer Ausrichtung. Für die junge Disziplin existieren aufgrund ihrer Vielseitigkeit eine unüberschaubare Menge an Definitionen und Erklärungsversuchen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Moderne Kulturtheorien in Übersicht
- 1. 1. Eine vergleichende Begriffsbestimmung.
- 1. 1. 1. Normative Orientierung
- 1. 1. 2. Totalitätsorientierung.
- 1. 1. 3. Differenzierungstheoretische Orientierung..
- 1. 1. 4. Bedeutungs- und Wissensorientierung...
- 1.2. Konzeptionelle Divergenzen und Konvergenzen
- 2. Modelle zur Erklärung kultureller Beziehungen in einer globalisierten Welt
- 2. 1. Herausforderungen der Multikulturalität.
- 2. 2. 1. Dimensionen des Kulturpluralismus
- 2. 2. 2. Politik der Anerkennung....
- 2. 2. 3. Multikulturalität als Identitätsbegrenzung.
- 2. 2. Perspektivische Probleme der Transkulturalität
- 2. 2. 1. Der Mensch als >kultureller Mischling<.
- 2. 2. 2. Interdisziplinarität der Transkulturalität anhand zweier Beispiele.
- 2. 2. 2. 1. Transkulturelle Pädagogik.............
- 2. 2. 2. 2. Transkulturelle Kommunikation
- 2. 2. 3. Die Rolle der unüberbrückbaren Differenzen...
- 2. 3. Strukturelle Dimensionen der Interkulturalität
- 2. 3. 1. Entstehung eines Faches...........
- 2. 3. 2. Philosophischer Zugang der Interkulturalität
- 3. Praktische Aporien der interkulturellen Kommunikation..
- 3. 1. Sprachen als Mittel zur Kommunikation.
- 3. 1. 1. Nonverbale Aspekte des interkulturellen Dialogs .
- 3. 1. 2. Der Ort der Überlappung.....
- 3. 2. Zentrale Korrelatbegriffe...........
- 3. 2. 1. Das Eigene und das Andere
- 3. 2. 2. Interkulturelle Kompetenz..………………………..\n
- 3. 2. 3. Interkulturelle Semantik..\n
- 3. 2. 4. Interkulturelle Hermeneutik..\n
- 3. 2. 5. Interkulturelle Komparatistik.\n
- 3. 2. 6. Interkulturelle Toleranz\n
- 3. 2. 7. Interkulturelle Ethik...\n
- 13. 3. Praktische Hindernisse der interkulturen Kommunikation...\n
- 3. 3. 1. Erstes Fallbeispiel: Das Islambild.\n
- 3. 3. 2. Zweites Fallbeispiel: Absloutheits- und Wahrheitsanspruch.\n
- 3. 3. 3. Drittes Fallbeispiel: Vorurteile und Massenmedien....\n
- 3. 4. Möglichkeiten der interkulturellen Kommunikation.......\n
- 3. 4. 1. Fallbeispiel: Bildung.\n
- 3. 4. 2. Deutsche Schulbücher im Spiegelbild der Kritik.\n
- Vergleich verschiedener Kulturbegriffe in modernen Theorien
- Analyse der Modelle der Multi-, Trans- und Interkulturalität
- Untersuchung der Herausforderungen des Kulturpluralismus
- Bedeutung der Interdisziplinarität für die Transkulturalität
- Praktische Aporien und Möglichkeiten der interkulturellen Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Modellen der Multi-, Trans- und Interkulturalität, analysiert ihre Prämissen und Ergebnisse und untersucht, welcher Ansatz am besten zur Realisierung interkultureller Kommunikation beitragen kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert vier moderne Kulturbegriffe: normativ-orientiert, totalitätsorientiert, differenzierungsorientiert und bedeutungs- und wissensorieniert. Es untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Konzepte.
Das zweite Kapitel erläutert drei Modelle zur Erklärung kultureller Beziehungen: Multi-, Trans- und Interkulturalität. Es diskutiert die unterschiedlichen Kulturbegriffe, die diesen Modellen zugrunde liegen, und analysiert die Ansätze von Horace Kallen, Charles Taylor und Wolfgang Welsch.
Das dritte Kapitel thematisiert praktische Aporien der interkulturellen Kommunikation. Es betrachtet Sprache als Mittel zur Kommunikation, verschiedene Kommunikationsformen und den Ort der Überlappung. Es stellt zentrale Korrelatbegriffe wie das Eigene und das Andere, interkulturelle Kompetenz und interkulturelle Semantik vor und analysiert Fallbeispiele wie das Islambild in Deutschland und den Absloutheits- und Wahrheitsanspruch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Kulturbegriffe, Multikulturalität, Transkulturalität, Interkulturalität, Kommunikation, Sprache, Interdisziplinarität, Kulturpluralismus und interkulturelle Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Multi-, Trans- und Interkulturalität?
Multikulturalität betont das Nebeneinander, Interkulturalität den Dialog zwischen Kulturen und Transkulturalität die gegenseitige Durchdringung und Aufhebung starrer Grenzen.
Was versteht Wolfgang Welsch unter Transkulturalität?
Welsch sieht Kulturen nicht mehr als Inseln, sondern als vernetzt und vermischt, wobei der Mensch zunehmend ein „kultureller Mischling“ wird.
Was ist das „Eigene“ und das „Andere“?
Es sind zentrale Korrelatbegriffe der interkulturellen Kommunikation, die beschreiben, wie wir unsere Identität durch Abgrenzung oder Öffnung definieren.
Welche Hindernisse gibt es bei interkultureller Kommunikation?
Dazu zählen Vorurteile, Sprachbarrieren, nonverbale Missverständnisse und Absolutheitsansprüche (z.B. religiöser Art).
Wie kann Bildung die interkulturelle Kommunikation fördern?
Durch interkulturelle Pädagogik und die kritische Analyse von Schulbüchern kann ein besseres Verständnis für kulturelle Vielfalt geschaffen werden.
- Arbeit zitieren
- Kira Gehrmann (Autor:in), 2012, Multi-, Trans- und Interkulturalität - Hindernisse und Möglichkeiten interkultureller Kommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207011