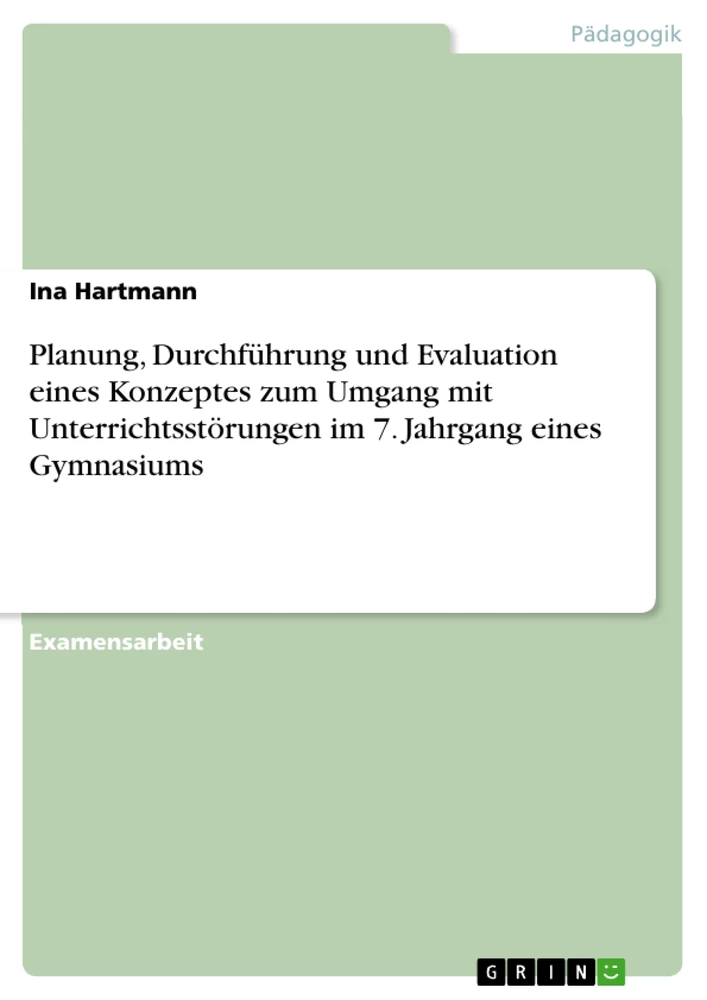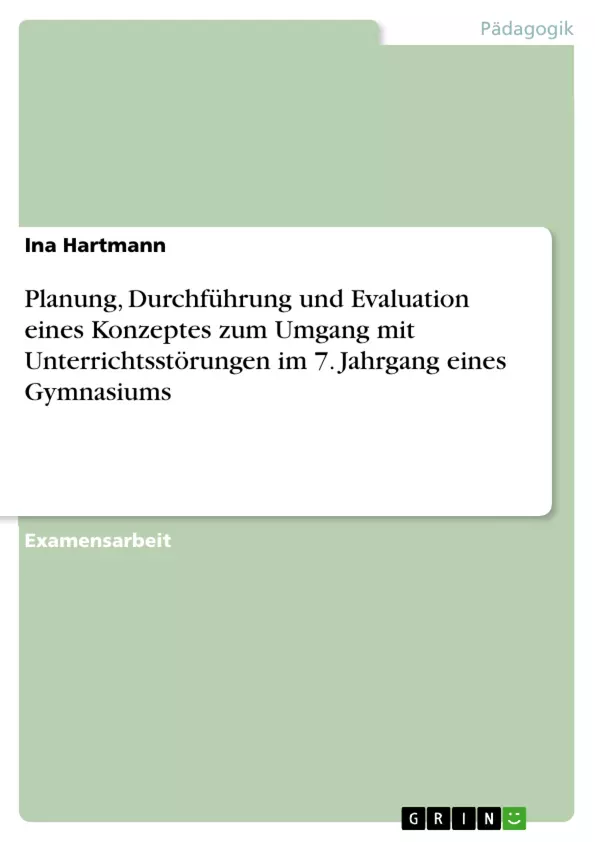„Die Jugend liebt heute den Luxus - verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und plaudert, wenn sie arbeiten sollte.“ (Sokrates)
Sokrates Zitat, welches ich oben angefügt habe, stammt bereits aus der Zeit um 400 vor Christus und ist damit bereits fast 2500 Jahre alt. Der griechische Philosoph stellte bereits damals fest, was noch heute, besonders in den Schulen, zu beobachten ist: ein Fehlverhalten von Jugendlichen gegenüber Autoritäten.
Autoritäten, das sind auch wir, die Lehrerinnen und Lehrer, die sich täglich mit der Jugend von heute beschäftigen und dies auch gerne tun. Nichts desto trotz kommt es ab und zu auch zu ungewollten Situationen, mit denen wir Lehrerinnen und Lehrer dann umgehen müssen – den Unterrichtsstörungen.
Was aber sind eigentlich Unterrichtsstörungen? Hier gibt es nun eine ganze Vielzahl an Definitionen, von denen ich mir eine herausgesucht habe, die für mich am Gelungensten ist: „Unterrichtsstörungen sind Handlungen, welche die von einer Lehrkraft beabsichtigte Unterrichtsdurchführung behindern, und zwar (a) indem sie andere Personen, nämlich die Lehrkraft oder die Mitschüler, in ihrer aufgabenbezogenen Aktivität beeinträchtigen, und/oder (b) indem die die eigene aufgabenbezogene Aufmerksamkeit und Mitarbeit beeinträchtigen.“
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I Entfaltung des Themas
- a) Situationsbezug und Problemgehalt des Themas
- b) Folgen von Unterrichtsstörungen
- c) Aktuelle Diskussionen zum Thema
- d) Zielvorstellung und Erkenntnisgewinn
- e) Kriterien zur Evaluation
- f) Eingrenzung des Themas
- II Bearbeitung des Themas
- Der Fragebogen für die SchülerInnen und LehrerInnen der Klasse 7
- Die Ergebnisse der Befragung
- a) Die Auswertung der SchülerInnen-Fragebögen
- Fazit der SuS- Befragung
- b) Die Auswertung der LehrerInnen-Fragebögen
- Fazit der Lehrer – Befragung
- III Folgerungen für den eigenen Unterricht
- Disziplin als Grundlage für störungsfreien Unterricht
- Lehrerverhalten
- Regeln und Organisation
- Prävention durch breite Aktivierung
- Prävention durch Unterrichtsfluss
- Prävention durch Präsenz- und Stoppsignale
- a) Nonverbale Signale
- b) Verbale Signale
- Fazit der Präventionsmöglichkeiten
- IV Die praktische Erprobung der aufgeführten Präventionsmaßnahmen
- a) Die ersten zwei Wochen im Politikunterricht der Klasse 7
- b) Die folgenden zwei Wochen im Politikunterricht der Klasse 7
- c) Fazit meines „Selbstversuches“
- V Abschlussbemerkung
- VI Mögliche Weiterentwicklung
- VII Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Unterrichtsstörungen in der 7. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums und zielt darauf ab, ein Konzept zum Umgang mit Unterrichtsstörungen zu entwickeln und zu evaluieren. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, die den eigenen Unterricht verbessern und Unterrichtsstörungen zukünftig reduzieren können. Das Konzept soll als Basis für andere Lehrkräfte dienen, um einen möglichst störungsfreien Unterricht zu gestalten.
- Die Folgen von Unterrichtsstörungen für Lehrkräfte und Unterricht
- Aktuelle Diskussionen und Konzepte zum Umgang mit Unterrichtsstörungen
- Entwicklung eines Konzeptes zur Prävention von Unterrichtsstörungen
- Praktische Erprobung des Konzeptes in der 7. Klasse im Politikunterricht
- Evaluation des Konzeptes und Gewinnung von Erkenntnissen für den eigenen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I erläutert den Situationsbezug und den Problemgehalt des Themas Unterrichtsstörungen in der 7. Jahrgangsstufe, insbesondere die Folgen von Unterrichtsstörungen für die Lehrkraft und den Unterrichtserfolg. Es wird eine aktuelle Diskussion über unterschiedliche Konzepte und Ansätze zum Umgang mit Unterrichtsstörungen beleuchtet. Darüber hinaus werden die Zielvorstellung und der Erkenntnisgewinn der Arbeit dargestellt, sowie die Kriterien zur Evaluation des entwickelten Konzeptes. Abschließend erfolgt die Eingrenzung des Themas auf die Suche nach den Eigenschaften eines guten Lehrers, der störungsfreien Unterricht ermöglicht.
Kapitel II beschreibt die Ergebnisse einer Befragung von Schülerinnen und Schülern (SuS) und Lehrkräften der Klasse 7. Die Auswertung der Fragebögen zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf Unterrichtsstörungen und liefert wichtige Informationen für die Entwicklung des Konzeptes.
Kapitel III behandelt die Folgerungen, die sich aus den Befragungsergebnissen für den eigenen Unterricht ziehen lassen. Es werden verschiedene Präventionsmöglichkeiten wie Disziplin, Lehrerverhalten, Regeln und Organisation, breite Aktivierung, Unterrichtsfluss sowie Präsenz- und Stoppsignale (verbal und nonverbal) diskutiert.
Kapitel IV widmet sich der praktischen Erprobung des entwickelten Präventionskonzepts im Politikunterricht der Klasse 7 über einen Zeitraum von vier Wochen. Es werden die Erfahrungen und Beobachtungen während der ersten und zweiten Wochen der praktischen Umsetzung des Konzeptes beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Unterrichtsstörungen, Prävention, Lehrerverhalten, Regeln und Organisation, Aktivierung, Unterrichtsfluss, Präsenz- und Stoppsignale, Evaluation und Unterrichtsqualität in der 7. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Unterrichtsstörungen?
Unterrichtsstörungen sind Handlungen, die die beabsichtigte Durchführung des Unterrichts behindern, indem sie Mitschüler oder Lehrkräfte in ihrer Aktivität beeinträchtigen.
Wie können Lehrer Störungen präventiv begegnen?
Durch einen guten Unterrichtsfluss, breite Aktivierung der Schüler, klare Regeln und den Einsatz von Präsenzsignalen (verbal und nonverbal).
Welche Rolle spielen nonverbale Signale?
Stoppsignale wie Blickkontakt oder Mimik können Störungen oft beenden, ohne den Unterrichtsfluss durch lautes Ermahnen zu unterbrechen.
Was ergab die Befragung von Schülern der 7. Klasse?
Die Arbeit wertet Fragebögen aus, die zeigen, welche Eigenschaften eines Lehrers aus Schülersicht für einen störungsfreien Unterricht entscheidend sind.
Warum sind klare Regeln und Organisation wichtig?
Sie schaffen einen verlässlichen Rahmen, der Schülern Sicherheit gibt und die Wahrscheinlichkeit von Fehlverhalten gegenüber Autoritäten senkt.
- Quote paper
- Ina Hartmann (Author), 2012, Planung, Durchführung und Evaluation eines Konzeptes zum Umgang mit Unterrichtsstörungen im 7. Jahrgang eines Gymnasiums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207094