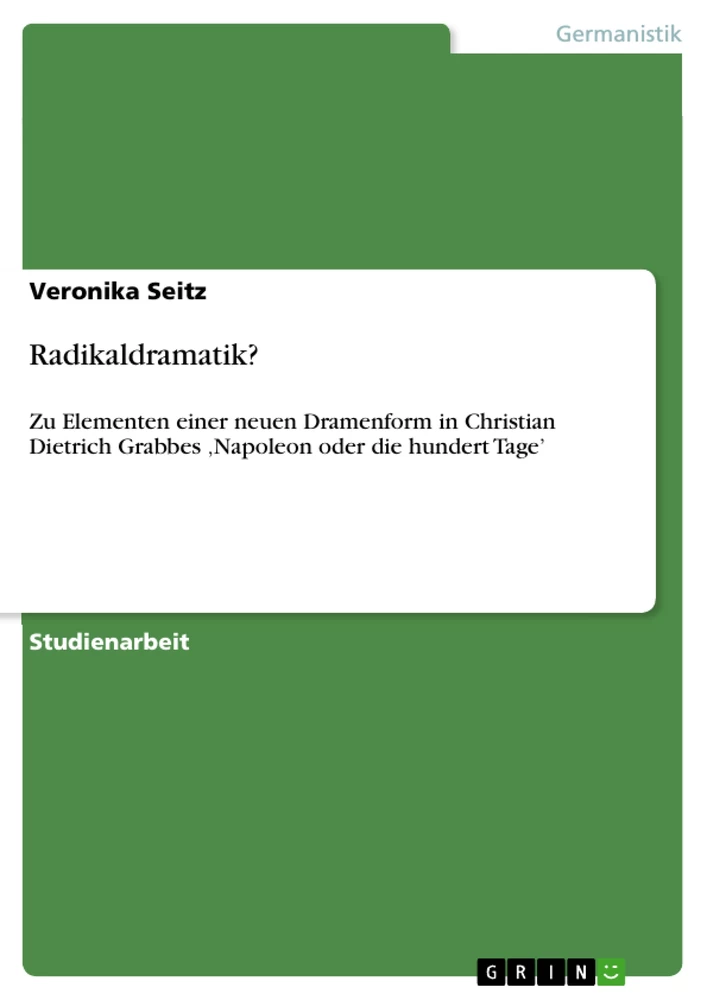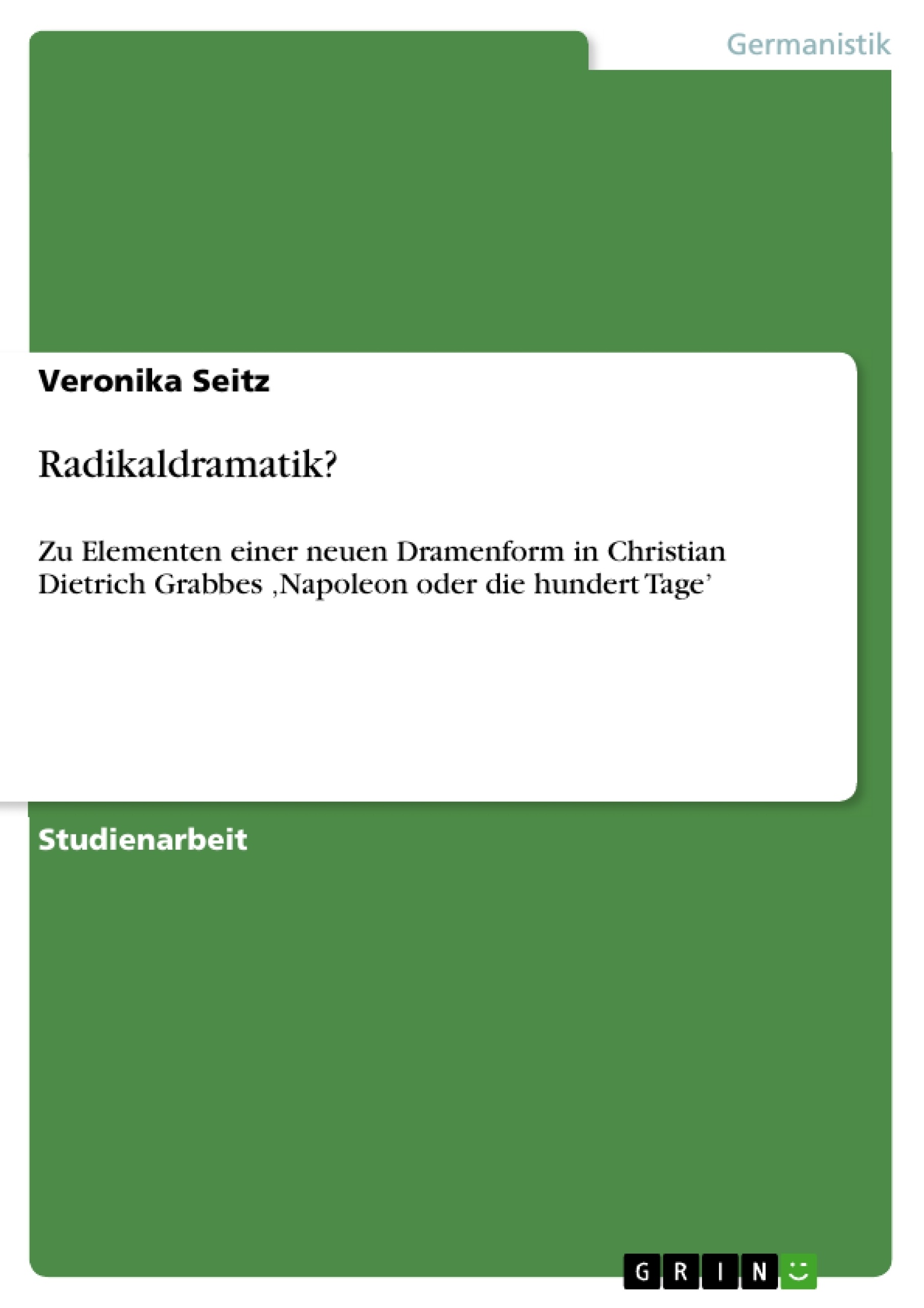Anfang des 19. Jahrhunderts herrschten im Drama rigide Gattungsbestimmungen. Bereits die deutschen Romantiker wollten diese Grenzen zwischen den Gattungen aufbrechen und die literarischen Formen durchlässiger machen. „[Es kam beim Medium Bühne] einzig und allein im deutschsprachigen Bereich zu einer radikalen Vor-Avantgarde. Allerdings, es war nur eine im Konjunktiv. Soweit sie literarisch war, wie bei Kleist und Büchner und Grabbe, blieb sie den Zeitgenossen fast oder ganz unbekannt.“ Bei diesen aber avancierte das Drama zu einem Experimentierfeld. Oft um den Preis der Unspielbarkeit, wie die gelesenen Geschichtsdramen von Goethe oder Kleist zeigen. Dennoch war die geschlossene Dramenform zu Grabbes Zeiten im Großen und Ganzen noch gebräuchlich. Grabbe jedoch will, so Volker Klotz, „(h)inweg von den planierten Bahnen einer szenisch und rhetorisch ausgewogenen Bühnenpoetik. Hinweg vom Tun und mehr noch vom Lassen der gestandenen Dramatiker seiner Zeit, die letztlich noch immer den klassizistischen Mustern nachhängen […]“ Er widersetzt sich der herkömmlich und für verbindlich erachteten Standarddramatik des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts und entwickelt neue dramatische Ansätze. Elemente dieser „Radikaldramatik“ werden im Folgenden näher herausgestellt.
Anhand der Kategorien Komposition, Handlung, Zeit, Raum, der Zeichnung der Figuren und Verwendung der Sprache wird der Fragestellung nachgegangen, inwiefern man bei Christian Dietrich Grabbes Drama Napoleon oder die hundert Tage von ‚Radikaldramatik’ sprechen kann, in Bezugnahme auf die damals gängige Praxis der Dramatiker und der geschlossenen Dramenform. Der anschließende Abschnitt beleuchtet Grabbes Absicht, die ihn dazu veranlasste, diese Form des Dramas zu wählen.
Inhaltsverzeichnis
- Das Grabbesche Drama: ein Einzelphänomen
- Analyse der Dramenform
- Komposition der Szenen
- Auflösung einer durchgehenden Handlung
- Zum Verhältnis der Zeit
- Verwendung des Mediums Raum
- Anzahl und Zeichnung der Figuren
- Sprache als Medium für Geschichte
- Grabbes Absicht mit Napoleon oder die hundert Tage
- Fazit
- Verzeichnis der verwendeten Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Dramenform von Christian Dietrich Grabbes "Napoleon oder die hundert Tage" und untersucht, ob sich darin Elemente einer "Radikaldramatik" erkennen lassen. Die Analyse fokussiert auf die Abweichungen von der gängigen Dramenform des frühen 19. Jahrhunderts und untersucht Grabbes Absicht bei der Wahl dieser Form.
- Untersuchung der Dramenform in Bezug auf Komposition, Handlung, Zeit, Raum, Figurenzeichnung und Sprache
- Analyse von Grabbes Abweichungen von der klassischen Dramenform
- Bewertung der Elemente der "Radikaldramatik" in Grabbes Drama
- Darstellung der Motivation hinter Grabbes Wahl der Dramenform
- Einordnung des Dramas in den Kontext der literarischen Entwicklung des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Grabbesche Drama: ein Einzelphänomen
Dieses Kapitel setzt sich mit dem Hintergrund der Dramenform im frühen 19. Jahrhundert auseinander. Es wird beschrieben, wie Grabbes Drama in der damaligen literarischen Landschaft eine Ausnahme darstellte und wie er sich vom klassischen Standarddrama abgrenzte.
2. Analyse der Dramenform
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Dramenform in "Napoleon oder die hundert Tage", wie die Komposition der Szenen, die Auflösung einer durchgehenden Handlung, die Behandlung von Zeit und Raum, die Zeichnung der Figuren und die Verwendung der Sprache. Es untersucht, welche neuen Elemente Grabbe in seinem Drama einsetzt und wie er die traditionelle Dramenform subvertiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Radikaldramatik, Christian Dietrich Grabbe, Napoleon oder die hundert Tage, Dramenform, Komposition, Handlung, Zeit, Raum, Figurenzeichnung, Sprache, Geschichte, Revolution, Restauration, Bonapartismus.
- Quote paper
- Veronika Seitz (Author), 2007, Radikaldramatik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207108