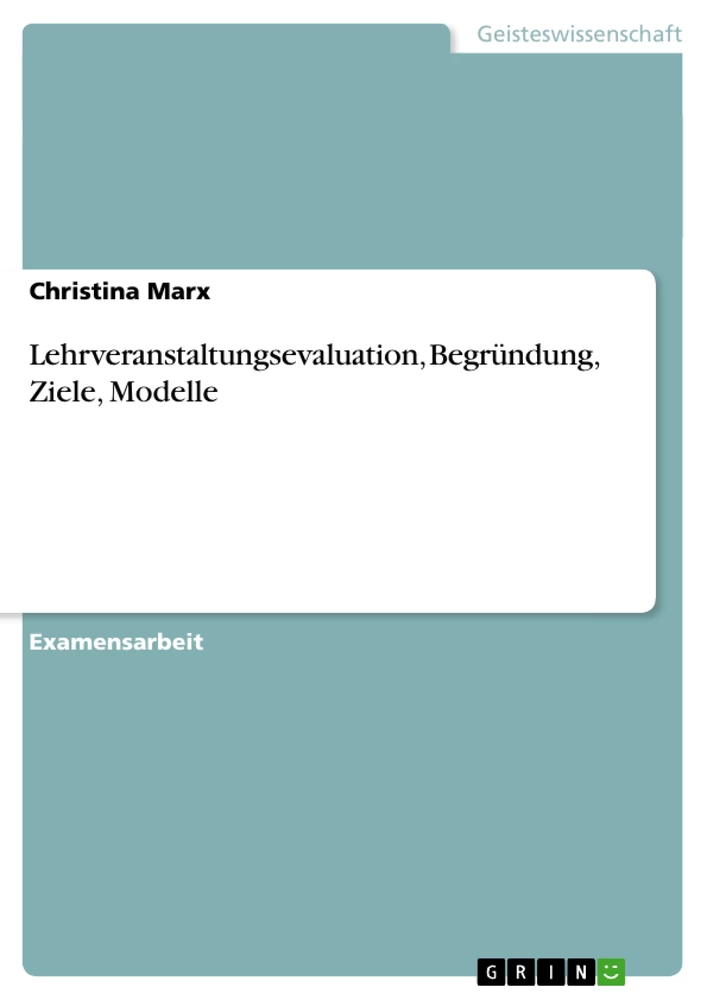1.1 Problemstellung
Obwohl die deutschen Universitäten durch den Gesetzgeber und die steigenden
Ansprüche der Studenten zunehmend unter Druck stehen die Qualität der Lehre an
den Hochschulen zu verbessern, konnte sich bis heute kein einheitliches System zur
Qualitätssteuerung durchsetzen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sehen als
wichtiges Instrument der Qualitätssicherung die Lehrveranstaltungsevaluation vor.
Hier stehen den Hochschulen einige Modelle zur Verfügung, die sich im Besonderen
Hinblick auf ihren Nutzen zur Verbesserung der didaktischen Qualität und ihrer
äußeren Bedingungen der Lehrveranstaltungen unterscheiden.
1.2 Ziele und Aufbau der Arbeit
In dieser Arbeit werde ich die Entwicklung der Lehrveranstaltungsevaluation im 20
Jahrhundert und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Qualitätsdebatte an den
Hochschulen, sowie verschiedene Modelle und Zielsetzungen der
Lehrveranstaltungsevaluation diskutieren. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu
sprengen kann nicht auf alle Aspekte eingegangen werden Da zum Zeitpunkt der
Arbeit ein Evaluationsprojekt in Hannover (Fachbereich Soziologie) läuft, werde ich
mich, an für mich interessanten Stellen, exemplarisch darauf beziehen.
Die Fachliteratur zum Thema Evaluation ist breit gefächert. Es gibt einige
Forschungsstudien, die sich in jüngster Zeit mit detaillierten Problemen in der
Lehrveranstaltungsevaluation auseinandergesetzt haben. Unterstützt werden diese
Forschungen von wissenschaftlichen Studien in Zeitschriften, ein großer Teil der
Diskussion ist zusätzlich über das Internet abrufbar. Bei der Recherche ist deutlich
geworden, wie umfangreich die Forschungen bis heute schon sind. Es gibt wenige
Aspekte, die noch nicht diskutiert wurden. Viele spontane Einfälle, die während unserer Projektarbeit eifrig diskutiert wurden, sind, wie ich später in der Recherche
erfahren habe, schon lange erforscht und veröffentlicht. Interessant war bei der
Literaturrecherche, wie in anderen Hochschulen mit dem Thema der
Lehrveranstaltungsevaluation (LVE) umgegangen wird. Da die Anwendung von LVE
noch nicht perfektioniert ist, war es aufschlußreich, mich hier zu vertiefen.
Die Zusammenhänge der Gesetzestexte zu Hochschulreformen waren nicht immer
eindeutig zu verstehen, deshalb nutzte ich die Möglichkeit, mich bei den Parteien
direkt (Edelgard Bulmahn) oder bei den zuständigen Ministerien zu informieren. Von
diesen Seiten bekam ich sofort prompte Unterstützung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Historischer Überblick der letzten 30 Jahre
- Qualitätsdebatte in der Lehre in Deutschland
- Der Lehrauftrag
- Die Qualitätsdebatte seit 1967
- Veränderungen ab den 70er Jahren
- Hochschuldidaktik in der Diskussion
- Erste Reformierung der Hochschulrahmengesetze
- Studienzeiten verlängern sich
- Interne Forderungen der Hochschulen
- Studenten
- Dozenten
- Externe Forderungen an die Hochschulen
- Der öffentliche Druck
- Industrie
- Veränderungen durch die Hochschulpolitik und Staat
- Entwicklung der Evaluation
- Allgemein
- International
- USA
- Europa
- Evaluation an deutschen Hochschulen
- Anfänge
- Die Entwicklung einzelner Organisationen
- Reformierung des Hochschulrahmengesetzes
- Reform der Besoldungsgesetze
- Die Generalisierung des Begriffes der Evaluation
- Modelle der Lehrveranstaltungsevaluation
- Allgemeines
- Ziele
- Instrumente der Lehrveranstaltungsevaluation
- Der Evaluationsprozess
- Validität der Lehrveranstaltungsevaluation
- Akzeptanz der Lehrveranstaltungsevaluation
- Bewertungskriterien
- Auswertung der Rückmeldungen
- Was kommt nach der Lehrveranstaltungsevaluation?
- Modelle der verschiedenen Universitäten
- Universität Jena: Projekt „Lehre“ der Friedrich-Schiller-Universität
- Philips- Universität in Marburg
- Verfahren
- Auswertung
- Universität Salzburg
- Verfahren
- Auswertung
- Universität Bielefeld
- Verfahren
- Feedbackverfahren
- Empfehlungen
- Verfahren
- Die fünf Planungsdimensionen
- Entwicklung der Lehrveranstaltungsevaluation im 20. Jahrhundert
- Gesellschaftliche Einflüsse auf die Qualitätsdebatte an Hochschulen
- Verschiedene Modelle der Lehrveranstaltungsevaluation
- Zielsetzungen der Lehrveranstaltungsevaluation
- Nutzen der Evaluation für die Verbesserung der didaktischen Qualität und der äußeren Bedingungen von Lehrveranstaltungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Lehrveranstaltungsevaluation im 20. Jahrhundert und analysiert die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Qualitätsdebatte an deutschen Hochschulen. Sie untersucht verschiedene Modelle und Zielsetzungen der Lehrveranstaltungsevaluation und diskutiert deren Nutzen zur Verbesserung der didaktischen Qualität und der äußeren Bedingungen von Lehrveranstaltungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar, die in der mangelnden Einheitlichkeit von Qualitätssicherungssystemen an deutschen Hochschulen liegt. Die Arbeit fokussiert sich auf die Lehrveranstaltungsevaluation als wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und beleuchtet verschiedene Modelle, die sich hinsichtlich ihres Nutzens zur Verbesserung der didaktischen Qualität und der äußeren Bedingungen von Lehrveranstaltungen unterscheiden.
Historischer Überblick der letzten 30 Jahre
Dieses Kapitel beleuchtet die Qualitätsdebatte in der Lehre an deutschen Hochschulen in den letzten 30 Jahren. Es analysiert die Entwicklung des Lehrauftrags, die Veränderungen im Hochschulsystem, die Reformierung der Hochschulrahmengesetze und die steigenden Studienzeiten. Zudem werden interne Forderungen von Studenten und Dozenten sowie externe Forderungen von Politik, Industrie und Gesellschaft betrachtet.
Entwicklung der Evaluation
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Evaluation im Allgemeinen, auf internationaler Ebene (USA und Europa) und speziell an deutschen Hochschulen. Es analysiert die Anfänge der Evaluation, die Entwicklung einzelner Organisationen, die Reformierung des Hochschulrahmengesetzes, die Reform der Besoldungsgesetze und die Generalisierung des Begriffs der Evaluation.
Modelle der Lehrveranstaltungsevaluation
Dieses Kapitel erläutert verschiedene Modelle der Lehrveranstaltungsevaluation, deren Ziele, Instrumente, den Evaluationsprozess und die Bewertungskriterien. Es befasst sich mit der Validität und Akzeptanz der Lehrveranstaltungsevaluation sowie der Auswertung von Rückmeldungen und den Schritten, die nach der Evaluation folgen.
Schlüsselwörter
Lehrveranstaltungsevaluation, Qualitätssicherung, Hochschuldidaktik, Hochschulrahmengesetz, Studenten, Dozenten, Evaluationsprozess, Modelle, Verfahren, Auswertung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Lehrveranstaltungsevaluation (LVE)?
Ziel ist die Sicherung und Verbesserung der didaktischen Qualität sowie der äußeren Bedingungen der Lehre an Hochschulen.
Ist LVE in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben?
Ja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Hochschulreformen sehen die Evaluation als wichtiges Instrument der Qualitätssicherung vor.
Welche Evaluationsmodelle nutzen Universitäten?
Die Arbeit beschreibt Modelle der Universitäten Jena, Marburg, Salzburg und Bielefeld, die sich in Verfahren und Auswertung unterscheiden.
Wie bewerten Studenten und Dozenten die Evaluation?
Die Akzeptanz hängt stark von der Validität der Instrumente und der tatsächlichen Umsetzung von Verbesserungen nach der Auswertung ab.
Welche Rolle spielt der öffentliche Druck auf Hochschulen?
Steigende Ansprüche von Studenten und Forderungen der Industrie zwingen Hochschulen zu einer transparenteren Qualitätssteuerung.
- Quote paper
- Christina Marx (Author), 2003, Lehrveranstaltungsevaluation, Begründung, Ziele, Modelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20713