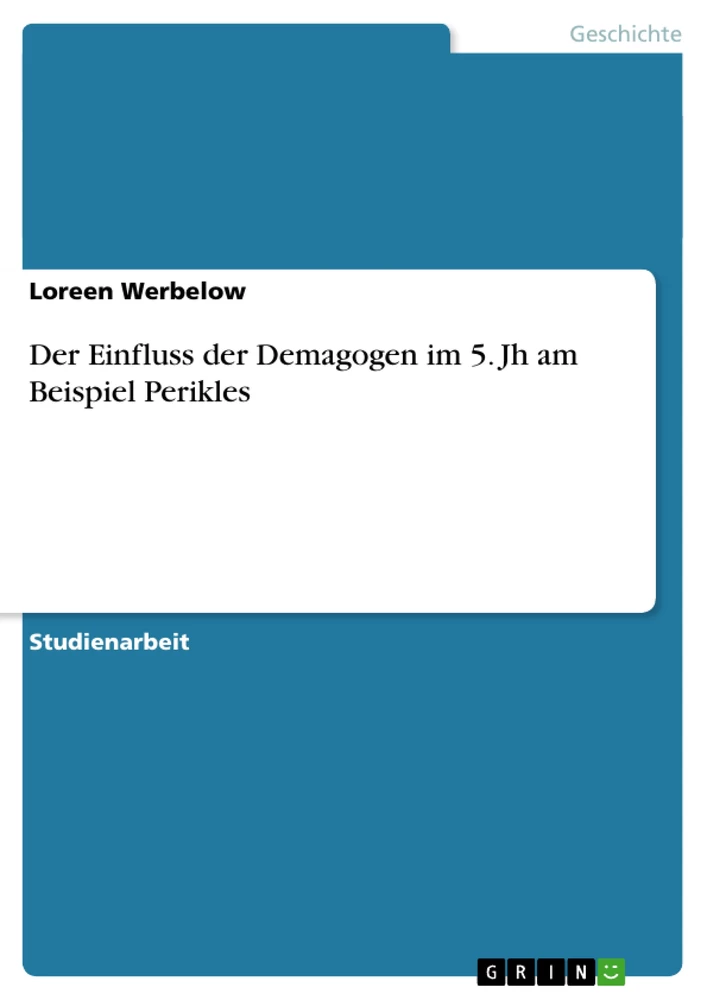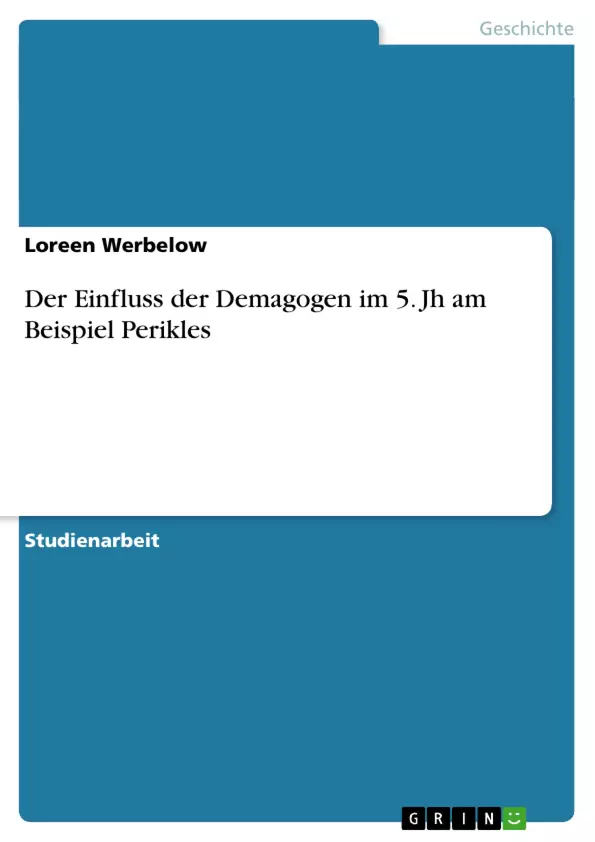Die Faszination für die Rhetorik ist allgegenwärtig und begegnet uns täglich in den Medien -
sei es in der Politik oder in der Werbung. Sie ist ein unsichtbares Machtinstrument, welche
die Person, die es beherrscht, geschickt für ihre Vorteile nutzen kann. Das Interesse an der
Rhetorik spiegelt sich nicht nur in den Buchhandlungen wieder, sondern auch in den
Angeboten der zahlreichen Rhetorikkurse. Die Möglichkeiten der Rhetorik wurden in der
Zeit, in der die Antike Staatsform der Demokratie aufkam, erkannt und umgesetzt.
Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem Einfluss der Demagogen in der Zeit des 5. Jh. v. ehr.
und versucht der Frage nachzugehen, welche Bedingungen einerseits notwenig waren, um
der Rolle eines Demagogen gerecht zu werden und andererseits, wie es den Rednern gelang,
einen so großen Machteinfluss in der Antike zu bekommen.
Nach der Einführung in den historischen Kontext wird die antike Staatsform thematisiert.
Diese bildet die Grundlage für das Verständnis von der Ursache und von der Art und Weise,
wie die Demagogen Einfluss auf das politische Geschehen nehmen konnten. Die
Pflichtlektüre des Seminars "Der Peloponnesische Krieg" diente mir dabei als Grundlage für
den Aufbau des Aufsatzes. Ein bedeutender Rhetoriker dieser Zeit war Perikles, ein Stratege
und Mitstreiter des Krieges. Dieser Person galt mein Interesse für die Hervorhebung und das
Verständnis der Rolle der Demagogen im antiken Griechenland.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Historischer Kontext
- 1. Der Peloponnesische Krieg
- 2. Vorgeschichte
- III. Demokratie und Demagogen
- 1. Die Antike Staatsform
- 2. Die Volksversammlung
- 3. Die Rolle der Demagogen
- IV. Perikles
- 1. Quellenlage
- 2. Jugend und Erziehung
- 3. Politische Karriere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht den Einfluss der Demagogen in der Zeit des 5. Jh. v. Chr. im antiken Griechenland und analysiert die Bedingungen, die für die Rolle des Demagogen notwendig waren.
- Die politische Situation in Athen während des Peloponnesischen Krieges
- Die antike Staatsform der Demokratie
- Die Bedeutung der Rhetorik im politischen Diskurs
- Die Rolle von Perikles als prominentem Demagogen
- Der Einfluss der Demagogen auf das politische Geschehen und die Stabilität der athenischen Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema des Aufsatzes ein und erläutert die Faszination für Rhetorik und deren Bedeutung in der Antike. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der Demagogen im 5. Jh. v. Chr. und den Bedingungen, die ihre Machtstellung ermöglichten. Der Aufsatz basiert auf der Pflichtlektüre des Seminars „Der Peloponnesische Krieg“ und konzentriert sich auf die Figur des Perikles als prominentes Beispiel für einen Demagogen.
II. Historischer Kontext
Dieses Kapitel stellt den Peloponnesischen Krieg, ein bedeutendes Ereignis der Antike, als historischen Kontext vor. Es wird die Bedeutung des Krieges für Athen und Sparta sowie die Gründe für dessen Ausbruch erläutert. Der Fokus liegt auf den Vorfällen, die zur Eskalation des Konflikts führten, wie dem Konflikt um Kerkyra, dem Vorgehen Athens gegen Poteidaias und dem Handelsboykott gegen Megara.
III. Demokratie und Demagogen
Dieses Kapitel beleuchtet die antike Staatsform der Demokratie im 5. Jh. v. Chr. und stellt die Unterschiede zur heutigen Demokratie heraus. Der Fokus liegt auf der Rolle der Volksversammlung (ekklesia) und der Bedeutung der Rhetorik als Schlüsselkompetenz für politische Führungspersönlichkeiten. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung und Funktion der Demagogen im politischen System und deren Einfluss auf die Entscheidungen der Bürger.
IV. Perikles
Dieses Kapitel untersucht die Person des Perikles als prominentem Demagogen. Es beleuchtet seine Lebensgeschichte, seine politische Karriere und seinen Einfluss auf die athenische Demokratie. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Perikles mit seiner Rhetorik und seinem politischen Geschick das Volk beeinflussen und zu seinen Entscheidungen führen konnte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Aufsatzes sind: Antike Demokratie, Demagogen, Rhetorik, Peloponnesischer Krieg, Perikles, Volksversammlung, politische Einflussnahme, Macht, Herrschaft, Entscheidungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Rolle eines Demagogen im antiken Athen?
Ein Demagoge war ein „Volksführer“, der durch rhetorisches Geschick in der Volksversammlung (Ekklesia) Einfluss auf die politische Meinung und Entscheidungsfindung der Bürger nahm.
Warum war Perikles ein so bedeutender Redner?
Perikles verstand es, die Rhetorik als Machtinstrument zu nutzen, um das Volk von seinen strategischen Plänen zu überzeugen, was ihm eine langjährige Führungsposition während der Blütezeit Athens ermöglichte.
Wie unterschied sich die antike Demokratie von der heutigen?
Die athenische Demokratie war eine direkte Demokratie, in der stimmberechtigte Bürger unmittelbar in der Volksversammlung über Gesetze und Kriegszüge entschieden, statt Vertreter zu wählen.
Welchen Einfluss hatte der Peloponnesische Krieg auf die Demagogen?
Der Krieg schuf ein Klima der Unsicherheit, in dem charismatische Redner die Ängste und Hoffnungen des Volkes ausnutzen konnten, um radikale politische Entscheidungen herbeizuführen.
War die Rhetorik in der Antike erlernbar?
Ja, Rhetorik galt als Schlüsselkompetenz für eine politische Karriere und wurde durch Erziehung und spezielle Kurse (oft bei Sophisten) intensiv geschult.
- Arbeit zitieren
- Loreen Werbelow (Autor:in), 2011, Der Einfluss der Demagogen im 5. Jh am Beispiel Perikles, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207204