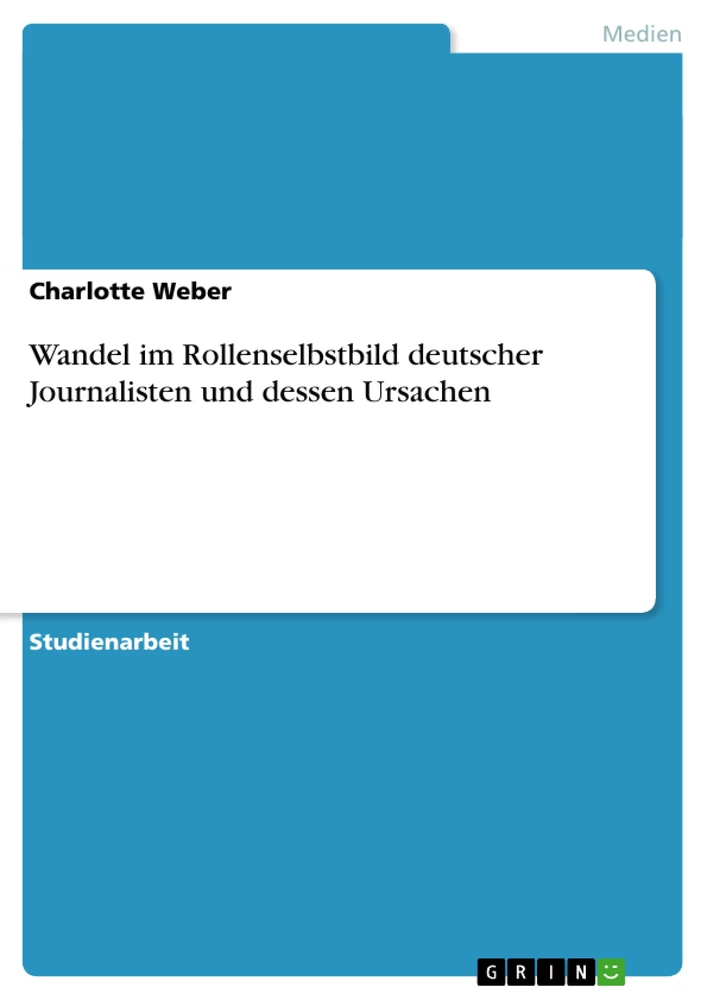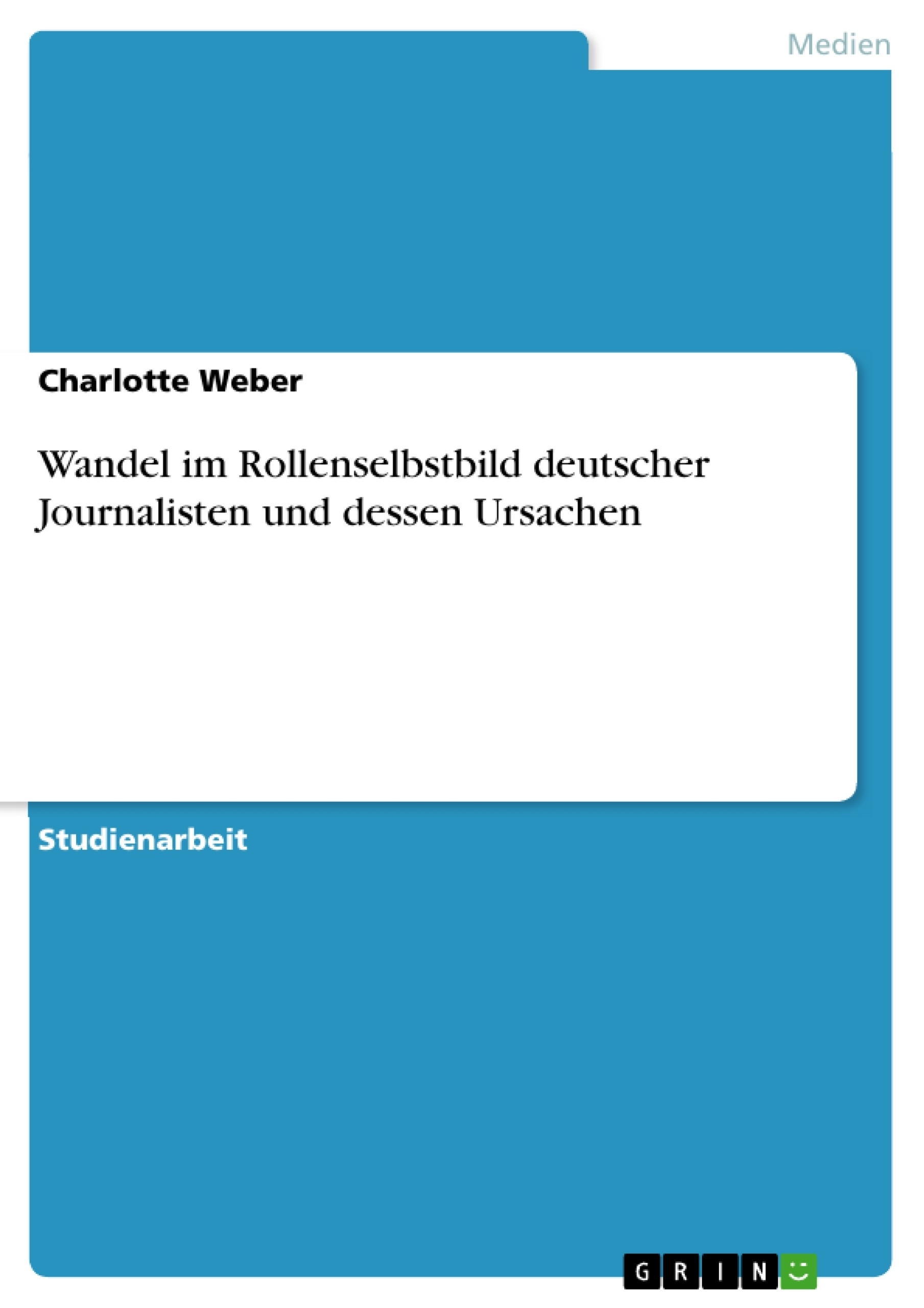Die Frage nach dem Rollenselbstbild bildet einen zentralen Aspekt der Journalismusforschung. Thematisiert wird dabei die Selbsteinschätzung der Journalisten bezüglich ihrer Ziele, Arbeitsweisen und Aufgaben. Somit lässt sich das Rollenselbstbild neben persönlichen Präferenzen und redaktioneller Linie als Erklärungsvariable für Nachrichtenselektion und –produktion betrachten und bietet Anhaltspunkt, um Aussagen über journalistische Arbeitsweisen treffen zu können. Betrachtet man journalistische Produkte als Realitätskonstruktion durch die Journalisten, so wird im Kontext der Funktion des Journalismus für die Gesellschaft deutlich, warum es relevant ist, sich kritisch mit dem Selbstbild von Journalisten auseinanderzusetzen.
Das Mediensystem in Deutschland hat sich seit Ende des zweiten Weltkrieges beträchtlich gewandelt – zu nennen sind hier nebst rechtlichen vor allem strukturelle Änderungen, die Einflussgrößen auf das Rollenselbstbild der Journalisten bilden. Vor diesem, wie auch dem historischen Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit Änderungen im Rollenselbstbild deutscher Journalisten darlgegegt sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rollenselbstbilder und Wandel
- Berufsvorstellungen und -motive
- Ethische Vorstellungen
- Übertragbarkeit der Ergebnisse
- Ursachen für den Wandel
- Strukturelle und normative Ursachen
- Historische Ursachen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Veränderung des Rollenselbstbildes deutscher Journalisten und den Ursachen für diese Entwicklung. Die Studie analysiert die Selbsteinschätzung von Journalisten bezüglich ihrer Ziele, Arbeitsweisen und Aufgaben und untersucht, wie sich diese Einschätzungen im Laufe der Zeit verändert haben. Dabei werden sowohl strukturelle und normative als auch historische Einflussfaktoren berücksichtigt.
- Entwicklung des Rollenselbstbildes deutscher Journalisten
- Berufsvorstellungen und -motive von Journalisten
- Ethische Vorstellungen und Standards im Journalismus
- Einflussfaktoren auf das Rollenselbstbild, wie z.B. strukturelle Veränderungen im Mediensystem und historische Entwicklungen
- Zukünftige Entwicklungen des Rollenselbstbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Rollenselbstbildes im Journalismus ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Das Kapitel 2 analysiert verschiedene Rollenselbstbilder und deren Wandel anhand von empirischen Studien. Es wird die Unterscheidung zwischen partizipativem und neutralem Journalismus sowie die Differenzierung in „Gatekeeper“ und „Advocate“ vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Im Fokus steht die Untersuchung der Berufsmotive, ethischen Vorstellungen und des subjektiven Berufsverständnisses von Journalisten. Das Kapitel 3 befasst sich mit den Ursachen für den Wandel des Rollenselbstbildes. Es werden strukturelle und normative Ursachen sowie historische Entwicklungen betrachtet, die Einfluss auf die Selbsteinschätzung von Journalisten haben.
Schlüsselwörter
Journalismus, Rollenselbstbild, Wandel, Berufsmotive, ethische Vorstellungen, strukturelle Ursachen, historische Ursachen, Mediensystem, Deutschland, Gatekeeper, Advocate, partizipativer Journalismus, neutraler Journalismus, Selbstverwirklichung, Kritisierung von Missständen, Vermittlung von Werten und Idealen, Einfluss auf politische Entscheidungen, Freiheit, Generationenwandel, Berufsverständnis, ethisch fragwürdige Informationsbeschaffung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Rollenselbstbild eines Journalisten?
Es ist die Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Ziele, Aufgaben und Arbeitsweisen (z. B. neutraler Berichterstatter vs. gesellschaftlicher Akteur).
Was ist der Unterschied zwischen „Gatekeeper“ und „Advocate“?
Ein Gatekeeper selektiert Nachrichten nach objektiven Kriterien, während ein Advocate (Anwalt) gezielt Interessen vertritt oder Missstände anprangert.
Wie hat sich das Selbstbild deutscher Journalisten gewandelt?
Es gab eine Entwicklung weg vom rein neutralen Vermittler hin zu einem stärker partizipativen und kritischen Berufsverständnis.
Welche Ursachen gibt es für diesen Wandel?
Ursachen sind strukturelle Änderungen im Mediensystem, historische Erfahrungen nach 1945 und ein Generationenwandel innerhalb der Redaktionen.
Welchen Einfluss hat das Selbstbild auf die Nachrichtenselektion?
Das Selbstbild fungiert als Erklärungsvariable; je nachdem, wie ein Journalist seine Rolle sieht, wählt er Themen aus und produziert Realitätskonstruktionen.
- Quote paper
- Charlotte Weber (Author), 2011, Wandel im Rollenselbstbild deutscher Journalisten und dessen Ursachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207235