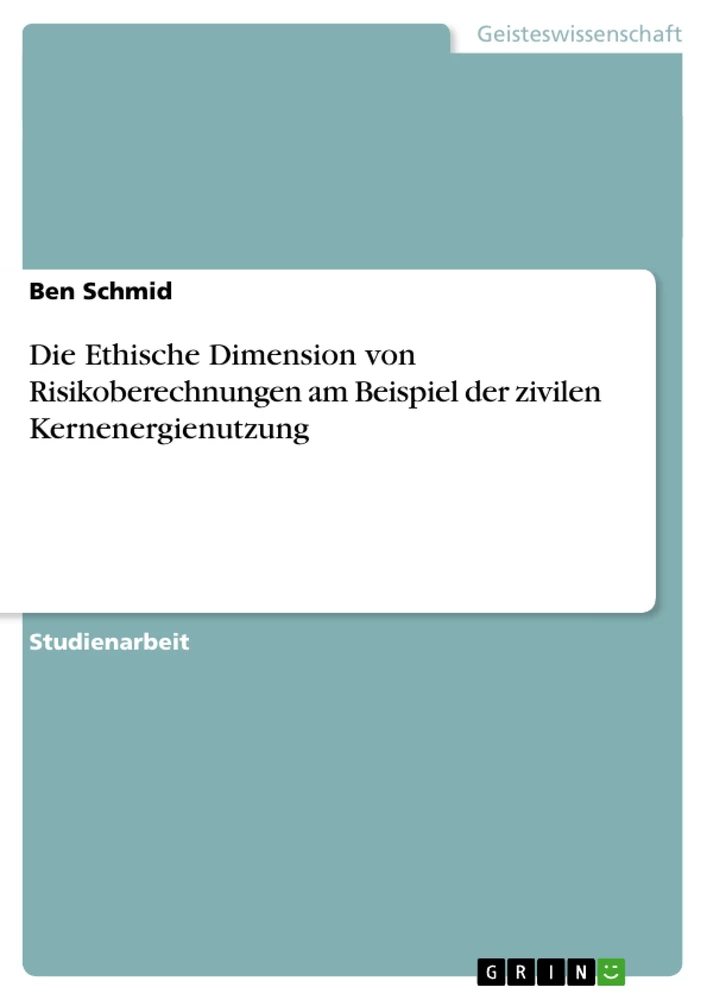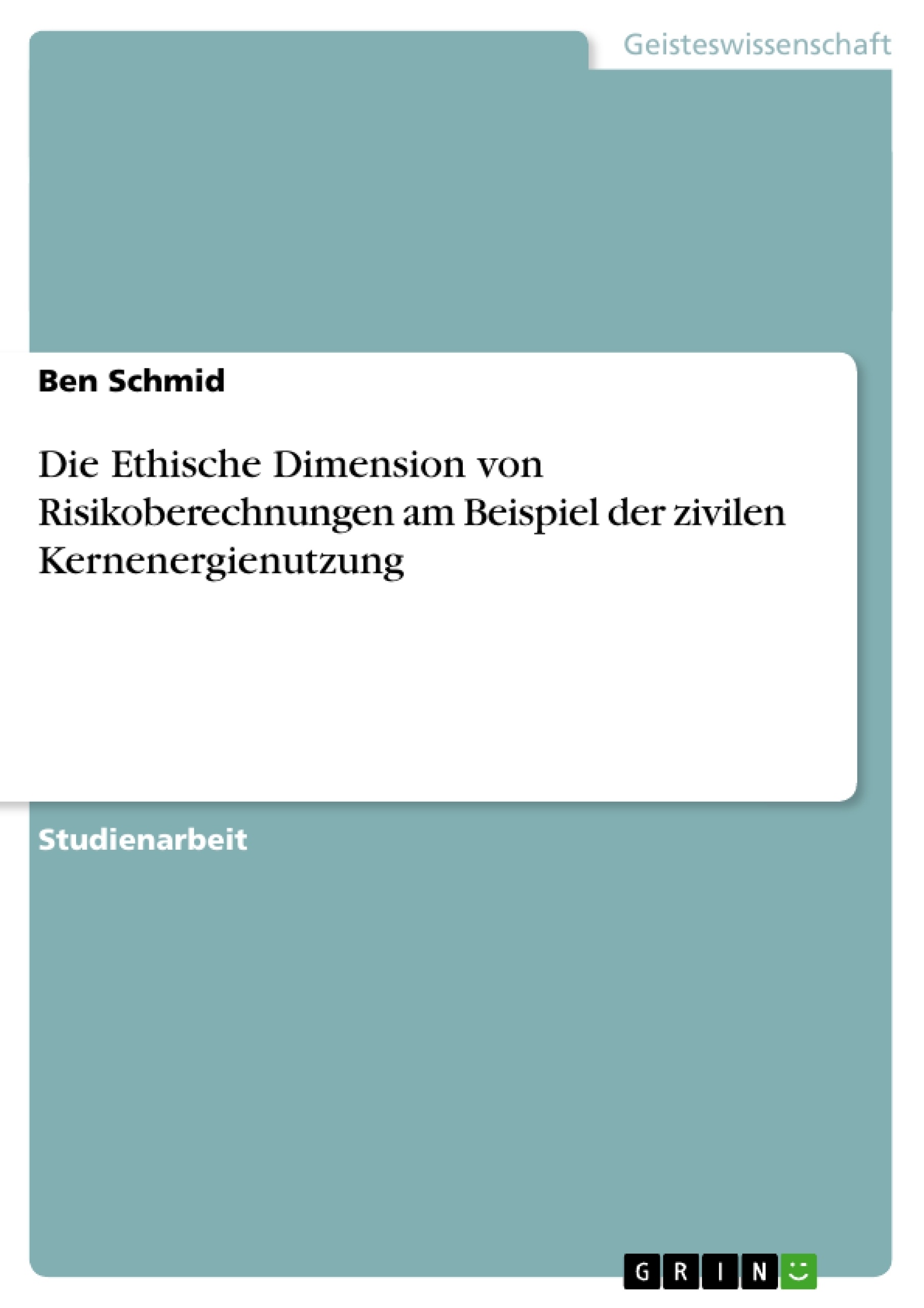Drei Jahre vor dem „Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg“ (Brost 2011) sprach sich Altkanzler Helmut Schmidt in der ZEIT für die weitere Nutzung von Kernenergie in Deutschland aus. So alt wie die zivile Nutzung der Kernkraft selbst ist auch der Streit zwischen Widersacher und Befürworter. Im Zentrum steht dabei neben der ungelösten Endlagerfrage immer wieder der Begriff des Risikos. Während die Verfechter die Energiegewinnung durch Kernkraftwerke als „vernünftig“ (Sentker 2009) ansehen, mit der Begründung dass eine Kernschmelze als größter anzunehmender Unfall durch technische Entwicklungen „prinzipiell ausgeschlossen“ (ibid.) sei, werten Kritiker die Errichtung und Verwendung solcher Anlagen als Angriff auf die Menschheit, da „auch wenn sie nicht, wie Bomben oder Raketen den Tod von tausenden bezwecken, diesen doch in Kauf nehmen.“ (Anders 1986: 127). Doch wie hoch oder gering ist Wahrscheinlichkeit eines „auslegungsüberschreitenden Störfall[s]“ (Schrader 2009), also eines Zwischenfalles für welchen das Kernkraftwerk nicht ausgerichtet ist, wirklich? Auf welcher Basis wird das Risiko der zivilen Kernkraftnutzung ermittelt? Und welche ethischen Überlegungen fließen in die Risikobeurteilung ein wenn es als unvermeidbares „Restrisiko“ oder „sozialadäquate Last“ (Rath 2011) die von der Bevölkerung zu tragen ist angesehen wird?
Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Insbesondere soll herausgestellt werden, welche normativen Entscheidungen in die Risikobeurteilung mit einfließen. In Teil (I) soll dazu näher auf die Risikoforschung im Allgemeinen und Möglichkeiten der Risikoberechnung eingegangen werden. Im Anschluss behandelt Teil (II) die Vorgänge und Wahrscheinlichkeiten eines auslegungsüberschreitenden Störfalls beziehungsweise Super-GAU1. Vor diesem Hintergrund soll dann in Teil (III) die ethische Dimension der Risikorechnungen herausgearbeitet und hinterfragt werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- I. RISIKOBERECHNUNG UND RISIKOBEWERTUNG
- I.1 Begriffsklärung und Definition
- 1.2 Risiko in der modernen Gesellschaft
- 1.3 Die Formel Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß
- 1.4 Ergänzungen und Erweiterungen der Risikoformel
- II. RISIKEN DER ZIVILEN KERNENERGIENUTZUNG
- II.1 Kernspaltung und Radioaktivität
- II.2 Auslegungsstörfälle und auslegungsüberschreitende Störfälle
- II.3 Super-GAU
- III. ETHISCHE DIMENSIONEN DER RISIKOBERECHNUNG UND RISIKOBEURTEILUNG
- III.1 Allgemein
- III.2 Eintrittswahrscheinlichkeit
- III.3 Schadensausmaß
- III.4 Weitere Ethische Überlegungen
- IV. SCHLUSS
- V. QUELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die ethische Dimension von Risikoberechnungen am Beispiel der zivilen Kernenergienutzung. Sie analysiert die Risikoforschung im Allgemeinen und die Möglichkeiten der Risikoberechnung. Des Weiteren beleuchtet sie die Vorgänge und Wahrscheinlichkeiten eines auslegungsüberschreitenden Störfalls, um anschließend die ethischen Dimensionen der Risikobewertung im Kontext der Kernenergiegewinnung zu hinterfragen.
- Begriffsklärung und Definition von Risiko
- Risiko in der modernen Gesellschaft
- Risikoberechnung und ihre Grenzen
- Risiken der zivilen Kernenergienutzung
- Ethische Aspekte der Risikobeurteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet den historischen Kontext des Streits zwischen Kernkraftbefürwortern und -gegnern. Sie stellt die Relevanz der Risikoberechnung für die zivile Kernenergienutzung heraus und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
Kapitel I beschäftigt sich mit der Risikoforschung im Allgemeinen. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs "Risiko" diskutiert und die Rolle des Risikos in der modernen Gesellschaft analysiert. Außerdem wird die Risikoformel Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß vorgestellt und ihre Grenzen sowie Möglichkeiten zur Erweiterung aufgezeigt.
Kapitel II befasst sich mit den spezifischen Risiken der zivilen Kernenergienutzung. Die Funktionsweise der Kernspaltung und die damit verbundene Radioaktivität werden erläutert. Anschließend werden verschiedene Störfalltypen, darunter Auslegungsstörfälle und auslegungsüberschreitende Störfälle, sowie der Super-GAU, vorgestellt.
Kapitel III untersucht die ethischen Dimensionen der Risikoberechnung und -bewertung im Kontext der Kernenergiegewinnung. Es werden die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß sowie weitere ethische Überlegungen, wie z. B. Unfreiwilligkeit und anthropogene Verursachung, diskutiert.
Schlüsselwörter
Kernenergie, Risikoberechnung, Risikobewertung, Ethische Dimension, Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadensausmaß, Super-GAU, Störfall, Unfreiwilligkeit, Anthropogene Verursachung, Risikogesellschaft, Intergenerationale Gerechtigkeit, Intragenerationale Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Risiko in der Kernenergie üblicherweise berechnet?
Die klassische Formel lautet: Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensausmaß. Kritiker bemängeln jedoch, dass diese rein mathematische Sicht ethische Aspekte vernachlässigt.
Was ist ein „auslegungsüberschreitender Störfall“ (Super-GAU)?
Es handelt sich um einen Unfall, für den das Kraftwerk technisch nicht ausgelegt ist und bei dem massive Mengen an Radioaktivität freigesetzt werden können.
Welche ethischen Probleme wirft das „Restrisiko“ auf?
Es stellt sich die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, der Bevölkerung eine Last aufzuerlegen, deren katastrophale Folgen zwar unwahrscheinlich, aber im Ernstfall unumkehrbar sind.
Was bedeutet „intergenerationale Gerechtigkeit“ in diesem Kontext?
Dabei geht es um die ethische Frage, ob wir heutigen Generationen den Nutzen der Kernenergie genießen dürfen, während wir zukünftigen Generationen die Risiken der Endlagerung aufbürden.
Warum wird die Freiwilligkeit bei Risiken ethisch bewertet?
Ethisch macht es einen Unterschied, ob ein Individuum ein Risiko freiwillig eingeht (z. B. Bergsteigen) oder ob ein Risiko (wie Kernkraft) kollektiv und unfreiwillig von der Gesellschaft getragen werden muss.
- Quote paper
- Ben Schmid (Author), 2012, Die Ethische Dimension von Risikoberechnungen am Beispiel der zivilen Kernenergienutzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207363