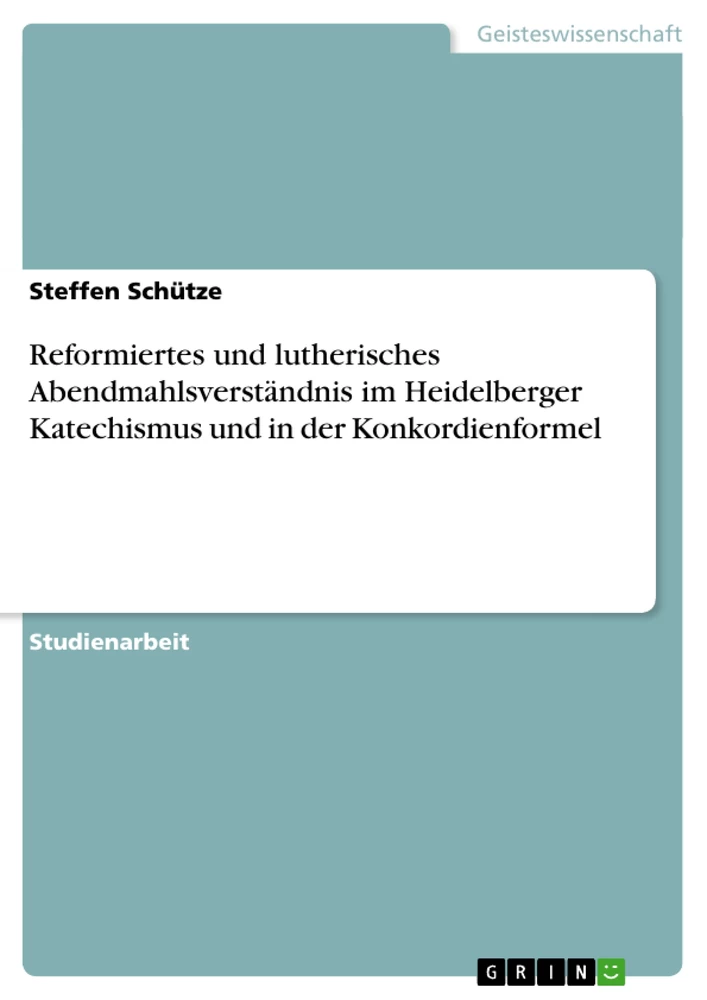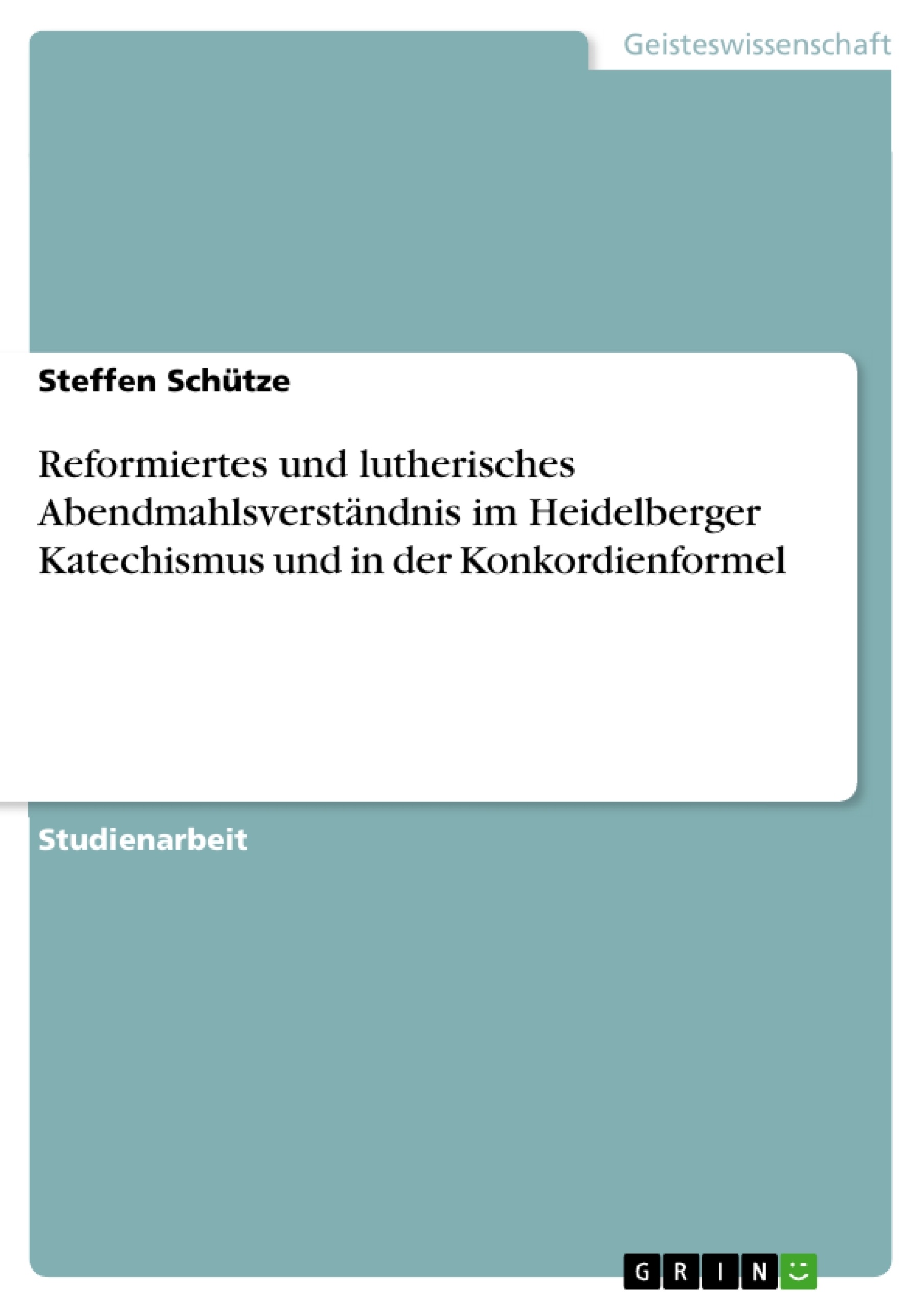Warum gibt es eine lutherische und eine reformierte Kirche? Worin lag der Grund, dass die Reformatoren des 16. Jahrhunderts sich nicht nur von der römisch-katholischen Lehre distanzierten, sondern auch noch derart große Differenzen aufbauten, dass die protestantischen Kirchen sich in zwei Gruppierungen aufspalteten?
Mit dem Erscheinen des Heidelberger Katechismus, der heute der meistverbreitete reformierte Katechismus ist, trat 1563 das erste deutsche Fürstentum, die Kurpfalz, zum reformierten Lager über, nachdem im deutschen Luthertum die Einflüsse aus Zürich und Genf stetig gewachsen waren. Vor allem der lang anhaltende Streit um das Abendmahl, der sich besonders heftig zwischen Luther und Zwingli abgespielt hatte, ließ die reformatorische Einheit aufbrechen. 14 Jahre nach Erscheinen des Heidelberger Katechismus verfassten lutherische Theologen deshalb auf Veranlassung des sächsischen Kurfürsten August die Konkordienformel, die letzte lutherische Bekenntnisschrift. Mit ihr wollte man sowohl eine Einigung im lang anhaltenden innerlutherischen Streit erzielen als auch eine konfessionelle Abgrenzung zur reformierten Lehre. Insofern werden die strittigen Punkte in dieser Schrift gut zum Ausdruck gebracht, weswegen sie sich zur genaueren Betrachtung der inner-protestantischen Verschiedenheiten besonders eignet.
In dieser Arbeit soll nun anhand des Abendmahlsverständnisses dieser beiden zentralen Bekenntnisschriften untersucht werden, worin sich die beiden großen evangelischen Lehren unterscheiden. Dazu ist es zunächst nötig, die Entstehungsgeschichten zu erfassen und kurz nachzuzeichnen. In vollem Umfang ist das hier offenbar nicht möglich. Da das Hauptaugenmerk auf den verschiedenen Lehren liegt, können die Einflüsse der Vorgeschichte nur ansatzweise an einigen Stellen aufgezeigt werden. Jedoch ergibt sich im Zuge der Untersuchung ebenfalls eine Einführung in das allgemeine Denken der reformierten und lutherischen Theologen. Auch die katholische Abendmahlsauffassung wird kurz dargelegt. Um den vorgegeben Rahmen nicht zu sprengen, muss sich die Analyse des Abendmahlsverständnisses allerdings in der Konkordienformel auf die Behandlung von Artikel 7 und 8 und im Heidelberger Katechismus auf die Fragen 47f. und 75-82 beschränken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Heidelberger Katechismus
- 2.1 Entstehungsgeschichte und Profil
- 2.2 Von den Sakramenten
- 2.3 Das Abendmahlsverständnis
- 3. Die Konkordienformel
- 3.1 Entstehungsgeschichte und Profil
- 3.2 Die Christologie
- 3.3 Das Abendmahlsverständnis
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede im Abendmahlsverständnis zwischen dem Heidelberger Katechismus und der Konkordienformel, zwei zentralen Bekenntnisschriften des reformierten und lutherischen Protestantismus. Die Entstehungsgeschichte beider Schriften wird kurz nachgezeichnet, um den Kontext der unterschiedlichen theologischen Positionen zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Abendmahlslehren.
- Vergleich des Abendmahlsverständnisses im Heidelberger Katechismus und der Konkordienformel
- Analyse der Entstehungsgeschichte beider Bekenntnisschriften
- Untersuchung der theologischen Unterschiede zwischen reformiertem und lutherischem Protestantismus
- Einführung in das allgemeine Denken reformierter und lutherischer Theologen
- Kurze Darstellung der katholischen Abendmahlsauffassung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historischen Gründe für die Spaltung des Protestantismus in lutherische und reformierte Kirchen, wobei der langjährige Streit um das Abendmahl eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Abendmahlslehren im Heidelberger Katechismus und der Konkordienformel, um die konfessionellen Unterschiede zu verdeutlichen. Die methodische Vorgehensweise, die sich auf eine gezielte Analyse der relevanten Abschnitte beider Schriften konzentriert, wird ebenfalls erläutert.
2. Der Heidelberger Katechismus: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Heidelberger Katechismus im Kontext der Reformation in der Kurpfalz. Es zeichnet den Weg von einer anfänglichen lutherischen Prägung hin zu einer zunehmenden Öffnung für reformierte Einflüsse unter Kurfürst Ottheinrich und dessen Nachfolger Friedrich III. nach. Der Abendmahlsstreit am pfälzischen Hof und die Rolle Melanchthons im Vermittlungsprozess werden detailliert dargestellt, was letztendlich zur Entstehung des Heidelberger Katechismus als reformiertes Bekenntnis führte. Der Kapitelverlauf illustriert den komplexen Prozess der konfessionellen Entwicklung innerhalb der frühen Reformation und den Einfluss wichtiger Persönlichkeiten und politischer Ereignisse auf die Gestaltung der reformierten Theologie.
Schlüsselwörter
Heidelberger Katechismus, Konkordienformel, Abendmahl, Reformation, Luthertum, Reformiertentum, Christologie, Konfession, Theologie, Bekenntnisschrift, Kurpfalz, Melanchthon, Zwingli, Bullinger.
Häufig gestellte Fragen zum Vergleich von Heidelberger Katechismus und Konkordienformel
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht das Abendmahlsverständnis des Heidelberger Katechismus und der Konkordienformel, zwei wichtige Bekenntnisschriften des reformierten und lutherischen Protestantismus. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte beider Schriften und analysiert ihre jeweiligen Abendmahlslehren, um die konfessionellen Unterschiede zu verdeutlichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich des Abendmahlsverständnisses beider Schriften, Analyse der Entstehungsgeschichte, Untersuchung der theologischen Unterschiede zwischen reformiertem und lutherischem Protestantismus, Einführung in das Denken reformierter und lutherischer Theologen und eine kurze Darstellung der katholischen Abendmahlsauffassung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Heidelberger Katechismus (inklusive Entstehungsgeschichte, Sakramentenlehre und Abendmahlsverständnis), ein Kapitel über die Konkordienformel (inklusive Entstehungsgeschichte, Christologie und Abendmahlsverständnis) und eine Schlussbetrachtung.
Was wird im Kapitel über den Heidelberger Katechismus behandelt?
Das Kapitel beschreibt die Entstehung des Heidelberger Katechismus in der Kurpfalz, den Weg von einer lutherischen zu einer reformierten Prägung unter Kurfürst Ottheinrich und Friedrich III., den Abendmahlsstreit am pfälzischen Hof, die Rolle Melanchthons und den komplexen Prozess der konfessionellen Entwicklung.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Heidelberger Katechismus, Konkordienformel, Abendmahl, Reformation, Luthertum, Reformiertentum, Christologie, Konfession, Theologie, Bekenntnisschrift, Kurpfalz, Melanchthon, Zwingli, Bullinger.
Worauf konzentriert sich die Arbeit im Bezug auf das Abendmahl?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der unterschiedlichen Abendmahlslehren im Heidelberger Katechismus und der Konkordienformel, um die konfessionellen Unterschiede zwischen reformiertem und lutherischem Protestantismus herauszuarbeiten.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine gezielte Analyse der relevanten Abschnitte beider Schriften, um die Unterschiede im Abendmahlsverständnis zu untersuchen.
Warum ist der Vergleich von Heidelberger Katechismus und Konkordienformel wichtig?
Der Vergleich ist wichtig, um die historische Spaltung des Protestantismus in lutherische und reformierte Kirchen zu verstehen, wobei der langjährige Streit um das Abendmahl eine zentrale Rolle spielte.
- Arbeit zitieren
- B.A. Steffen Schütze (Autor:in), 2012, Reformiertes und lutherisches Abendmahlsverständnis im Heidelberger Katechismus und in der Konkordienformel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207545