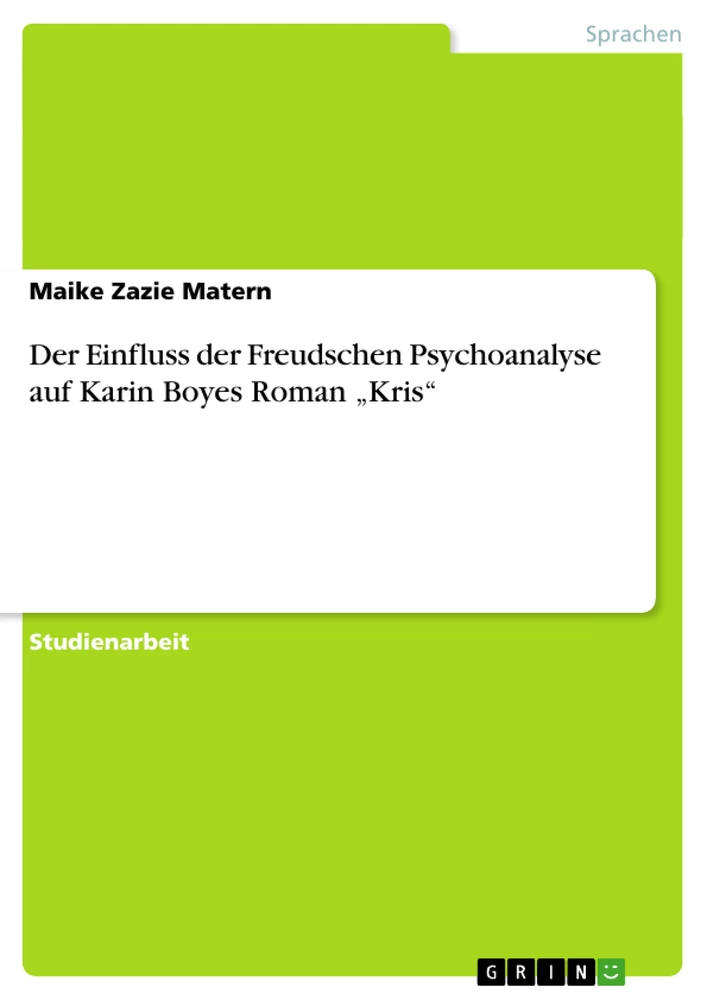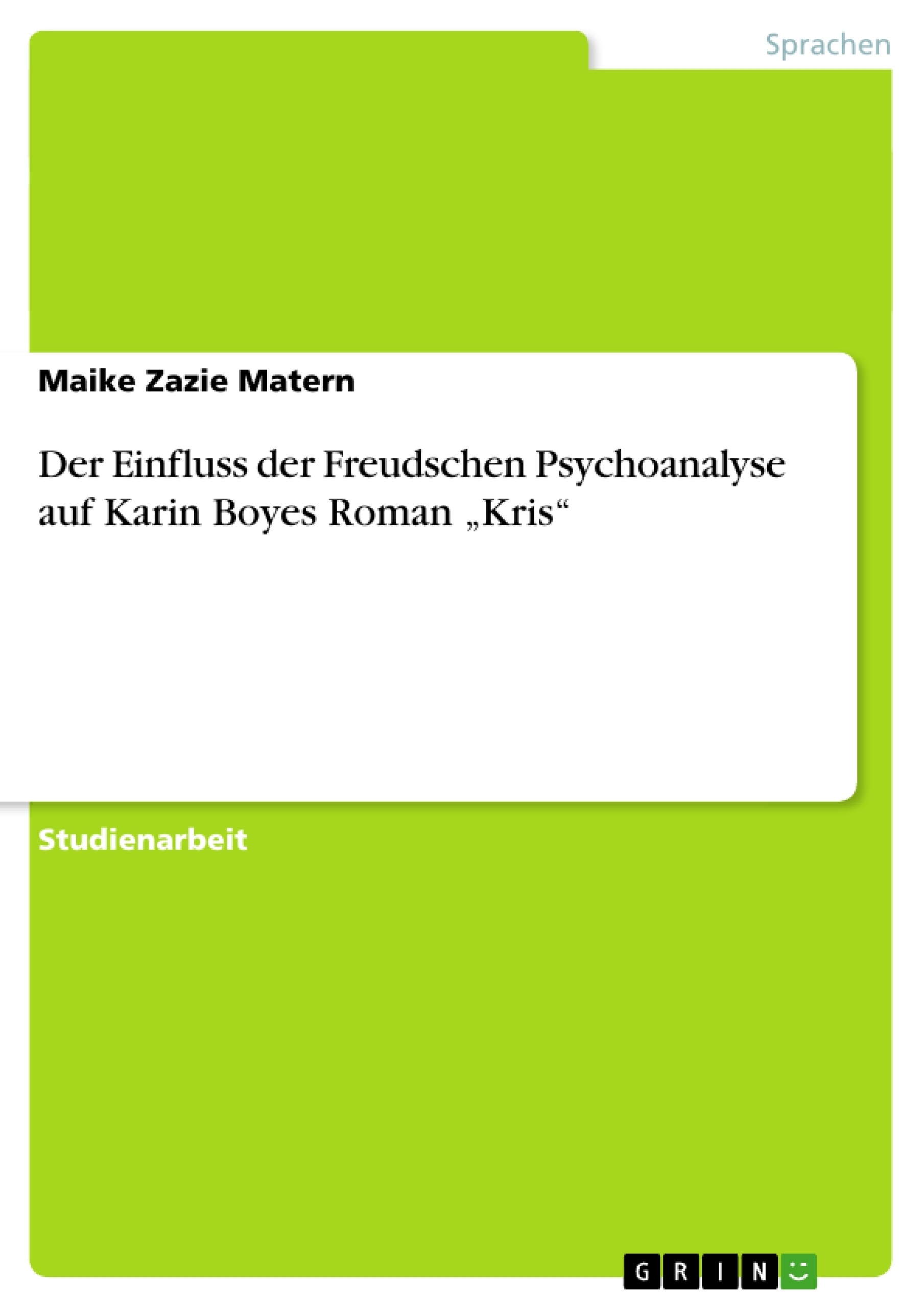Die Freudsche Psychoanalyse errang in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts große Popularität. Sie stellte eine Neuerung gegenüber der bisherigen Psychologie dar, in der der psychiatrische Krankheitsbegriff für soziales Fehlverhalten stand und Psychiatrien der Isolation gesellschaftlicher Außenseiter dienten. Bei Freud wurde der psychisch Kranke zum ernst zu nehmenden Subjekt, die Psychologie zu seinen Gunsten praktisch anwendbar. Überdies ließ sich das Freudsche Menschenbild in weitere Bereiche wie Politik, Kulturkritik und Kunst übertragen. Der Surrealismus griff die Traumdeutung auf, um sie in der Kunst anzuwenden.
Die schwedische Modernistin Karin Boye fand großes Interesse an Freud. Erste Einflüsse der Tiefenpsychologie finden sich bereits in ihren frühen Gedichten der 20er Jahre. Die Psychoanalyse war eine Antwort auf ihre zwischen Gesellschaft und eigenen Bedürfnissen hin- und her gerissene Persönlichkeit. Der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Wolfgang Butt nannte ihre Gedichte „Befreiungsakte“. In ihrem autobiographischen Roman „Kris“ setzte sich Karin Boye am intensivsten mit der Psychoanalyse auseinander. Der Roman ist eine Art Selbstanalyse, in der sie versuchte persönliche Konflikte, auf ihre Protagonistin übertragen, distanziert zu betrachten und zu analysieren. Sie ging auf den Freudschen Entwicklungsprozess ein, nach dem das Mädchen unter anderem „Kastration“ und „Penisneid“ verfällt, wandte die Traumdeutung an, manifestierte in der Protagonistin streitende Stimmen nach dem Freudschen Modell von Ich, Es und Über-Ich und ergänzte dies durch den Dialog mit sozialen Faktoren wie Eltern und Erziehern, in dem sich dieselben Muster finden. Die Darstellung machte die Hinterfragung der krankmachenden Faktoren und die Forcierung der Heilung möglich. Ebenfalls finden sich die Einflüsse der Tiefenpsychologie auf sprachlicher Ebene. Kultur und Gesellschaft stellten sich auf persönlicher als auch künstlerischer Ebene als die das Individuum schwächenden Faktoren dar.
Inhaltsverzeichnis
- (1.) Einleitung
- (2.) Die Psychoanalyse und die schwedische Kulturdebatte
- (3.) Karin Boye und das Freudsche Menschenbild
- (4.) Der Roman als Therapie
- (4.1.) Einführung in die Freudschen Theorie
- (4.2.) Malins Ich-Spaltung: Die Stimmen Malin 1 und Malin 2
- (4.3.) Der Schachklub der Mächte
- (4.4.) Malins Träume
- (4.5.) Die Tischsituation der Familie Forst
- (4.6.) Das Über-Ich Christentum
- (4.7.) „Nyskapelsens under“
- (5.) Sprache des Unbewussten
- (6.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Freudschen Psychoanalyse auf Karin Boyes Roman „Kris“. Sie analysiert die Verwendung psychoanalytischer Konzepte im Roman und zeigt, wie Boye die Freudschen Theorien nutzt, um die psychischen Konflikte ihrer Protagonistin Malin Forst zu erforschen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Bedeutung der Psychoanalyse für die Interpretation von „Kris“ aufzuzeigen.
- Die Einbindung der Freudschen Psychoanalyse in die schwedische Kulturdebatte der 1920er und 1930er Jahre
- Karin Boyes persönlicher Bezug zur Psychoanalyse und ihre Auseinandersetzung mit dem Freudschen Menschenbild
- Die Verwendung psychoanalytischer Konzepte in „Kris“ zur Darstellung von Malins Ich-Spaltung, ihren Träumen und ihren Beziehungen zu ihrer Familie und Umgebung
- Die Rolle der Sprache als Ausdruck des Unbewussten im Roman
- Die therapeutische Funktion des Romans für Karin Boye
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Freudschen Psychoanalyse für die damalige Zeit und geht auf Karin Boyes persönliches Interesse an der Tiefenpsychologie ein. Kapitel 2 analysiert den kulturellen Kontext, in dem der Roman entstand, und zeigt, wie die schwedische Kulturdebatte der 1920er und 1930er Jahre die Psyche der Protagonistin Malin Forst prägte. Kapitel 3 beschreibt Karin Boyes Auseinandersetzung mit dem Freudschen Menschenbild und ihre Suche nach Heilung für ihre eigene gespaltene Persönlichkeit. Kapitel 4 widmet sich der Darstellung der Psychoanalyse im Roman „Kris“ und untersucht die Anwendung freudianischer Konzepte wie Ich-Spaltung, Träume, Über-Ich und die Rolle der Familie. Kapitel 5 analysiert die Sprache des Romans und zeigt, wie sie als Ausdruck des Unbewussten zu verstehen ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Freudschen Psychoanalyse, der schwedischen Kulturdebatte der 1920er und 1930er Jahre, dem Roman „Kris“ von Karin Boye, dem Menschenbild Sigmund Freuds, der Ich-Spaltung, dem Über-Ich, dem Unbewussten und der Sprache als Ausdruck des Unbewussten.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Freud Karin Boyes Roman „Kris“?
Boye nutzt Freuds Konzepte wie die Ich-Spaltung (Ich, Es, Über-Ich), die Traumdeutung und den Entwicklungsprozess, um die psychischen Konflikte ihrer Protagonistin Malin Forst zu analysieren.
Ist „Kris“ ein autobiographischer Roman?
Ja, der Roman gilt als eine Art Selbstanalyse, in der Karin Boye versucht, eigene Konflikte distanziert zu betrachten und durch die Literatur zu verarbeiten.
Welche Rolle spielt das Über-Ich im Roman?
Das Über-Ich wird im Roman oft durch soziale Faktoren wie Eltern, Erzieher und das Christentum dargestellt, die das Individuum einschränken und Krankheiten forcieren können.
Was bedeutet „Sprache des Unbewussten“ bei Boye?
Die Arbeit untersucht, wie sich tiefenpsychologische Einflüsse auf der sprachlichen Ebene des Romans manifestieren und das Unbewusste zum Ausdruck bringen.
Wie wurde die Psychoanalyse in der schwedischen Kulturdebatte aufgenommen?
In den 1920er und 30er Jahren bot die Psychoanalyse neue Antworten auf soziale Fehlentwicklungen und wurde von Modernisten wie Boye als Werkzeug der Befreiung genutzt.
- Arbeit zitieren
- M.A. Maike Zazie Matern (Autor:in), 2007, Der Einfluss der Freudschen Psychoanalyse auf Karin Boyes Roman „Kris“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207570