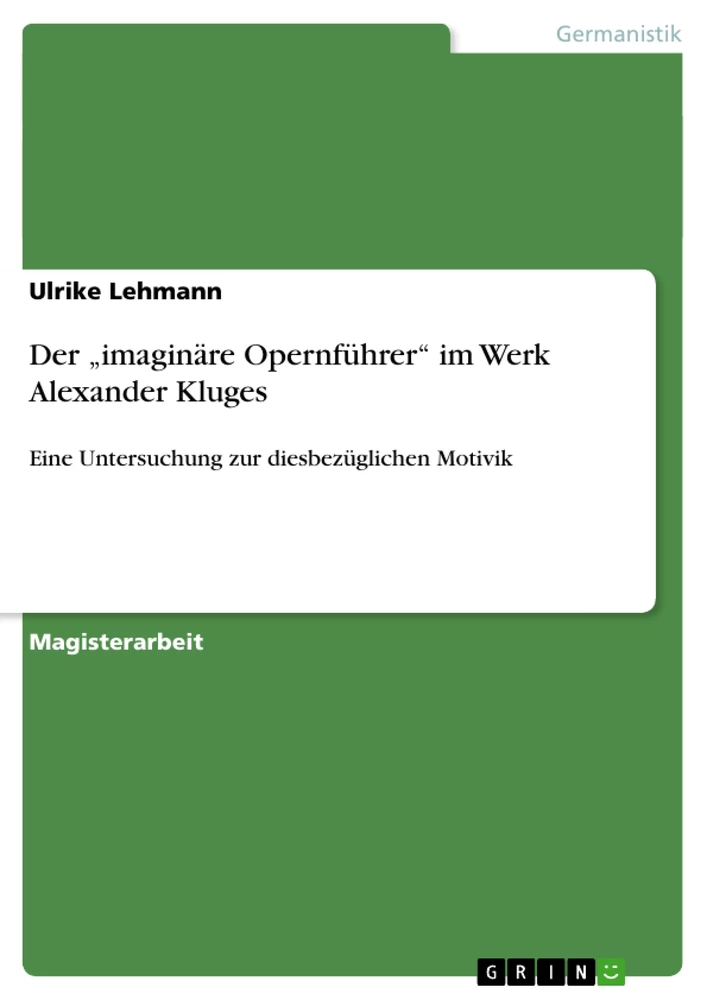Spätestens seit seinem Mammutwerk „Chronik der Gefühle“ (2000) ist der Jurist, Historiker, Fernsehproduzent, Regisseur und Dramatiker Alexander Kluge auch als Autor zurück im kollektiven Bewusstsein der literarisch-interessierten Öffentlichkeit. Dabei umfasst sein Werk ein breites Themenspektrum (Geschichte, Soziologie, Literatur, Musikgeschichte, Psychologie, etc.), das der gebürtige Halberstädter oft bewusst fragmentarisch zwischen Fiktion und Wissenschaft aufarbeitet.
An der Oper als „Kraftwerk der Gefühle“ hat Alexander Kluge als Sohn eines Opernarztes stets besonderes Interesse gezeigt. Die vorliegende Magisterarbeit untersucht daher sein Projekt, einen „imaginären Opernführer“ zu schaffen. Dieser stellt eine Art Konstrukt im Gesamtwerk des Autors dar, ist kein herkömmlicher, festgeschriebener Opernführer sondern ein flexibles, teils fiktives Puzzle aus Text-, Fernseh- und Theaterbausteinen.
Kluges „imaginärer Opernführer“ soll neben bereits komponierten Werken auch solche verzeichnen, die den zukünftigen Erfahrungsgehalt unserer Zeit widerspiegeln. Dabei verfolgt der Autor eine „Entdramatisierung“ der Oper, um dem durch die Übermacht menschlicher Emotionen ausgelösten, meist tragischen Opernfinale eine glückliche Alternative entgegenzusetzen. Kluges Verständnis von der Oper als ein „Kraftwerk der Gefühle“, das seit Bestehen der Gattung den emotionalen Erfahrungsgehalt der Menschheit abbildet, ist hierfür entscheidend.
Innerhalb der Magisterarbeit werden ausgewählte Texte aus den Bänden „Chronik der Gefühle“ (2000), „Herzblut trifft Kunstblut“ (2001) und „Die Lücke, die der Teufel lässt“ (2005) interpretiert und anhand ausgewählter inhaltlicher Kriterien dem „Imaginären Opernführer“ zugeschrieben. Dabei wird deutlich, wie Alexander Kluge die jeweiligen Opernlibretti („Tosca“, „Tristan und Isolde“, „Der fliegende Holländer“, etc.), literarisch verarbeitet und weiterführt, um seinem Ziel einer „Entdramatisierung“ der Oper näher zu kommen.
Theoretische Grundlagen für die literarische Analyse bilden die Nähe der Gattung Oper zur Tragödie, die stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten zur Affektdarstellung innerhalb der Gattung Oper sowie Kluges Affektbegriff.
Ein Ausblick deutet Alexander Kluges Visionen von Oper im 21.Jahrhundert und zeigt Tendenzen der medialen Verarbeitung dieser Gattung auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kluge und das „Phänomen der Oper“
- Der Gefühlsbegriff Kluges: Die Oper als „Kraftwerk der Gefühle“
- Oper und Tragödie
- Oper und Gefühle
- Resümee
- Hauptteil: Oper im literarischen Werk Kluges
- Über Kluges Projekt: „Der imaginäre Opernführer“
- Die Analyse der opernthematischen Texte im Werk Kluges
- Kluges geforderte „Entdramatisierung“ der Oper
- Textanalyse zur Analogie zwischen Opernlibretto und realem Leben
- Oper im Zweiten Weltkrieg
- Schluss
- ,,Authentizität ist kein Idol der Oper?“
- Ausblick: Die Oper im 21. Jahrhundert für Kluge
- Zusammenfassung: „Die Bauweise von Paradiesen“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit analysiert die Oper als zentrales Motiv im Werk Alexander Kluges. Ziel ist es, Kluges Verständnis des „Phänomens der Oper“ und dessen Bedeutung im Kontext seines Gesamtwerks aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht insbesondere die Beziehung zwischen Oper und Gefühl, die Rolle der Oper in Kluges literarischen Texten sowie die Relevanz der Oper für Kluges Konzept eines „imaginären Opernführers“.
- Kluges „imaginärer Opernführer“ als Konzept
- Die Oper als „Kraftwerk der Gefühle“
- Die Analyse opernthematischer Texte in Kluges Werk
- Die Beziehung zwischen Opernlibretto und realem Leben
- Die Rolle der Oper in Kluges medialer Produktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt zunächst in Kluges Verständnis des „Phänomens der Oper“ ein, wobei insbesondere der emotionale Gehalt der Oper thematisiert wird. Die Analyse der opernthematischen Texte im Werk Kluges umfasst mehrere Aspekte: die „Entdramatisierung“ der Oper in Kluges Werk, die Analogie zwischen Opernlibretto und realem Leben sowie die Verwendung der Oper im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf die Bedeutung der Oper im 21. Jahrhundert für Kluge und einer Zusammenfassung der Kernaussagen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Alexander Kluge, Oper, Gefühl, „imaginärer Opernführer“, Entdramatisierung, Opernlibretto, reales Leben, Medien, Literatur, Film, Geschichte, Emotionen, Kunst, Kultur, Authentizität.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Lehmann (Autor:in), 2009, Der „imaginäre Opernführer“ im Werk Alexander Kluges, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207733