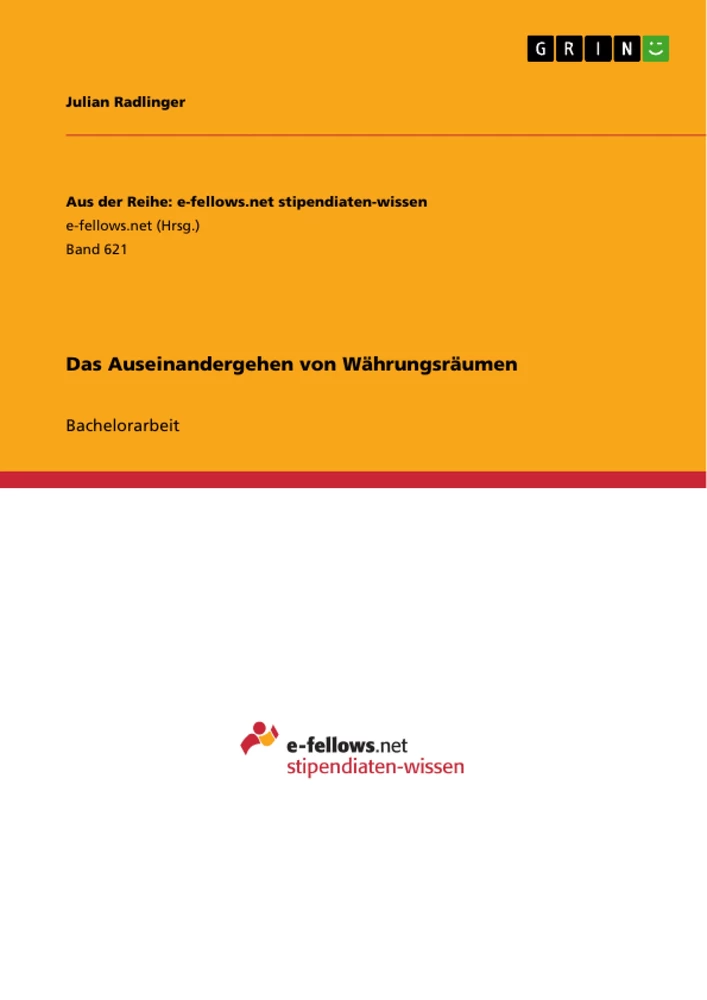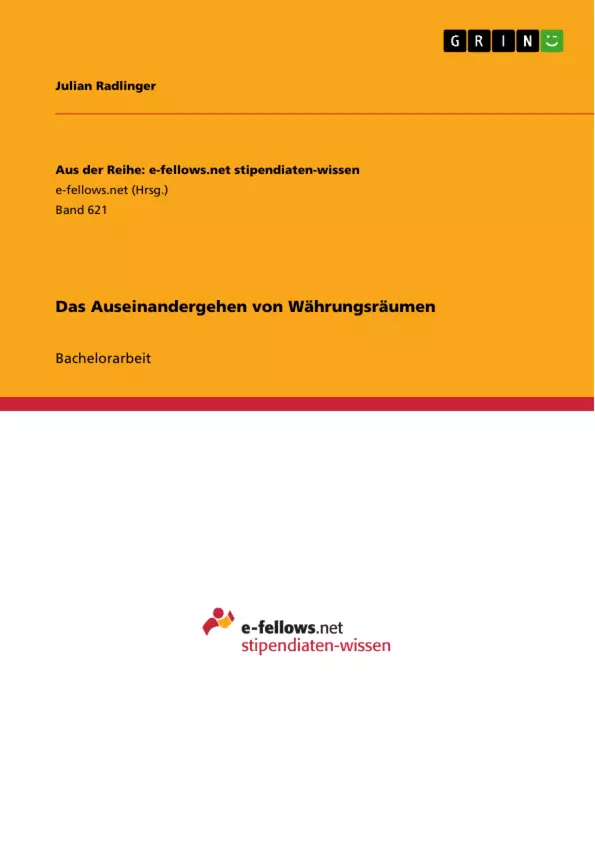Es lässt sich kaum bestreiten, dass die Gründung der Eurozone eines der ambitioniertesten internationalen Projekte der letzten 20 Jahre war. Kaum ein Jahrzehnt nach der Einführung der gemeinsamen Währung befindet sich das Projekt in einer derart tiefgründigen Krise, dass Robert Zoellick, der Präsident der Weltbank, jüngst in einem Interview mit der Zeitschrift DER SPIEGEL die Frage nach den Folgen eines Austritts Griechenlands mit einem ernüchternden „Niemand weiß das.“ beantwortete. Volkswirtschaftlern wird nachgesagt, Krisen nicht vorherzusehen, sie im Nachhinein aber als unvermeidbar zu bezeichnen. Die Eurokrise ist eine klare Ausnahme. Mahnungen über die Gefahren einer europäischen Währungsunion kamen in den 90er Jahren aus der Wissenschaft und der Politik und es überrascht nicht, dass viele jener Personen in den aktuellen Ereignissen Bestätigung finden.
Zweifelsohne wichtiger ist die Frage nach den Auswirkungen eines Zusammenbruchs der Eurozone. Wenngleich ein isolierter Austritt Griechenlands noch quantifizierbar ist, so wäre der Austritt mehrerer Länder aus der Eurozone oder ein vollkommener Zusammenbruch jedoch ein deutlich komplexeres Phänomen. Die Lehren, die aus historischen Präzedenzfällen gezogen werden, verlieren schnell an Sinnhaftigkeit, wenn eine Wechselkurs- anstatt eine Währungsunion als Vergleichsbeispiel herangezogen wird. Ebenso sollten reine Simulationen aufgrund der Einzigartigkeit der Eurozone stets kritisch hinterfragt werden. Daher werden in dieser Arbeit zwei Fälle im letzten Jahrhundert untersucht, in denen tatsächlich eine gemeinsame Währung aufgegeben wurde: Der Zusammenbruch des Österreichisch-Ungarischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg sowie der Zerfall der Tschechoslowakei im Jahre 1993. Trotz wichtiger Unterschiede bieten die Ähnlichkeiten zur Eurozone – wirtschaftlich starke Währungsräume mit einer gemeinsamen Papierwährung, einer gemeinsamen Zentralbank und mindestens zwei souveränen Mitgliedsländern – die Möglichkeit, einige relevante Schlüsse in Hinblick auf unsere heutige Situation zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GRUNDLAGEN
- 2.1 Begriffsdifferenzierung
- 2.2 Ein historischer Überblick
- 2.3 Theoretische Grundlagen
- 3. DAS AUSEINANDERGEHEN DER KRONENZONE
- 3.1 Ausgangslage
- 3.2 Ursachen und Ablauf
- 3.2.1 Austritt der Tschechoslowakei
- 3.2.2 Austritt Österreichs
- 3.3 Folgen
- 3.3.1 Monetäre Folgen
- 3.3.2 Wirtschaftliche Folgen
- 3.4 Implikationen
- 4. DAS AUSEINANDERGEHEN DER TSCHECHOSLOWAKEI
- 4.1 Ausgangslage
- 4.2 Ursachen
- 4.3 Ablauf
- 4.3.1 Zweifel an der Währungsunion
- 4.3.2 Währungstrennung
- 4.4 Folgen
- 4.4.1 Stabilisierungsmaßnahmen
- 4.4.2 Entwicklung in den Republiken
- 4.5 Implikationen
- 5. LEHREN FÜR DIE EUROZONE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenbruch von Währungsräumen in der Vergangenheit, um Erkenntnisse für die aktuelle Situation der Eurozone zu gewinnen. Sie analysiert zwei historische Beispiele: die Auflösung des Österreichisch-Ungarischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg und den Zerfall der Tschechoslowakei im Jahr 1993. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen, den Ablauf und die Folgen des Auseinandergehens dieser Währungsunionen, wobei die Unterschiede zwischen der Auflösung einer reinen Wechselkursunion und dem Zusammenbruch einer gemeinsamen Währung im Vordergrund stehen.
- Die inhärente Instabilität von Währungsunionen
- Die Gefahr eines selbstverstärkenden Austrittswettlaufs
- Kosteneffiziente und geordnete Währungstrennung
- Die Rolle von politischen und wirtschaftlichen Faktoren bei der Desintegration von Währungsunionen
- Lehren für die Eurozone aus historischen Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, in der die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Eurokrise herausgestellt wird. Kapitel 2 liefert die theoretischen und historischen Grundlagen für die Analyse. Kapitel 3 beleuchtet den Zerfall der Kronenzone, die aus Österreich-Ungarn hervorging, und analysiert Ursachen, Ablauf und Folgen des Austritts der Tschechoslowakei und Österreichs aus der Währungsunion. Kapitel 4 untersucht die Desintegration der Tschechoslowakei, wobei die Gründe für die Währungstrennung und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die neu entstandenen Republiken Tschechien und Slowakei im Vordergrund stehen. Kapitel 5 zieht Schlussfolgerungen für die Eurozone aus den gewonnenen Erkenntnissen und diskutiert die Bedeutung der historischen Beispiele für die Zukunft der gemeinsamen Währung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Währungsunionen, Desintegration, Austrittswettlauf, politische und wirtschaftliche Folgen, historische Beispiele, Österreichisch-Ungarische Monarchie, Tschechoslowakei, Eurozone, Eurokrise. Die Arbeit analysiert die Ursachen, den Ablauf und die Folgen von Währungstrennungen und zieht Parallelen zum aktuellen Geschehen in der Eurozone.
Häufig gestellte Fragen
Was lässt sich aus historischen Währungstrennungen lernen?
Die Arbeit zieht Schlüsse aus dem Zerfall der Kronenzone (Österreich-Ungarn) und der Tschechoslowakei für die heutige Stabilität der Eurozone.
Was war der "Austrittswettlauf" in der Kronenzone?
Es beschreibt den Prozess, bei dem einzelne Länder der zerfallenden Monarchie überstürzt eigene Währungen einführten, um sich vor Inflation zu schützen.
Wie verlief die Währungstrennung der Tschechoslowakei 1993?
Im Gegensatz zu 1918 war dies ein geordneter Prozess, der zeigt, dass eine Trennung souveräner Staaten auch wirtschaftlich stabil ablaufen kann.
Warum sind Währungsunionen inhärent instabil?
Die Arbeit beleuchtet die Spannungen zwischen gemeinsamer Geldpolitik und nationaler Fiskalpolitik als Hauptursache für Krisen.
Welche monetären Folgen hat ein Zusammenbruch eines Währungsraums?
Dazu gehören massive Wechselkursschwankungen, Kapitalflucht und die Notwendigkeit schneller Stabilisierungsmaßnahmen durch neue Zentralbanken.
- Quote paper
- Julian Radlinger (Author), 2012, Das Auseinandergehen von Währungsräumen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207752