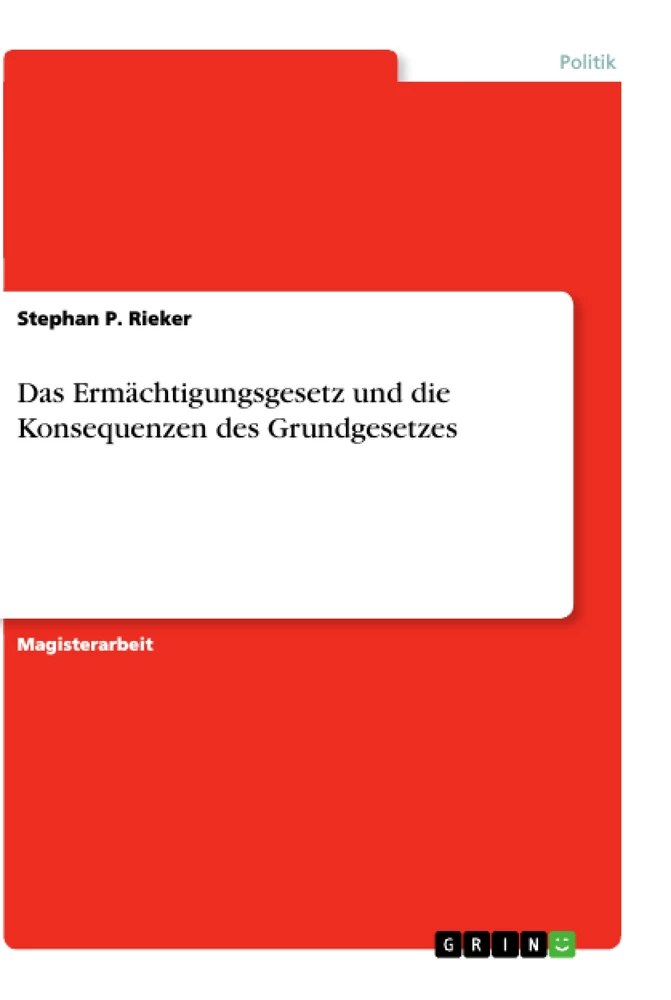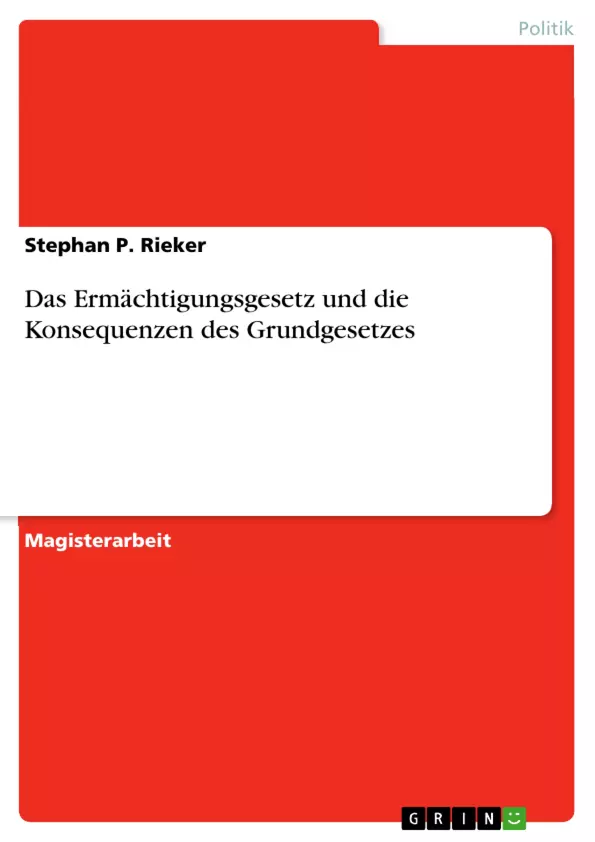Jede Verfassungsgebung wird mitbestimmt von den Erfahrungen der unmittelbaren staatlichen Vergangenheit, und zwar um so stärker, je unglücklicher diese Vergangenheit war. Die Beratungen des Parlamentarischen Rates, der vom 1. September 1948 bis 8. Mai 1949 in Bonn das Grundgesetz für die entstehende Bundesrepublik Deutschland ausarbeitete, wurden deshalb dominiert von den Erfahrungen mit dem unglücklichen Ende der Weimarer Republik . Denn die nationalsozialistische Diktatur kam nicht durch einen blutigen Umsturz, sie kam auf der Grundlage eines Gesetzes, das vom Deutschen Reichstag am 23. März 1933 verabschiedet und vom Reichspräsidenten ordnungsgemäß ausgefertigt wurde. Mit dem Gesetz zur Behebung der Not von Staat und Volk vom 24. März 1933 , das schon damals besser als Ermächtigungsgesetz bekannt war , wurde die seit 30. Januar 1933 amtierende Reichsregierung Hitler vom Reichstag ermächtigt, ohne Zustimmung des Reichstages oder des Reichsrates und ohne Gegenzeichnung durch den Reichspräsidenten Gesetze zu erlassen. An die Stelle von Demokratie und Rechtstaatlichkeit traten auf der Grundlage eines Gesetzes, das von der zeitgenössischen Staatsrechtslehre als legal angesehen wurde , Willkür- und Terrorherrschaft.
Besonders dieses äußerlich legale Hinübergleiten des deutschen Verfassungszustandes in die totalitäre Diktatur führte in den Beratungen des Parlamentarischen Rates zu einer tiefen Ablehnung der Weimarer Reichsverfassung, der man Versagen vorwarf . Eine Demokratie, welche die Tyrannis so widerstandslos aus sich heraus entlassen habe, sei es nicht wert, noch einmal geschaffen zu werden, lautete das vernichtende Urteil des Parlamentarischen Rates. Das Ergebnis waren umfangreiche Sicherungen gegen Machtmissbrauch und Entgleisung des politischen Systems, die man nur verstehen kann, wenn man die historische Situation von 1948/1949 bedenkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG: WEIMARS LANGER SCHATTEN
- 2 DAS ERMÄCHTIGUNGSGESETZ VOM 24. MÄRZ 1933
- 2.1 DEUTSCHLAND ZWISCHEN 1929 UND 1933 – EINE REPUBLIK IN AUFLÖSUNG
- 2.2 MACHTÜBERNAHME - AUF DEM WEG IN DIE DIKTATUR
- 2.3 DAS ERMÄCHTIGUNGSGESETZ VOM 24. MÄRZ 1933
- 2.4 ERMÄCHTIGUNGSGESETZ UND WEIMARER REICHSVERFASSUNG
- 2.5 DIE AUSWIRKUNGEN DES ERMÄCHTIGUNGSGESETZES
- 2.6 ZUSAMMENFASSUNG
- 3 DIE KONSEQUENZEN DES GRUNDGESETZES
- 3.1 DIE ENTSTEHUNG DES GRUNDGESETZES
- 3.2 WEIMARER REICHSVERFASSUNG UND GRUNDGESETZ
- 3.2.1 ENTSCHEIDUNG FÜR DEN MATERIALEN RECHTSSTAAT
- 3.2.2 ÜBERWINDUNG DER STRUKTURELLEN SCHWÄCHEN DER WRV
- 3.3 DIE WERTORIENTIERTE UND WEHRHAFTE DEMOKRATIE DES GRUNDGESETZES
- 3.4 DIE INSTITUTE ZUR SICHERUNG DES GRUNDGESETZES
- 3.4.1 DER BESTANDSSCHUTZ DES GRUNDGESETZES
- 3.4.2 DIE SICHERUNGEN DER „FREIHEITLICHEN DEMOKRATISCHEN GRUNDORDNUNG”
- 3.5 ZUSAMMENFASSUNG
- 4 SCHLUSSBETRACHTUNG: DIE FREIHEITLICHSTE DEUTSCHE VERFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen des Ermächtigungsgesetzes von 1933 und die Konsequenzen, die sich aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ergeben haben. Ziel ist es, die historischen und verfassungsrechtlichen Zusammenhänge aufzuzeigen und die Unterschiede zwischen beiden Rechtsordnungen herauszustellen.
- Der Weg zur Diktatur und die Rolle des Ermächtigungsgesetzes
- Vergleich der Weimarer Reichsverfassung und des Grundgesetzes
- Die Bedeutung des materiellen Rechtsstaats im Grundgesetz
- Die Sicherung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
- Die Entwicklung des deutschen Verfassungsrechts nach 1945
Zusammenfassung der Kapitel
1 EINLEITUNG: WEIMARS LANGER SCHATTEN: Die Einleitung legt den Fokus auf den langen Schatten der Weimarer Republik und ihrer Schwächen, die den Weg für den Aufstieg des Nationalsozialismus ebneten. Sie dient als Brücke zwischen der instabilen Demokratie der Weimarer Zeit und dem Bemühen der Bundesrepublik, diese Fehler zu vermeiden. Es wird auf die Bedeutung der historischen Analyse für das Verständnis des Grundgesetzes hingewiesen.
2 DAS ERMÄCHTIGUNGSGESETZ VOM 24. MÄRZ 1933: Dieses Kapitel analysiert das Ermächtigungsgesetz in seinem historischen Kontext. Es untersucht die politische und wirtschaftliche Lage Deutschlands in den Jahren vor 1933, die Machtübernahme der NSDAP und den Prozess des Erlasses des Gesetzes. Die Kapitel untersuchen detailliert den Inhalt des Ermächtigungsgesetzes und seine verfassungsrechtliche Bedeutung. Im Mittelpunkt steht die Analyse, wie das Gesetz die Weimarer Verfassung aushöhlte und die Voraussetzungen für die Errichtung einer Diktatur schuf. Die Analyse der Auswirkungen des Gesetzes zeigt die schrittweise Aushöhlung demokratischer Institutionen und die zunehmende Unterdrückung der Opposition.
3 DIE KONSEQUENZEN DES GRUNDGESETZES: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung des Grundgesetzes und seinen zentralen Prinzipien. Es vergleicht das Grundgesetz mit der Weimarer Reichsverfassung und hebt die Maßnahmen hervor, die im Grundgesetz getroffen wurden, um die strukturellen Schwächen der Weimarer Verfassung zu überwinden. Der Fokus liegt dabei auf der Etablierung eines materiellen Rechtsstaats und der Stärkung der demokratischen Institutionen. Das Kapitel untersucht, wie das Grundgesetz die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sichern versucht und welche Institutionen dafür geschaffen wurden. Die Analyse der Sicherungen der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ ist ein zentraler Bestandteil dieses Kapitels. Es wird herausgearbeitet, wie das Grundgesetz versucht, die Fehler der Weimarer Republik zu vermeiden und eine stabile Demokratie zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Ermächtigungsgesetz, Weimarer Reichsverfassung, Grundgesetz, materieller Rechtsstaat, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Diktatur, Demokratie, Nationalsozialismus, Verfassungsrecht, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Das Ermächtigungsgesetz von 1933 und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Auswirkungen des Ermächtigungsgesetzes von 1933 und die daraus resultierenden Konsequenzen für das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die historischen und verfassungsrechtlichen Zusammenhänge und hebt die Unterschiede zwischen beiden Rechtsordnungen hervor.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Weg zur Diktatur und die Rolle des Ermächtigungsgesetzes, einen Vergleich der Weimarer Reichsverfassung und des Grundgesetzes, die Bedeutung des materiellen Rechtsstaats im Grundgesetz, die Sicherung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Entwicklung des deutschen Verfassungsrechts nach 1945.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die den Fokus auf die Schwächen der Weimarer Republik legt; ein Kapitel über das Ermächtigungsgesetz von 1933, das dessen historischen Kontext, Inhalt und verfassungsrechtliche Bedeutung analysiert; ein Kapitel über die Konsequenzen des Grundgesetzes, welches dessen Entstehung, Prinzipien und den Vergleich mit der Weimarer Verfassung behandelt; und abschließend eine Schlussbetrachtung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung betont den „langen Schatten“ der Weimarer Republik und deren Schwächen, die den Aufstieg des Nationalsozialismus ermöglichten. Sie dient als Brücke zwischen der instabilen Weimarer Demokratie und dem Bemühen der Bundesrepublik, diese Fehler zu vermeiden, und unterstreicht die Bedeutung der historischen Analyse für das Verständnis des Grundgesetzes.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels zum Ermächtigungsgesetz?
Dieses Kapitel analysiert das Ermächtigungsgesetz im historischen Kontext, untersucht die politische und wirtschaftliche Lage Deutschlands vor 1933, die Machtübernahme der NSDAP und den Erlass des Gesetzes. Es analysiert den Inhalt des Gesetzes, seine verfassungsrechtliche Bedeutung, seine Rolle bei der Aushöhlung der Weimarer Verfassung und der Errichtung der Diktatur, sowie die schrittweise Aushöhlung demokratischer Institutionen und die Unterdrückung der Opposition.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zu den Konsequenzen des Grundgesetzes?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung des Grundgesetzes und seinen zentralen Prinzipien. Es vergleicht es mit der Weimarer Reichsverfassung, hebt Maßnahmen zur Überwindung der strukturellen Schwächen der Weimarer Verfassung hervor (insbesondere die Etablierung eines materiellen Rechtsstaats und die Stärkung demokratischer Institutionen), und untersucht, wie das Grundgesetz die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sichern versucht und welche Institutionen dafür geschaffen wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Ermächtigungsgesetz, Weimarer Reichsverfassung, Grundgesetz, materieller Rechtsstaat, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Diktatur, Demokratie, Nationalsozialismus, Verfassungsrecht, Rechtsgeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit will die historischen und verfassungsrechtlichen Zusammenhänge zwischen dem Ermächtigungsgesetz und dem Grundgesetz aufzeigen und die Unterschiede zwischen beiden Rechtsordnungen herausstellen.
- Quote paper
- Stephan P. Rieker (Author), 2008, Das Ermächtigungsgesetz und die Konsequenzen des Grundgesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207996