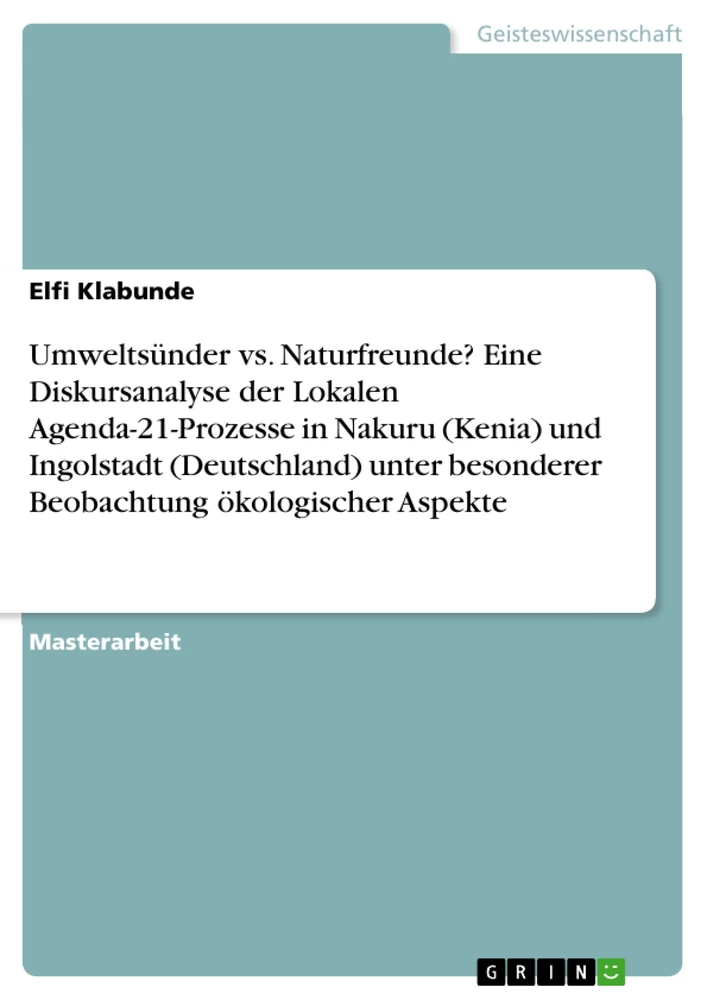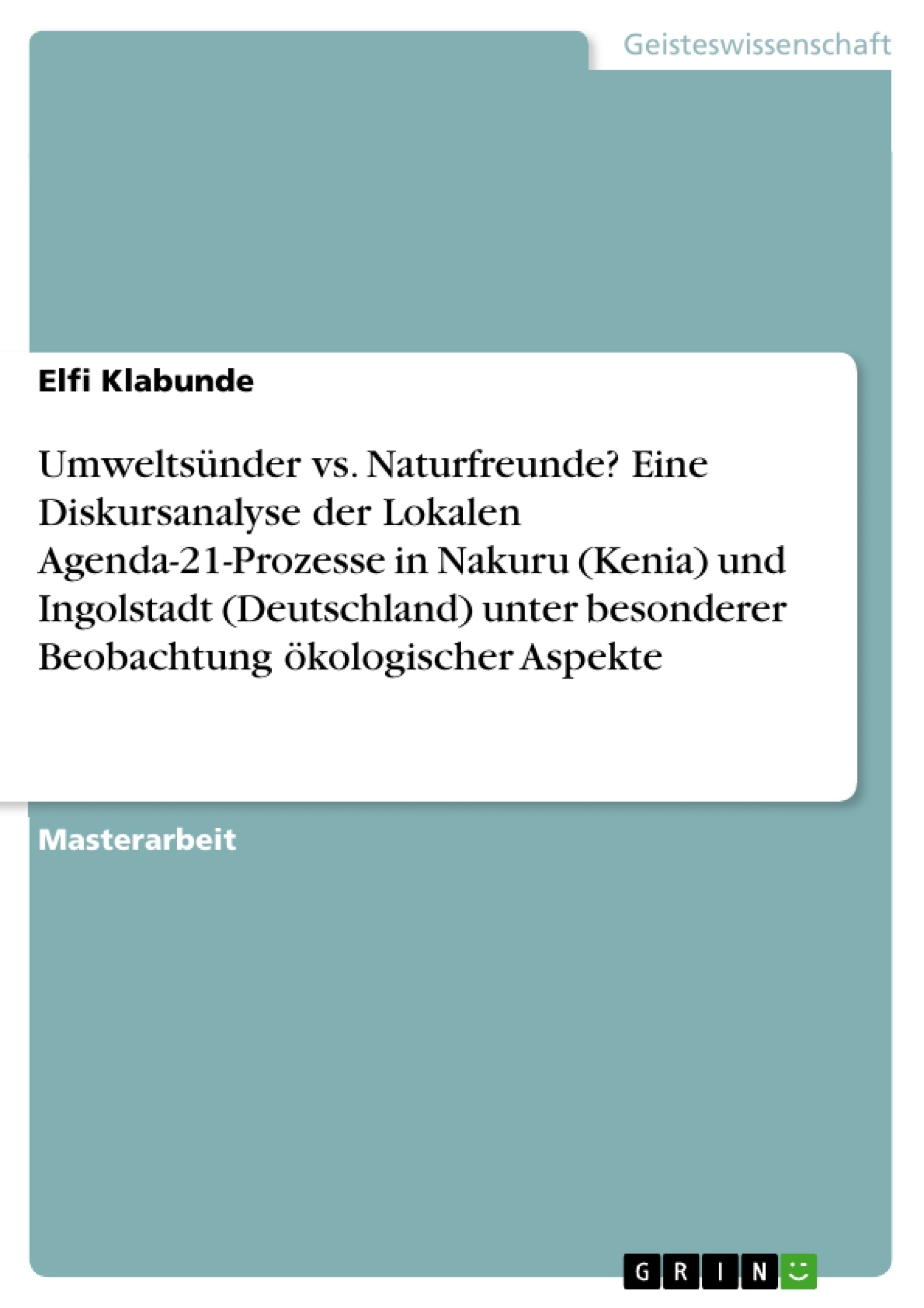Lokale Agenda-21 Prozesse werden häufig kategorisiert indem eine Trennung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern vorgenommen wird. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, ob eine solche generalisierende Kategorisierung haltbar ist. Insbesondere soll dabei erörtert werden, ob die ökologische Komponente de facto ein zentrales Anliegen von LA 21-Prozessen in Ländern des Nordens darstellt und die LA 21-Prozesse in Ländern des Südens von diesem Phänomen weitgehend ausgenommen werden können.
Eine Antwort auf diese Frage soll die Analyse der Aktionsprogramme zweier LA 21-Prozesse im bayerischen Ingolstadt und der Stadt Nakuru in Kenia basierend auf der von Michel Foucault geprägten Diskursanalyse liefern. Diese beiden Prozesse wurden ausgewählt, da sich Ingolstadt und Nakuru in einigen wichtigen Punkten ähneln: Beide Städte sind in etwa vergleichbar groß und stellen einen Wirtschaftsstandort von regionaler Bedeutung dar. Auch in einigen Themenschwerpunkten des LA 21-Prozesses lassen sich Gemeinsamkeiten identifizieren, beispielsweise in Bezug auf die Verbesserung der Wohnsituation und den Ausbau der Infrastruktur. Desweiteren gelten beide Prozesse als regionale Vorbilder. So war der LA 21-Prozess in Nakuru der erste Agenda 21-Prozess auf dem afrikanischen Kontinent und galt als Vorbild für viele weitere. In ähnlicher Weise, waren die ‚Visionen für Ingolstadt‘ ein Modellprojekt und stellten den Beitrag des Freistaats Bayern zum Weltgipfel in Johannesburg dar. Es galt desweiteren als Referenzprojekt für die 666 bayerischen lokalen Agenda 21-Prozesse.
Im letzten Satz der zu Beginn zitierten Präambel wird deutlich, wie stark die Agenda 21 vom Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung geprägt ist. Bevor die verschiedenen historischen Meilensteine auf dem Weg zur Agenda 21 nachverfolgt werden können, ist daher eine genauere Auseinandersetzung mit diesem Leitbild elementar. Im Anschluss daran soll die Erörterung der Entstehung und Bedeutung der (lokalen) Agenda 21 erfolgen. Hierbei soll der Schwerpunkt auf die Einnahme einer Nord-Süd-Perspektive gelegt werden.
Im zweiten Teil der Arbeit soll die Methode der Diskursanalyse genauer vorgestellt und auf die Fallbeispiele Ingolstadt und Nakuru angewandt werden. Abschließend gilt es, ein Fazit in Hinblick auf die Divergenzen und Konvergenzen von LA 21-Prozessen in Industrie- und Entwicklungsländern zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung und Problemdefinition
- 1.2 Fragestellung, Aufbau und Ziel der Arbeit
- 2. Der Mythos „Nachhaltige Entwicklung“: Wurzel der Agenda 21
- 2.1 Meilensteine auf dem Weg zur Agenda 21
- 2.1.1 „Unsere gemeinsame Zukunft“: Der Brundtland-Bericht
- 2.1.2 Der „Erdgipfel von Rio“: Geburtsstunde der Agenda 21
- 2.1.3 Die Agenda 21: „Softest of soft law“?
- 2.2 „Think global, act local“: Die lokale Agenda 21
- 2.2.1 Das Kapitel 28, Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21
- 2.2.2 Stand der Umsetzung
- 3. Methodische Grundlagen: Diskursanalyse nach Foucault
- 3.1 Macht und Wissen im Diskurs: Die Ursprünge bei Michel Foucault
- 3.2 Diskursanalyse in der Soziologie
- 4. Umweltschutz und Armutsbekämpfung: Verschiedene „Diskurse“ in LA 21-Prozessen in Industrie- und Entwicklungsländern
- 4.1 Hintergrundinformationen zu den beiden Prozessen
- 4.1.1 Ingolstadt: Städtewachstum und Artenschwund
- 4.1.2 Nakuru: Landflucht und wirtschaftlicher Einbruch
- 4.2 „Visionen für Ingolstadt“ und „Localizing Agenda 21“ in Nakuru – Kontextualisierung zweier Textkörper
- 4.3 Quantitative Analyse
- 4.4 Qualitative Analyse
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von lokalen Agenda 21-Prozessen in Industrie- und Entwicklungsländern. Sie analysiert, ob die ökologische Komponente tatsächlich ein zentrales Anliegen in Industrieländern darstellt und ob Prozesse in Entwicklungsländern davon abweichen. Die Analyse basiert auf einer vergleichenden Fallstudie der Städte Ingolstadt (Deutschland) und Nakuru (Kenia) unter Verwendung der Diskursanalyse nach Foucault.
- Vergleichende Analyse von lokalen Agenda 21-Prozessen in Ingolstadt und Nakuru.
- Untersuchung der unterschiedlichen Akzentuierungen in den lokalen Agenda 21-Prozessen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern.
- Anwendung der Diskursanalyse nach Foucault zur Interpretation der Daten.
- Bewertung der Rolle der ökologischen Komponente in den jeweiligen Prozessen.
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Ansätzen zur nachhaltigen Entwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Agenda 21 ein und beleuchtet die globalen Herausforderungen, die zu ihrer Entstehung führten. Sie beschreibt die anfänglichen optimistischen Erwartungen und stellt die anhaltende Relevanz der globalen Probleme dar. Ein zentraler Punkt ist die Frage nach der unterschiedlichen Gewichtung ökologischer Aspekte in Agenda 21-Prozessen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, welche die Forschungsfrage der Arbeit formuliert.
2. Der Mythos „Nachhaltige Entwicklung“: Wurzel der Agenda 21: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der Agenda 21, beginnend mit dem Brundtland-Bericht und der UNCED-Konferenz in Rio. Es analysiert den Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ und dessen Herausforderungen für die Umsetzung sowie den Charakter der Agenda 21 als „Soft Law“. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des „Think global, act local“-Ansatzes und der Bedeutung des Kapitels 28, welches die Rolle der Kommunen betont.
3. Methodische Grundlagen: Diskursanalyse nach Foucault: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Arbeit, die auf der Diskursanalyse nach Foucault basiert. Es erklärt die Konzepte von Macht und Wissen im Diskurs und deren Relevanz für die soziologische Forschung. Es begründet die Wahl der Diskursanalyse als geeignete Methode für die Analyse der lokalen Agenda 21-Prozesse.
4. Umweltschutz und Armutsbekämpfung: Verschiedene „Diskurse“ in LA 21-Prozessen in Industrie- und Entwicklungsländern: Dieses Kapitel präsentiert Hintergrundinformationen zu den beiden Fallstudien Ingolstadt und Nakuru, wobei die jeweiligen städtebaulichen und sozioökonomischen Herausforderungen im Kontext der Agenda 21 beleuchtet werden. Es vergleicht die „Visionen für Ingolstadt“ mit dem „Localizing Agenda 21“-Ansatz in Nakuru und analysiert quantitative und qualitative Daten, um die unterschiedlichen Diskurse zu identifizieren und zu vergleichen.
Schlüsselwörter
Lokale Agenda 21, Nachhaltige Entwicklung, Diskursanalyse, Foucault, Ingolstadt, Nakuru, Industrie- und Entwicklungsländer, Umweltschutz, Armutsbekämpfung, Globalisierung, „Think global, act local“, vergleichende Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse Lokaler Agenda 21 Prozesse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von lokalen Agenda 21-Prozessen in Industrie- und Entwicklungsländern. Im Fokus steht der Vergleich der ökologischen Komponente in diesen Prozessen anhand von Fallstudien in Ingolstadt (Deutschland) und Nakuru (Kenia).
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Diskursanalyse nach Michel Foucault, um die Daten aus den Fallstudien zu interpretieren und die unterschiedlichen Akzentuierungen in den lokalen Agenda 21-Prozessen zu analysieren.
Welche Städte werden im Vergleich untersucht?
Die Arbeit vergleicht die lokalen Agenda 21-Prozesse in Ingolstadt (Deutschland) als Beispiel einer Stadt in einem Industrieländer und Nakuru (Kenia) als Beispiel einer Stadt in einem Entwicklungsland.
Welche Aspekte der Agenda 21 werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die unterschiedliche Gewichtung ökologischer Aspekte im Vergleich zu sozioökonomischen Herausforderungen in den lokalen Agenda 21-Prozessen der beiden Fallstudienstädte. Es wird untersucht, ob die ökologische Komponente in Industrieländern ein zentrales Anliegen darstellt und ob Prozesse in Entwicklungsländern davon abweichen.
Welche historischen Wurzeln der Agenda 21 werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historischen Wurzeln der Agenda 21, beginnend mit dem Brundtland-Bericht und der UNCED-Konferenz in Rio. Der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“, die Herausforderungen bei der Umsetzung und der Charakter der Agenda 21 als „Soft Law“ werden analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den historischen Wurzeln der Agenda 21, ein Kapitel zur methodischen Grundlage (Diskursanalyse nach Foucault), ein Kapitel zum Vergleich der Fallstudien Ingolstadt und Nakuru (inklusive quantitativer und qualitativer Analyse) und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lokale Agenda 21, Nachhaltige Entwicklung, Diskursanalyse, Foucault, Ingolstadt, Nakuru, Industrie- und Entwicklungsländer, Umweltschutz, Armutsbekämpfung, Globalisierung, „Think global, act local“, vergleichende Fallstudie.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit (vorläufig)?
Das zentrale Ergebnis wird ein Vergleich der unterschiedlichen Diskurse und Akzentuierungen in den lokalen Agenda 21-Prozessen zwischen Ingolstadt und Nakuru sein. Die Arbeit wird zeigen, inwieweit die ökologische Komponente in den jeweiligen Kontexten eine Rolle spielt und wie sich die Ansätze zur nachhaltigen Entwicklung unterscheiden.
- Arbeit zitieren
- Elfi Klabunde (Autor:in), 2011, Umweltsünder vs. Naturfreunde? Eine Diskursanalyse der Lokalen Agenda-21-Prozesse in Nakuru (Kenia) und Ingolstadt (Deutschland) unter besonderer Beobachtung ökologischer Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208054