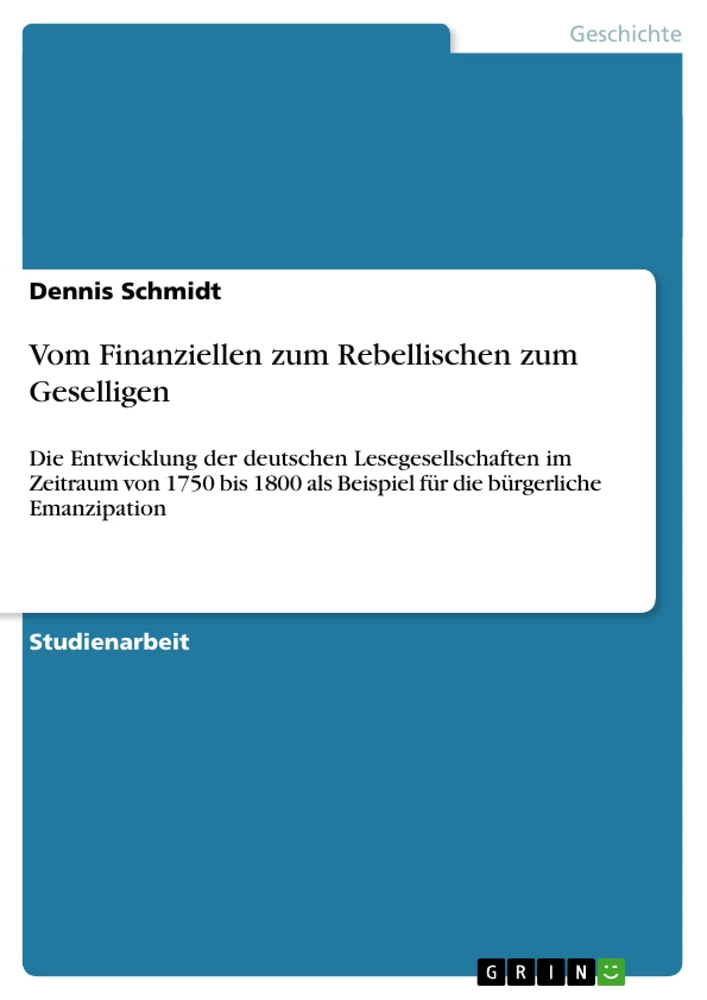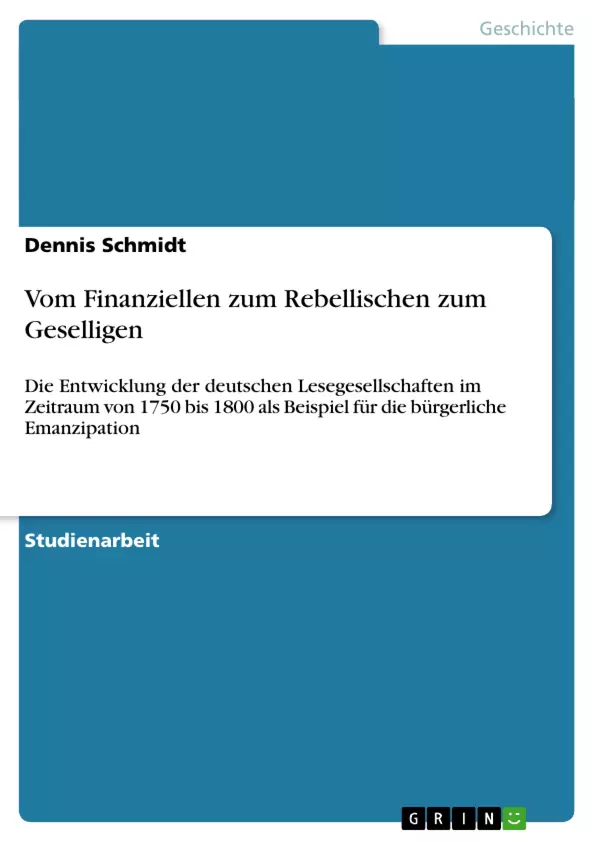Einleitung
Kitzingen im Jahr 1614. Die Honoratioren der Stadt entschließen sich aufgrund der teuren Anschaffungskosten, eine Zeitung in einem gemeinsamen Abonnement zu bestellen und somit die enormen Anschaffungskosten auf die Schultern von mehreren wohlhabenden Bürgern zu verteilen. Die ca. 15 Mitglieder, unter ihnen der Stadtvogt, fünf Pastoren, der Dekan, der Diakon, ein Ratsherr, ein Arzt, ein Advokat und der Schulmeister, geben sich noch im selben Jahr eine eigene Satzung, in der sie die genaue Umlaufzeit der Zeitung, die oft nicht mehr als eine Stunde beträgt, und die genaue Reihenfolge in der Verschickung festlegen. Der spiritus rector dieser Vereinugung ist der Postmeister Pankraz Müller, an den auch die Gebühren von einem halben Taler zu zahlen sind.1
Die „Zeitungskompagnie“ zu Kitzingen besteht nur zehn Jahre. Doch kann den Kitzingern attestiert werden, dass sie ihrer Zeit weit voraus waren. Die große Stunde der Lesegesellschaften, deren Sinn und Zweck es war, die hohen Kosten für (abstrakt formuliert, aber ganz im Sinne der aufgeklärten Bürger) Bildung so gering wie möglich zu halten, kam mit ihren vielfältigen Ausformungen und in ihren verschiedenen Stadien erst rund 150 Jahre später. Sie prägte für etwa ein halbes Jahrhundert die Zeit des ersten bürgerlichen Aufbegehrens gegen Adel und Klerus.
Um sich das Revolutionäre oder, weniger drastisch ausgedrückt, Neue an dieser Entwicklung klar zu machen, muss man sich auch die Verhältnisse in der ständisch geprägten Welt vor und um 1750 vor Augen führen (Abschnitt 1). Bildung, also grob gesagt die Kompetenz zum Lesen und Schreiben, lag im berufsspezifischem Metier der Akademiker und Literaten; der Umgang mit der Schrift und deren Beherrschung war lange Zeit das Privileg einiger Weniger, zumeist aus dem Klerus. Das moderne Bügertum allerdings setzte sich mit seinem Aufschwung, der dieser Zeit schließlich die Bezeichnung „bürgerliche Epoche“ gab, nicht nur als „ökonomische Führungsschicht, ... sondern auch als eine neue Bildungsschicht, als ein lesendes Publikum“2 durch, das sich von seinen Anfängen an organisierte. In dieser Hausarbeit soll im Folgenden eine Assoziations-Form dieser Emanzipation, die Lesegesellschaft, dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Die Gesellschaft vor 1750
- Veränderungen in der Gesellschaft
- Das Angebot
- Die Nachfrage
- Die bürgerliche Emanzipation am Beispiel der Lesegesellschaften
- Gründe
- Satzung
- Mitglieder
- Lektüre
- Ziele
- Politisierung
- Das Ende der Lesegesellschaften
- Staatliche Maßnahmen
- Leihbibliotheken
- Lesesucht- und Lesewut-Debatte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der deutschen Lesegesellschaften im Zeitraum von 1750 bis 1800. Dabei werden die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen dieser Zeit beleuchtet, die zum Aufkommen der Lesegesellschaften als Ausdruck der bürgerlichen Emanzipation führten.
- Die Rolle der Lesegesellschaften als Ausdruck der bürgerlichen Emanzipation
- Die verschiedenen Formen und Organisationsformen von Lesegesellschaften
- Die Bedeutung der Lesegesellschaften für die Verbreitung von Bildung und Wissen
- Die politischen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Lesegesellschaften
- Der Einfluss der Lesegesellschaften auf die Lesekultur und die Lesewut-Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt mit einer historischen Anekdote die Entwicklung der Lesegesellschaften ein und stellt die Relevanz des Themas für die bürgerliche Emanzipation in den Mittelpunkt. Im Anschluss werden verschiedene Formen und Definitionen von Lesegesellschaften vorgestellt.
Das Kapitel „Die Gesellschaft vor 1750“ analysiert den gesellschaftlichen Kontext vor dem Aufkommen der Lesegesellschaften und zeigt auf, wie Bildung und Zugang zu Wissen im vormodernen Zeitalter geprägt waren.
Das Kapitel „Die bürgerliche Emanzipation am Beispiel der Lesegesellschaften“ geht auf die Gründe für die Entstehung der Lesegesellschaften ein und beleuchtet die verschiedenen Aspekte dieser Vereine, von der Satzung über die Mitglieder bis hin zu den Zielen und der Rolle der Lektüre.
Das Kapitel „Das Ende der Lesegesellschaften“ analysiert die Gründe für das allmähliche Verschwinden der Lesegesellschaften in ihrer ursprünglichen Form.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die bürgerliche Emanzipation, Lesegesellschaften, Bildung, Wissen, Lektüre, Politisierung, Lesekultur, Lesesucht, Lesewut-Debatte, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ziele der Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert?
Hauptziel war es, die hohen Anschaffungskosten für Bücher und Zeitungen zu teilen und so Bildung für das aufstrebende Bürgertum erschwinglich zu machen.
Warum galten Lesegesellschaften als Ausdruck bürgerlicher Emanzipation?
Sie ermöglichten dem Bürgertum den Zugang zu Wissen, das zuvor Klerus und Adel vorbehalten war, und förderten den politischen Austausch und das bürgerliche Aufbegehren.
Wer war die "Zeitungskompagnie" zu Kitzingen?
Eine bereits 1614 gegründete Vereinigung von ca. 15 Honoratioren, die gemeinsam Zeitungen abonnierten – sie war ihrer Zeit um 150 Jahre voraus.
Was versteht man unter der "Lesewut-Debatte"?
Es war eine kontroverse Diskussion Ende des 18. Jahrhunderts über die vermeintlichen Gefahren des exzessiven Lesens für die Moral und gesellschaftliche Ordnung.
Warum verschwanden die Lesegesellschaften allmählich wieder?
Gründe waren staatliche Repressionen, die Konkurrenz durch Leihbibliotheken und eine Veränderung der Lesekultur hin zu privaterem Konsum.
- Arbeit zitieren
- Dennis Schmidt (Autor:in), 2004, Vom Finanziellen zum Rebellischen zum Geselligen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208145