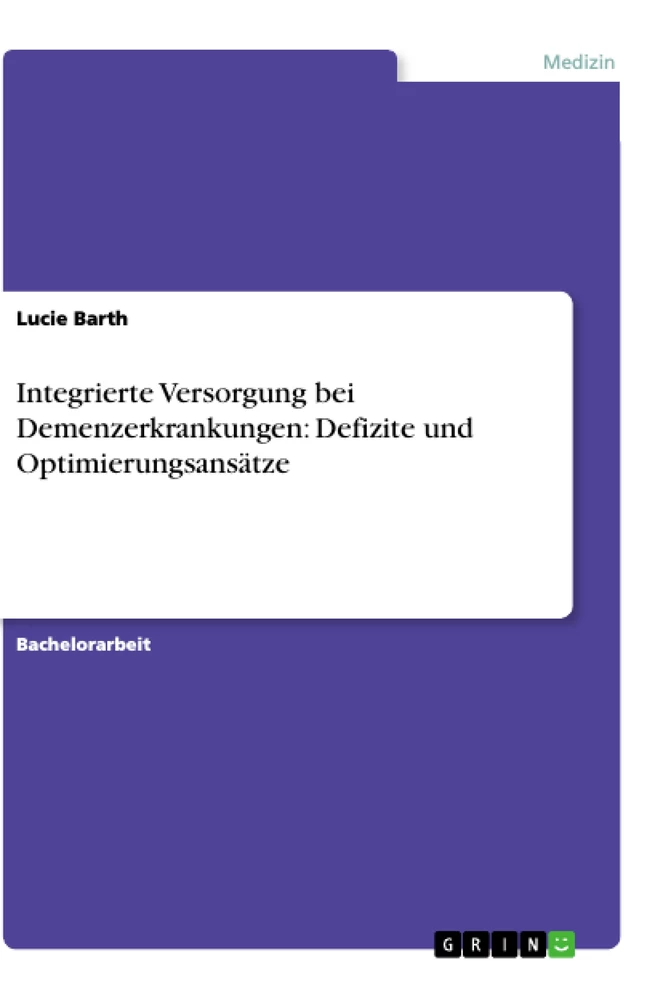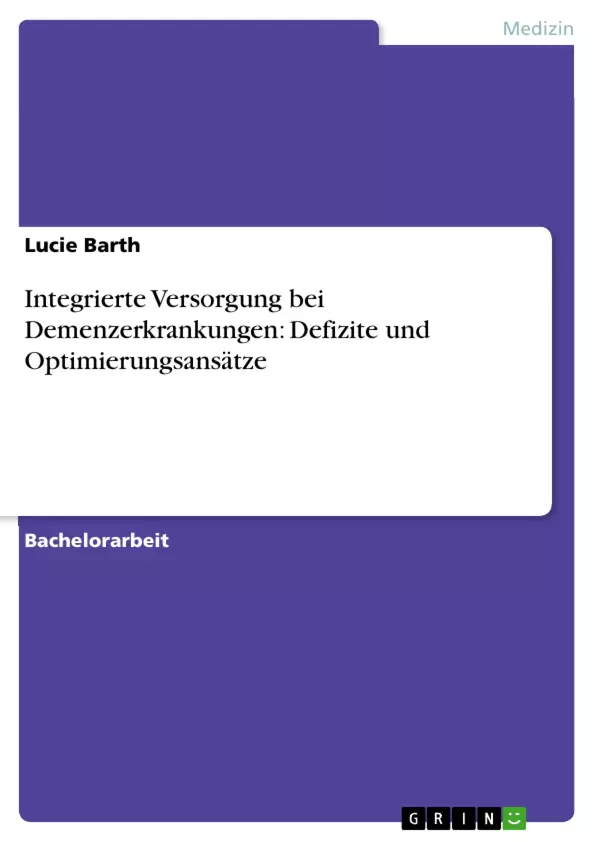Aufgrund des höheren Lebenserwartungsalters und der steigenden Prävalenz von Demenzerkrankungen, zeigt sich die Konfrontation mit diesem Krankheitsbild für jeden Einzelnen früher oder später als unvermeidlich. Daraus resultiert, dass es im Sinne der ganzen Gesellschaft ist, sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzten, um ein optimales Behandlungskonzept zu entwickeln.
An einer Demenz leiden in Deutschland gegenwärtig mehr als 1,4 Millionen Menschen, zwei Drittel von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Es handelt sich um eine zum Tode führende Erkrankung, die nicht kausal behandelbar ist. Die mittlere Krankheitsdauer beträgt drei bis sechs Jahre. Diese Krankheit ist der häufigste Grund für eine Pflegebedürftigkeit. Bis zu 80 % der Demenzerkrankten siedeln im Laufe der Erkrankung in eine Pflegeeinrichtung über.
Das Statistische Bundesamt geht von mehr als 10 Mrd. Euro jährlich für die Versorgung von Demenzerkrankungen aus, mehr als 40 % der Kosten entfallen auf die informelle Pflege. Eine tragende Rolle spielt dabei die familiäre Versorgung, denn fast drei Drittel der Erkrankten wird von Angehörigen gepflegt. Die demografische Entwicklung deutet darauf hin, dass das Potenzial der informellen familiären Betreuung immer weiter abnehmen könnte. Es ist anzunehmen, dass die Abnahme der familiären Betreuung zu einem Anstieg der institutionellen Hilfe führen wird.
Die Vielfallt, der für Demenz spezifischen Symptome, erhöht exponentiell die Akteurdichte in der Versorgungslandschaft. Das bekräftigt die Bedeutung einer integrierten Versorgung. Der aktuelle Forschungsstand deutet darauf hin, dass die Versorgungssituation Defizite aufweist und dass eine intensive, kompetente, pflegerische Betreuung nicht in ausreichendem Maß gewährleistet ist.
Ausgehend von dieser Problematik möchte diese Bachelorarbeit der Frage nachgehen, in welchen Bereichen der Versorgungslandschaft die Defizite liegen. Es wurde versucht, die Ursachen für den eventuellen Mangel zu identifizieren, um entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Methodik
- 1.2 Vorgehensweise empirischer Teil
- 1.3 Beurteilung des Messinstruments
- 2 Das Krankheitsbild „Demenz“
- 2.1 Demenzformen
- 2.1.1 Alzheimer Demenz
- 2.1.2 Vaskuläre Demenzen
- 2.1.3 Studienergebnisse PSY-UKD
- 2.2 Demenzdiagnostik
- 2.2.1 Kognitive Kurztests
- 2.2.2 Schweregradeinteilung
- 2.2.3 Studienergebnisse PSY-UKD
- 2.3 Behandlung
- 2.3.1 Nichtmedikamentöse Therapien
- 2.3.2 Medikamentöse Therapien
- 2.3.3 Studienergebnisse PSY-UKD
- 2.4 Fazit
- 3 Demenz als „Angehörigenkrankheit“
- 3.1 Die Pflege
- 3.1.1 Demenzsymptomatik
- 3.1.2 Auswirkungen auf die pflegenden Angehörigen
- 3.1.3 Studienergebnisse PSY-UKD
- 3.2 Betreuungsangebote
- 3.2.1 Beratungsstellen
- 3.2.2 Staatliche Interventionen
- 3.2.3 Pflegestufen
- 3.3 Interventionen für pflegende Angehörige
- 3.3.1 Studienergebnisse PSY-UKD
- 3.3.2 Patientenverfügung
- 3.3.3 Vorsorgevollmacht
- 3.3.4 Studienergebnisse PSY-UKD
- 3.4 Fazit
- 4 Integrierte Versorgung
- 4.1 Wirtschaftlicher Aspekt
- 4.1.1 Direkte Kosten
- 4.1.2 Kostensenkende Maßnahmen
- 4.1.3 Studienergebnisse PSY-UKD
- 4.2 Ambulanter Sektor
- 4.2.1 DEGAM-Leitlinie Nr. 12 „Demenz“
- 4.2.2 S3-Leitlinie „Demenzen“
- 4.2.3 Studienergebnisse PSY-UKD
- 4.3 Stationärer Sektor
- 4.3.1 (Akut-)Krankenhaus
- 4.3.2 Pflegeeinrichtung
- 4.3.3 Rehabilitation
- 4.3.4 Studienergebnisse PSY-UKD
- 4.4 Fazit
- 5 Überleitungsmanagement
- 5.1 Grundlagen und Ziele
- 5.2 Kompetenzzentrum Demenz
- 5.2.1 Gedächtnissprechstunde
- 5.2.2 Psychiatrisch-geriatrische Station mit Schwerpunkt Demenz
- 5.2.3 Tagesklinik für Demenzpatienten
- 5.2.4 Fallmanagement
- 5.2.5 Schulungszentrum Demenz
- 5.3 Fazit
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die integrierte Versorgung bei Demenzerkrankungen, beleuchtet bestehende Defizite und entwickelt Optimierungsansätze. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Studie (PSY-UKD) und analysiert verschiedene Aspekte der Erkrankung, von der Diagnostik und Behandlung bis hin zur Pflege und den wirtschaftlichen Auswirkungen.
- Defizite in der integrierten Versorgung bei Demenzerkrankungen
- Wirtschaftliche Aspekte der Demenzversorgung
- Rollen und Herausforderungen pflegender Angehöriger
- Möglichkeiten der Verbesserung der Demenzversorgung durch Überleitungsmanagement
- Analyse der Studienergebnisse der PSY-UKD Studie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine empirische Studie fokussiert und ein spezifisches Messinstrument beurteilt. Es legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, indem es den Rahmen der Untersuchung und die angewandte Forschungsstrategie definiert. Die Einbettung der Arbeit in den wissenschaftlichen Kontext der Demenzforschung wird hier ebenfalls dargelegt.
2 Das Krankheitsbild „Demenz“: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Krankheitsbild Demenz. Es differenziert zwischen verschiedenen Demenzformen wie Alzheimer-Demenz und vaskulären Demenzen, untermauert durch Studienergebnisse der PSY-UKD. Weiterhin werden die Aspekte der Demenzdiagnostik, inklusive kognitiver Kurztests und Schweregradeinteilungen, sowie verschiedene Behandlungsansätze, sowohl medikamentös als auch nicht-medikamentös, detailliert erläutert und mit den Ergebnissen der PSY-UKD-Studie verknüpft.
3 Demenz als „Angehörigenkrankheit“: Dieses Kapitel widmet sich den Herausforderungen und Auswirkungen von Demenz auf pflegende Angehörige. Es beschreibt die Demenzsymptomatik und deren Auswirkungen auf die Angehörigen. Der Fokus liegt auf Betreuungsangeboten, staatlichen Interventionen und Unterstützungsmöglichkeiten wie Beratungsstellen. Die Rolle der Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht im Kontext der Demenzpflege wird beleuchtet, und dies alles wird durch die Ergebnisse der PSY-UKD-Studie untermauert.
4 Integrierte Versorgung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem wirtschaftlichen Aspekt der Demenzversorgung, analysiert die direkten Kosten und potenzielle kostensenkende Maßnahmen. Es vergleicht den ambulanten und stationären Sektor, unter Bezugnahme auf relevante Leitlinien (DEGAM, S3-Leitlinie) und integriert wieder die Studienergebnisse der PSY-UKD, um die Effizienz und Effektivität verschiedener Versorgungskonzepte zu evaluieren.
5 Überleitungsmanagement: Das Kapitel erläutert die Grundlagen und Ziele des Überleitungsmanagements bei Demenzerkrankungen. Es beschreibt detailliert die Struktur und Funktionsweise eines Kompetenzzentrums Demenz, inklusive Gedächtnissprechstunde, psychiatrisch-geriatrischer Station, Tagesklinik, Fallmanagement und Schulungszentrum. Der Fokus liegt auf der optimierten Versorgungskette und dem reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Versorgungsebenen.
Schlüsselwörter
Demenzerkrankungen, Integrierte Versorgung, Demenzformen, Diagnostik, Behandlung, Pflege, Angehörige, Wirtschaftlichkeit, Kostensenkung, Überleitungsmanagement, Kompetenzzentrum, PSY-UKD Studienergebnisse, Leitlinien.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Integrierte Versorgung bei Demenzerkrankungen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die integrierte Versorgung bei Demenzerkrankungen. Sie beleuchtet bestehende Defizite im Versorgungssystem und entwickelt Optimierungsansätze, insbesondere durch die Analyse einer empirischen Studie (PSY-UKD) und die Berücksichtigung verschiedener Aspekte der Erkrankung, von der Diagnostik und Behandlung bis hin zur Pflege und den wirtschaftlichen Auswirkungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Facetten der Demenzversorgung, darunter die verschiedenen Demenzformen (z.B. Alzheimer-Demenz, vaskuläre Demenzen), die Diagnostik (kognitive Kurztests, Schweregradeinteilung), die Behandlung (medikamentös und nicht-medikamentös), die Herausforderungen für pflegende Angehörige, Betreuungsangebote, staatliche Interventionen, wirtschaftliche Aspekte der Demenzversorgung (direkte Kosten, Kostensenkungspotenziale), und das Überleitungsmanagement im Kontext von Kompetenzzentren für Demenz.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Studie (PSY-UKD) und analysiert deren Ergebnisse. Die Methodik wird im ersten Kapitel detailliert beschrieben. Ein spezifisches Messinstrument wird ebenfalls beurteilt.
Welche Aspekte der Demenzdiagnostik und -behandlung werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Demenzformen, kognitive Kurztests zur Diagnostik, verschiedene Schweregradeinteilungen und sowohl medikamentöse als auch nicht-medikamentöse Behandlungsansätze. Die Ergebnisse der PSY-UKD Studie werden zur Untermauerung der Ausführungen genutzt.
Wie wird die Rolle pflegender Angehöriger beleuchtet?
Die Arbeit betrachtet Demenz als „Angehörigenkrankheit“ und konzentriert sich auf die Auswirkungen der Erkrankung auf die pflegenden Angehörigen. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Pflege, verfügbare Betreuungsangebote (Beratungsstellen, staatliche Interventionen, Pflegestufen), und die Bedeutung von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Die Ergebnisse der PSY-UKD Studie werden zur Unterstützung der Aussagen herangezogen.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Der wirtschaftliche Aspekt der Demenzversorgung wird durch die Analyse der direkten Kosten und potentieller kostensenkender Maßnahmen untersucht. Die Arbeit vergleicht den ambulanten und stationären Sektor und bezieht relevante Leitlinien (DEGAM, S3-Leitlinie) sowie die Studienergebnisse der PSY-UKD Studie ein, um die Effizienz und Effektivität verschiedener Versorgungskonzepte zu evaluieren.
Welche Rolle spielt das Überleitungsmanagement?
Die Arbeit erläutert die Grundlagen und Ziele des Überleitungsmanagements bei Demenzerkrankungen und beschreibt detailliert ein Kompetenzzentrum Demenz mit seinen verschiedenen Angeboten (Gedächtnissprechstunde, psychiatrisch-geriatrische Station, Tagesklinik, Fallmanagement, Schulungszentrum). Der Fokus liegt auf einer optimierten Versorgungskette und dem reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Versorgungsebenen.
Welche Studienergebnisse werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Ergebnisse der PSY-UKD Studie. Diese Ergebnisse werden in verschiedenen Kapiteln zur Untermauerung der jeweiligen Aussagen herangezogen. Die spezifischen Ergebnisse werden im Text detailliert dargestellt.
Welche Leitlinien werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die DEGAM-Leitlinie Nr. 12 „Demenz“ und die S3-Leitlinie „Demenzen“, um die Aussagen zur integrierten Versorgung und den Behandlungsansätzen zu validieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Demenzerkrankungen, Integrierte Versorgung, Demenzformen, Diagnostik, Behandlung, Pflege, Angehörige, Wirtschaftlichkeit, Kostensenkung, Überleitungsmanagement, Kompetenzzentrum, PSY-UKD Studienergebnisse, Leitlinien.
- Arbeit zitieren
- Lucie Barth (Autor:in), 2012, Integrierte Versorgung bei Demenzerkrankungen: Defizite und Optimierungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208599