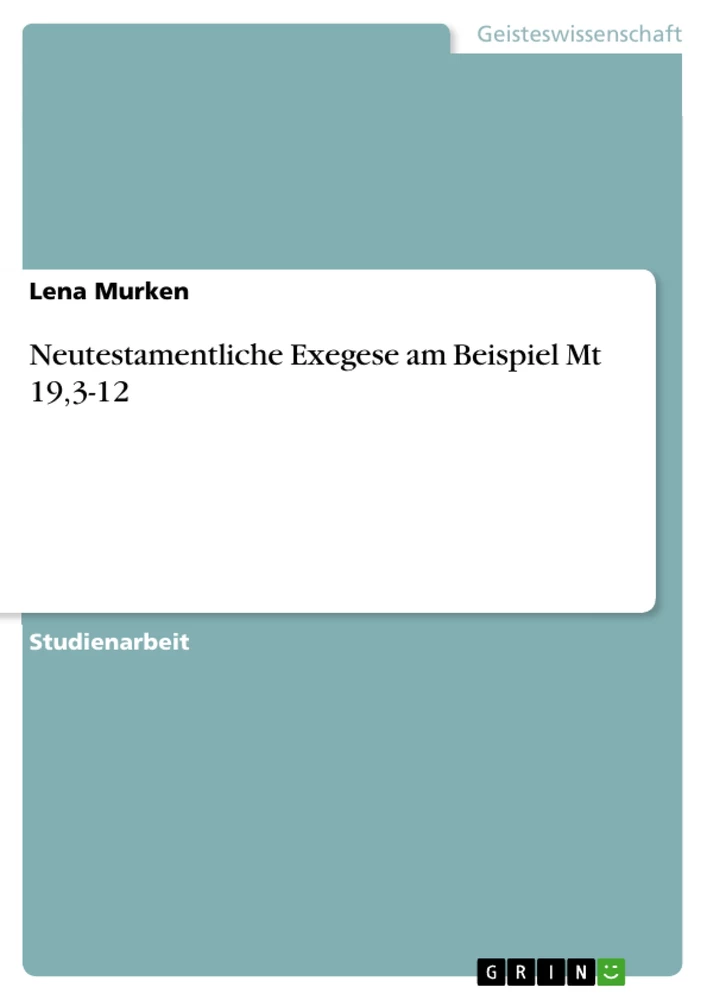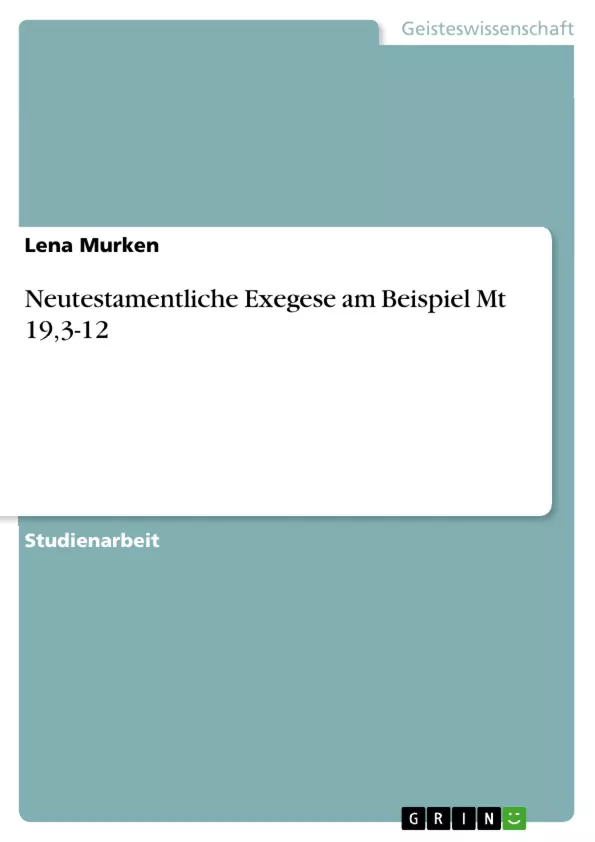Im Folgenden werde ich die Bibelstelle Mt 19,3-12 nach den Methoden der
neutestamentlichen Exegese analysieren.
Mt 19,3-12 behandelt das Scheidungsrecht. Die Pharisäer fragen Jesus, ob man sich
scheiden lassen dürfe, dieser sagt ihnen aber, dass Gott die Menschen
zusammenfügt und man von Gott Zusammengefügtes nicht trennen dürfe, es sei
denn, die Frau habe sich der Hurerei schuldig gemacht.
Die Interpretationsmöglichkeiten des Neuen Testamentes beziehungsweise der Bibel
sind sehr vielfältig, sodass es von großer Bedeutung ist, die Textstellen auf
unterschiedlichste Art zu untersuchen.
Es gibt von einigen Texten mehrere Varianten, viele kommen mehrmals in der Bibel -
oder auch in anderen Schriften - vor. Deshalb ist es als erstes bedeutsam
herauszufinden, welche Variante die Ursprungsvariante ist. Dies ist eines der Ziele
der Textkritik, die ich im nächsten Punkt vorstellen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textkritik
- Textanalyse
- Abgrenzung des Textes.
- Sprachlich-Syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Narrative Analyse
- Pragmatische Analyse
- Feststellung der Kohärenz
- Quellenkritik
- Formgeschichte
- Vergleich MK 10,2-12 und MK 12,13-17
- Vergleich mit Mt 19,3-12
- Traditionsgeschichte
- Begriffs- und Motivsgeschichte
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Redaktionsgeschichte
- Quellenangaben
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der neutestamentlichen Exegese am Beispiel der Bibelstelle Mt 19,3-12. Das Ziel ist es, diese Textstelle mit verschiedenen methodischen Ansätzen zu analysieren und zu interpretieren. Dabei werden die verschiedenen Ebenen der Exegese betrachtet, von der Textkritik über die Textanalyse bis hin zur Formgeschichte und der Redaktionsgeschichte.
- Das Scheidungsrecht in der jüdischen und christlichen Tradition
- Die Bedeutung von Jesus’ Aussagen im Kontext des damaligen Zeitgeschehens
- Die sprachliche und literarische Analyse des Textes Mt 19,3-12
- Die Beziehungen zwischen dem Matthäus-Evangelium und anderen biblischen Texten
- Die Relevanz der Exegese für das Verständnis des Neuen Testaments
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert die Bedeutung der neutestamentlichen Exegese für das Verständnis des Neuen Testaments. Im Anschluss wird die Methode der Textkritik vorgestellt, die sich mit der Frage der Textvarianten und der Rekonstruktion des ursprünglichen Textes befasst.
Die Textanalyse befasst sich mit dem Inhalt des Textes Mt 19,3-12, wobei verschiedene Aspekte wie die sprachliche und literarische Struktur des Textes betrachtet werden. Es wird die Abgrenzung des Textes mit Kontextanalyse erläutert, sowie die verschiedenen Methoden der sprachlichen Analyse.
Die Quellenkritik befasst sich mit der Frage, welche Quellen für den Text Mt 19,3-12 relevant sind. Dabei werden auch die Beziehungen zu anderen biblischen Texten und deren Entstehungszeit untersucht.
In der Formgeschichte wird die Entwicklung des Textes Mt 19,3-12 im Kontext der literarischen Gattung der Evangelien untersucht. Dabei wird der Text mit anderen ähnlichen Texten verglichen, um seine Entstehungsgeschichte zu rekonstruieren.
Schlüsselwörter
Neutestamentliche Exegese, Textkritik, Textanalyse, Sprachliche Analyse, Literarische Analyse, Kontextanalyse, Quellenkritik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Begriffs- und Motivsgeschichte, Religionsgeschichtlicher Vergleich, Redaktionsgeschichte, Matthäus-Evangelium, Scheidungsrecht, Jesus, Pharisäer, Bibel, Exegese, Methodik, Vergleich, Analyse, Interpretation, Entstehung.
- Quote paper
- Lena Murken (Author), 2011, Neutestamentliche Exegese am Beispiel Mt 19,3-12, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208608