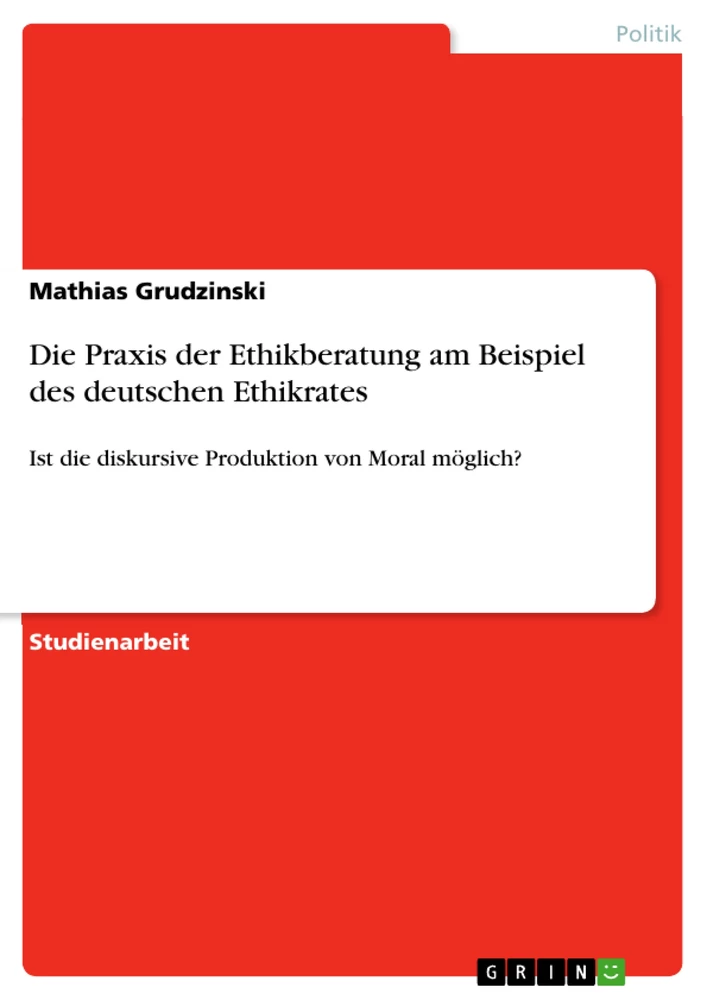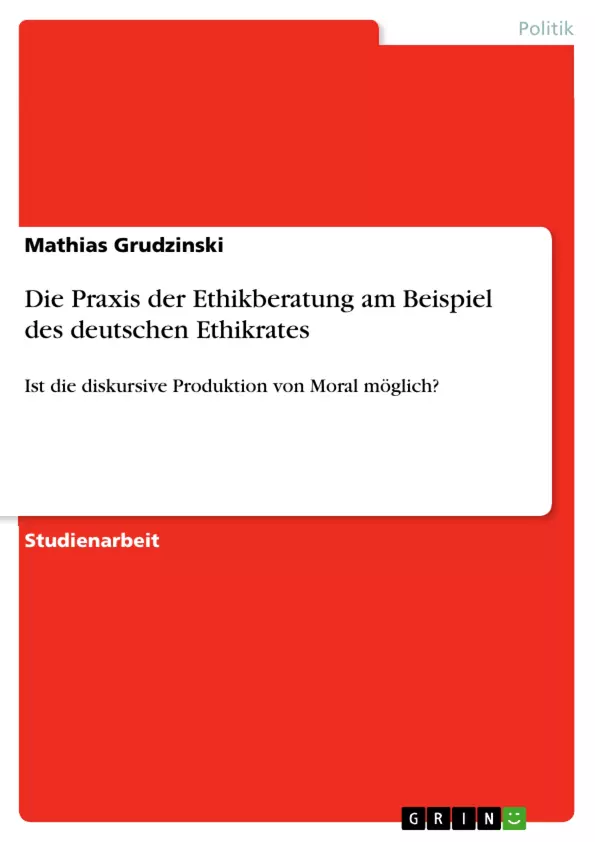Die Diskussion über ethisch-gesellschaftliche Fragestellungen gehört eigentlich fest zum Kerngeschäft des Politikers. Vor allem im Bereich der Technikfolgenabschätzung geht es dabei häufig um fundamentale Fragen des menschlichen Zusammenlebens: Ist es rechtens, ungeborenes Leben aufgrund von Erbschädigungen abzutöten? Dürfen wir dem Sterbewunsch schwerkranker Patienten entsprechen? Kann eine verantwortungsvolle Gesellschaft weiter auf die Nutzung von Kernenergie setzen? In jüngster Zeit lässt sich bei der politischen Bearbeitung solcher Themen - wie schon bei anderen Entscheidungsmaterien zuvor - zunehmend ein neuer Trend beobachten: Die Delegation an institutionalisierte Expertengremien. So wurde in der Ethikkommission "Sichere Energieversorgung" neben Risikobewertung und Zukunftsperspektiven auch die ethische Dimension von Atomkraftwerknutzung diskutiert. Parallel dazu existieren bereits seit vielen Jahren
dauerhafte Strukturen wie die zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, die Entscheidungsträger vor allem im Bereich der Forschungspolitik beraten wollen.
Wie eine Vielzahl von Publikationen und Tagungen jüngeren Datums beweisen, wird das Phänomen ethische Politikberatung auch in der Wissenschaft heftig diskutiert. Die Debatte kreist dabei unter anderem um die Frage, wie die "Produktion von Moral" in Expertengremien idealerweise organisiert werden sollte. Die meisten Beobachter sind überzeugt, dass sogenannte
Bottom-up Ansätze angewandter Ethik die beste Antwort darauf liefern können: Im fachwissenschaftlichen Diskurs, im Zusammenspiel von Konsens und Dissens werden sich schrittweise Lösungen für moralische Probleme und Handlungsempfehlungen für die Politik herauslösen.
Doch entspricht die Arbeitsweise von Ethikgremien tatsächlich dem anspruchsvollen Muster diskursiver Verfahren? Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, diese spannende Frage anhand der Praxis des Deutschen Ethikrates zu überprüfen. Zu diesem Zweck werden wichtige Prozessdokumente und Sekundärquellen des Ethikrates qualitativ und quantitativ ausgewertet und mit zentralen Aussagen des Modells verglichen. Am Ende sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Theorie und Praxis sichtbar werden, die erlauben, die Leistungsfähigkeit ethischer Politikberatung zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Kapitel 1: Ethik - Annäherung an einen speziellen Beratungsgegenstand
- II.1 Die institutionalisierte Ethikberatung in Deutschland
- II.2 Das Bottom-up Modell angewandter Ethik: Was macht gute Ethikberatung aus?
- III. Kapitel 2: Die Praxis institutionalisierter Politikberatung auf dem Prüfstand
- III.1 Der Deutsche Ethikrat als Beispiel für ein nationales Beratungsorgan in ethischen Streitfragen
- III.2 Vergleich von Theorie und Praxis: Bottom-up Theorien als Modell zur Erklärung ethischer Politikberatung?
- III.2.1 Die Qualifikation der Mitglieder
- III.2.2 Die Zusammensetzung des deutschen Ethikrates
- III. 2.3 Die Unabhängigkeit der Ratsmitglieder
- III.2.4 Die Öffentlichkeit des Deutschen Ethikrates
- III.2.5 Die Abstimmungsergebnisse des Deutschen Ethikrates
- IV. Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick: Was kann institutionalisierte Ethikberatung wirklich leisten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Praxis des Deutschen Ethikrates und analysiert, ob die Arbeitsweise des Gremiums dem Ideal diskursiver Verfahren entspricht. Dazu werden zentrale Aussagen des Bottom-up Modells angewandter Ethik mit Prozessdokumenten und Sekundärquellen des Ethikrates verglichen. Die Arbeit soll die Leistungsfähigkeit ethischer Politikberatung bewerten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede von Theorie und Praxis aufzeigen.
- Definition und Systematisierung des Phänomens institutionalisierte Ethikberatung
- Charakterisierung des Bottom-up Modells angewandter Ethik als Grundlage für den Vergleich
- Analyse des Beratungsprozesses des Deutschen Ethikrates anhand vier zentraler Forderungen: Qualifikation, Zusammensetzung, Arbeitsweise und Abstimmungsergebnisse
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen institutionalisierter Ethikgremien
- Beantwortung der Frage, was ethische Politikberatung tatsächlich leisten kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert und systematisiert das Phänomen institutionalisierte Ethikberatung in Deutschland. Es werden verschiedene Beratungsformen nach Organisationsanspruch und Politiknähe unterschieden, wobei nationale Ethikgremien als Untersuchungsgegenstand der Arbeit hervorgehoben werden. Die Funktionen nationaler Ethikgremien werden kurz vorgestellt und Besonderheiten des Beratungsgegenstandes Ethik erörtert.
Das zweite Kapitel widmet sich der Charakterisierung des Bottom-up Modells angewandter Ethik. Dieses Modell geht davon aus, dass Ethik einen besonderen Beratungsgegenstand darstellt und formuliert bestimmte Forderungen, die Ethikgremien in ihrer Arbeit berücksichtigen müssen.
Das dritte Kapitel wendet die Vorstellungen des Bottom-up Modells auf den Beratungsprozess des Deutschen Ethikrates an. Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf vier zentrale Forderungen von Ethikern: Qualifikation, Zusammensetzung, Arbeitsweise und Abstimmungsergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Ethikberatung, Politikberatung, Deutscher Ethikrat, Bottom-up Modell, diskursive Moralproduktion, Qualifikation, Zusammensetzung, Unabhängigkeit, Öffentlichkeit, Konsensbildung und ethische Politikberatung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe des Deutschen Ethikrates?
Der Deutsche Ethikrat berät Politik und Gesellschaft bei komplexen ethischen Fragen, insbesondere in den Bereichen Lebenswissenschaften, Medizin und Technikfolgenabschätzung.
Was versteht man unter dem „Bottom-up Modell“ angewandter Ethik?
Dieses Modell geht davon aus, dass moralische Lösungen schrittweise durch fachwissenschaftlichen Diskurs und das Zusammenspiel von Konsens und Dissens in Expertengremien entstehen.
Wie werden die Mitglieder des Ethikrates ausgewählt?
Die Zusammensetzung zielt auf eine Vielfalt an wissenschaftlichen Disziplinen und weltanschaulichen Perspektiven ab, um eine breite gesellschaftliche Repräsentanz zu gewährleisten.
Sind die Entscheidungen des Ethikrates für die Politik bindend?
Nein, der Ethikrat hat eine beratende Funktion. Seine Stellungnahmen dienen als Orientierungshilfe und Diskussionsgrundlage für gesetzgeberische Entscheidungen.
Welche Rolle spielt die Öffentlichkeit beim Deutschen Ethikrat?
Der Ethikrat soll den öffentlichen Diskurs fördern, indem er seine Sitzungen teilweise öffentlich abhält und verständliche Informationen zu ethischen Streitfragen bereitstellt.
- Citar trabajo
- Mathias Grudzinski (Autor), 2011, Die Praxis der Ethikberatung am Beispiel des deutschen Ethikrates, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208720