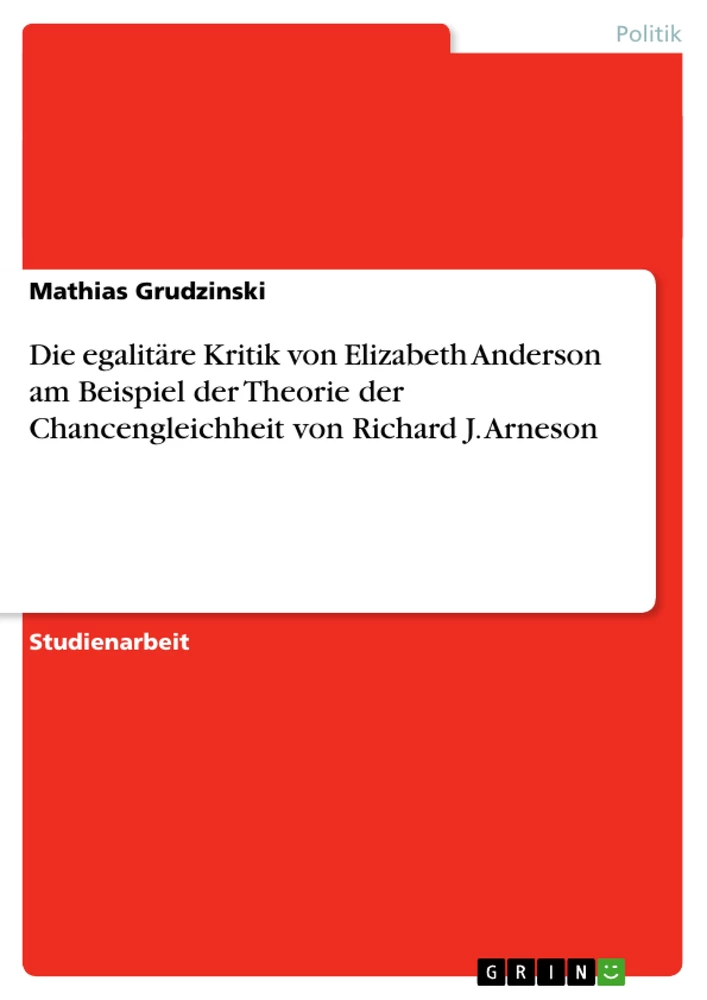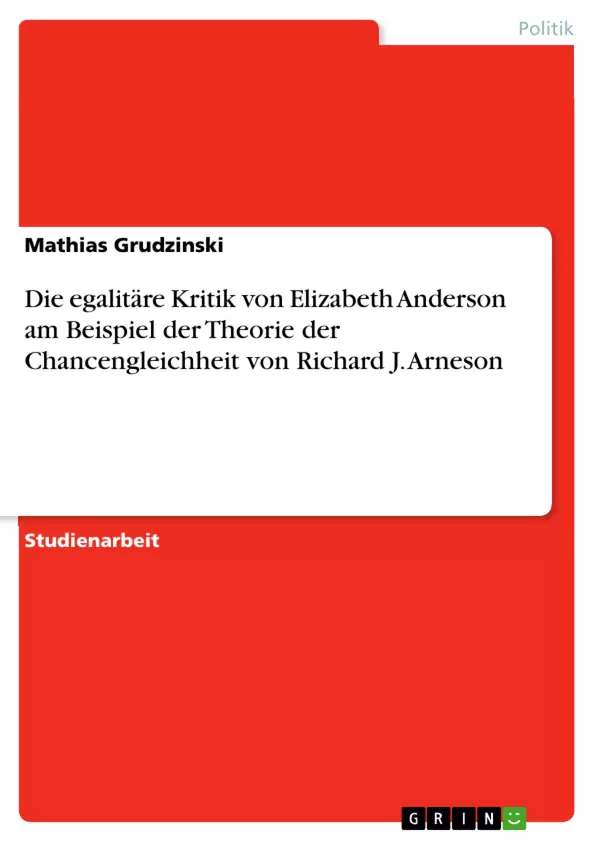Was macht eine gerechte Gesellschaft aus? Wie uns rechtliche Kodifizierung, aktuelle Gerechtigkeitsdebatten und nicht zuletzt unsere moralische Intuition nahelegen, scheint trotz allen Pluralismus zumindest in „westlichen“ Gesellschaften ein gewisser Konsens erreicht: Eine gerechte Gesellschaft erkennt jedem Menschen, unabhängig von deskriptiven Merkmalen, den gleichen moralischen Wert zu, der Achtung fordert. Diese moralische Gleichheit scheint ein „allgemeiner Nenner zu sein, der das ethische Grundanliegen der modernen Welt zum Ausdruck bringt und auf den alle Forderungen nach Humanität bezogen werden können“. Theorien, die implizit oder explizit die Achtung vor dem Wert eines jeden Menschen vermissen lassen, sind von diesem Standpunkt aus moralisch inakzeptabel.
Doch genügen tatsächlich alle modernen Gerechtigkeitstheorien diesem hohen Anspruch? Diese Frage soll anhand des sogenannten Glücksegalitarismus oder auch egalitaristischen Theorien nachgegangen werden.2 Diese einflussreiche Position, dessen Hauptarbeiten zeitlich und inhaltlich in die sogenannte „Equality of What?“ Debatte der 80er Jahre eingeordnet werden können, kreiste um die Frage, wie man die von der Entscheidung unabhängigen Faktoren eines menschlichen Lebens, beispielsweise geistige und körperliche Ausstattung, mit Hilfe von Gütern gerecht egalisieren könnte. In dieser Verteilungsaufgabe sahen sie die Erfüllung der menschlichen Gleichheit und der gerechten Gesellschaft. Zu klären schien nur noch welcher Maßstab dieses Ziel am besten zu messen vermöge.3 Gerade weil damit die Behauptung im Raum steht, dass eine egalitaristische Verteilung Menschen als Gleiche behandelt, ist eine Untersuchung unter dem Gesichtspunkt der moralischen Gleichheit besonders interessant.
Ziel dieser Arbeit ist es daher zu überprüfen, ob Verteilungsprinzipien des Glücksegalitarismus die Vorstellung der moralischen Gleichheit verletzten. Um diese Frage zu beantworten, soll im ersten Abschnitt eine typische egalitaristische Position vorgestellt werden: Die Theorie der Chancengleichheit auf Wohlfahrt von Richard J. Arneson. Grundlage der Diskussion ist sein 1994 in deutscher Übersetzung erschienener Aufsatz mit dem Titel:„Gleichheit und gleiche Chancen zur Erlangung von Wohlergehen“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Konzept der Chancengleichheit auf Wohlfahrt
- 2. Problementwicklung: Elizabeth Andersons Kritik des Glücksegalitarismus
- 2.1 Das Vernachlässigungsargument
- 2.2 Die moralische Gleichheit
- 3. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Verteilungsprinzipien des Glücksegalitarismus die Vorstellung der moralischen Gleichheit verletzen. Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst eine typische egalitaristische Position vorgestellt: Die Theorie der Chancengleichheit auf Wohlfahrt von Richard J. Arneson. Anschließend wird ein Essay von Elizabeth Anderson beleuchtet, der die Ausgangsfrage mit aller Schärfe aufgreift. Andersons Kritik am Glücksegalitarismus liegt darin, dass er zu inhumanen Konsequenzen führen kann, wenn er auf gesellschaftliche Realitäten angewendet wird. Schließlich wird untersucht, ob Andersons Anschuldigungen unter Berücksichtigung von Arnesons Theorie stichhaltig sind.
- Egalitaristische Theorien und die Frage der moralischen Gleichheit
- Die Theorie der Chancengleichheit auf Wohlfahrt von Richard J. Arneson
- Elizabeth Andersons Kritik am Glücksegalitarismus
- Das Vernachlässigungsargument von Elizabeth Anderson
- Die Konsequenzen des Glücksegalitarismus für die moralische Gleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Verletzen Verteilungsprinzipien des Glücksegalitarismus die Vorstellung der moralischen Gleichheit? Sie führt in die Debatte um Gerechtigkeit und Gleichheit ein und stellt die Bedeutung des Glücksegalitarismus als einflussreiche Position in der „Equality of What?“ Debatte der 80er Jahre dar.
1. Das Konzept der Chancengleichheit auf Wohlfahrt
Dieses Kapitel stellt die Theorie der Chancengleichheit auf Wohlfahrt von Richard J. Arneson vor. Arnesons Ansatz ist interessant, da er Ideen wie Chancengleichheit, Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben und kosmische Ungerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt.
2. Problementwicklung: Elizabeth Andersons Kritik des Glücksegalitarismus
Dieses Kapitel analysiert den Essay von Elizabeth Anderson, der die Ausgangsfrage der Arbeit mit aller Schärfe aufgreift. Anderson argumentiert, dass der Glücksegalitarismus zu inhumanen Konsequenzen führen kann, wenn er auf gesellschaftliche Realitäten angewendet wird. Sie fokussiert auf die Frage, wie ein Glücksegalitarist entscheiden würde, wenn es um Menschen geht, die ihr Unglück selbst verschuldet haben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These des Glücksegalitarismus?
Er besagt, dass Ungleichheiten, die auf unverschuldetem Pech (z.B. angeborene Behinderungen) beruhen, durch Umverteilung ausgeglichen werden sollten, während Individuen für die Folgen freiwilliger Entscheidungen selbst verantwortlich sind.
Wie lautet Elizabeth Andersons Kritik am Glücksegalitarismus?
Anderson argumentiert, dass der Glücksegalitarismus inhuman sei, da er Menschen, die ihr Unglück selbst verschuldet haben (z.B. durch riskantes Verhalten), jegliche Hilfe verweigern würde (Vernachlässigungsargument).
Was versteht Richard J. Arneson unter „Chancengleichheit auf Wohlfahrt“?
Arneson schlägt vor, dass eine Gesellschaft gerecht ist, wenn alle Mitglieder die gleichen Chancen haben, ein hohes Maß an Wohlergehen zu erreichen, sofern sie sich entsprechend anstrengen.
Was bedeutet moralische Gleichheit in der Gerechtigkeitsdebatte?
Moralische Gleichheit fordert, dass jedem Menschen unabhängig von seinen Merkmalen der gleiche moralische Wert beigemessen wird und er mit Achtung behandelt werden muss.
Warum ist die „Equality of What?“-Debatte wichtig?
Diese Debatte der 1980er Jahre klärte die Frage, welcher Maßstab (Güter, Wohlfahrt, Fähigkeiten) herangezogen werden sollte, um Gerechtigkeit und Gleichheit in einer Gesellschaft zu messen.
- Citation du texte
- Mathias Grudzinski (Auteur), 2010, Die egalitäre Kritik von Elizabeth Anderson am Beispiel der Theorie der Chancengleichheit von Richard J. Arneson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208722