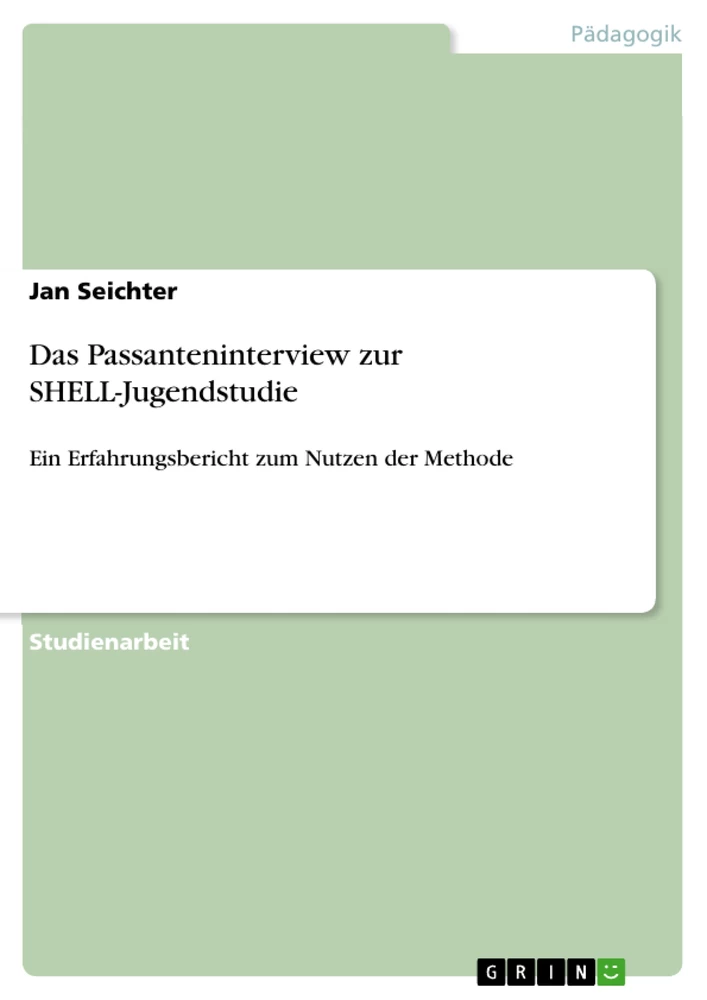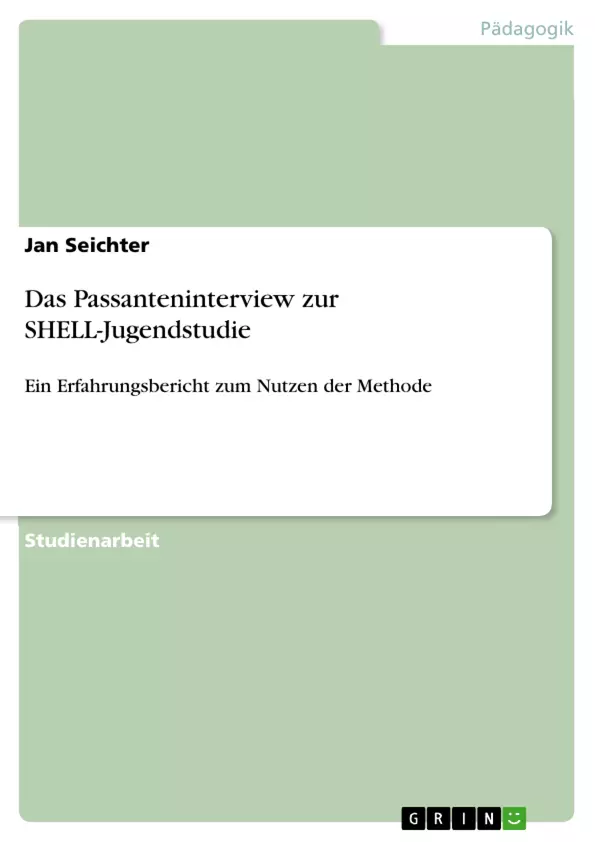Die Befragung ist eine der wichtigsten Methoden der Sozialwissenschaften und wird in vielfältiger Weise angewendet.
Im Rahmen eines Seminars über „quantitative Methoden im Bildungsbereich“ wurde zur Unterstützung eines Referats eine Befragung in einer Fußgängerzone durchgeführt, um ein momentanes Meinungsbild über die SHELL-Jugendstudie zu erfassen.
Im Zuge dieser Befragung sind Auffälligkeiten in den Vordergrund getreten, die diese Art der Befragung positiv oder negativ beeinflussten, ihre Durchführung behinderten oder begünstigten und daher großes Interesse auslösten. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in dieser Arbeit vorgestellt und in Verbindung mit der Fachliteratur dazu gebraucht werden, die Methode der Straßenbefragung hinsichtlich ihres Nutzens für die Sozialwissenschaften zu bewerten.
In der Literatur geht die Straßenbefragung meist unter und wird nur am Rand der Ausführungen mit betrachtet. Diesem Umstand versucht diese Arbeit entgegenzuwirken, um eine ausführliche Betrachtung der Methode zu liefern, anhand derer es möglich ist, über einen Einsatz der Straßenbefragung zu entscheiden bzw. sich dabei ihrer Schwächen bewusst zu sein.
Dabei beleuchtet das zweite Kapitel die Methode an sich und stellt vor allem die selbstgewonnenen Erkenntnisse dar, worauf die darauf folgende Betrachtung der Grenzen und Probleme der Befragung im Allgemeinen zurückgreift und diese speziell für die Straßenbefragung analysiert. Im vierten Kapitel werden schließlich Vor- und Nachteile der Methode genauer untersucht und schließlich auf eine Betrachtung von Anwendungsmöglichkeiten übertragen. Dabei werden innerhalb des Methodenkapitels grafische Darstellungen die aus dem jeweiligen Kapitel extrahierten Erkenntnisse übersichtlich darstellen und dieses Werk auf diese Weise für die praktische und schnelle Anwendung der Methode qualifizieren. Im letzten Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse schließlich noch einmal kanalisiert und gegenübergestellt, um zu einem abschließenden Urteil zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Methode
- Die Grenzen und Probleme
- Der Gewinn und Verlust durch das Passanteninterview
- Die Vorteile
- Die Nachteile
- Die Anwendbarkeit
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Methode des Passanteninterviews und bewertet deren Nutzen für die Sozialwissenschaften. Sie basiert auf Erfahrungen aus einer eigenen Straßenbefragung im Rahmen eines Seminars zu "quantitativen Methoden im Bildungsbereich".
- Bewertung des Passanteninterviews als Methode der Sozialforschung
- Analyse der Vor- und Nachteile dieser Interviewform
- Untersuchung der Grenzen und Probleme bei der Durchführung von Passanteninterviews
- Aufzeigen der Anwendbarkeit und Eignung der Methode in verschiedenen Forschungskontexten
- Verknüpfung der gewonnenen Erkenntnisse mit relevanter Fachliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Seminararbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Methode des Passanteninterviews und präsentiert die selbstgewonnenen Erkenntnisse aus der eigenen Befragung. Im dritten Kapitel werden die Grenzen und Probleme der Befragung im Allgemeinen und speziell im Kontext der Straßenbefragung analysiert. Das vierte Kapitel untersucht die Vor- und Nachteile des Passanteninterviews im Detail und überträgt die Erkenntnisse auf die Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten. Abschließend werden die gewonnenen Ergebnisse im letzten Kapitel zusammengefasst und gegenübergestellt, um zu einem abschließenden Urteil zu gelangen.
Schlüsselwörter
Passanteninterview, Straßenbefragung, quantitative Methoden, Sozialwissenschaften, empirische Forschung, Interviewformen, Befragungstechniken, Interviewqualität, Methodenevaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Passanteninterview?
Eine Form der mündlichen Befragung, bei der Personen in öffentlichen Räumen (z.B. Fußgängerzonen) spontan interviewt werden.
Was sind die Vorteile einer Straßenbefragung?
Sie ermöglicht es, schnell ein aktuelles Meinungsbild einer breiten Öffentlichkeit zu einem spezifischen Thema zu erfassen.
Welche Nachteile hat diese Methode?
Problematisch sind oft die mangelnde Repräsentativität, eine hohe Verweigerungsrate und äußere Störfaktoren (Wetter, Lärm).
Was war der Anlass für die Befragung in dieser Arbeit?
Die Befragung diente dazu, Meinungen zur bekannten SHELL-Jugendstudie im Rahmen eines Uni-Seminars zu sammeln.
Wann ist ein Passanteninterview sinnvoll einsetzbar?
Die Arbeit empfiehlt den Einsatz vor allem für explorative Studien oder um erste Tendenzen in der Bevölkerung zu ermitteln.
- Arbeit zitieren
- Jan Seichter (Autor:in), 2012, Das Passanteninterview zur SHELL-Jugendstudie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209068