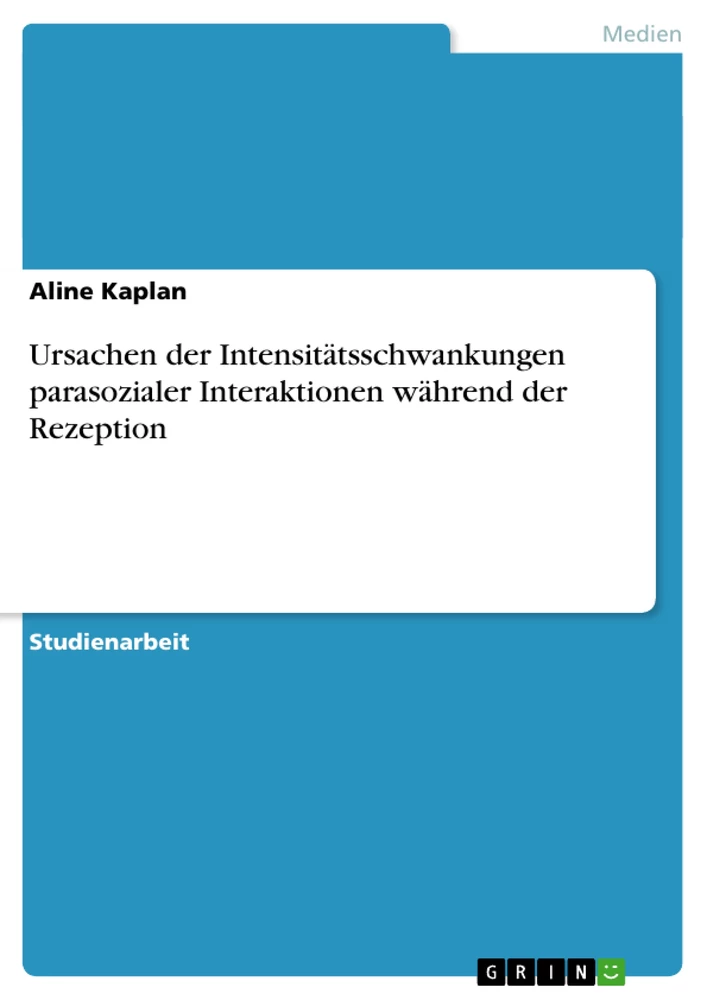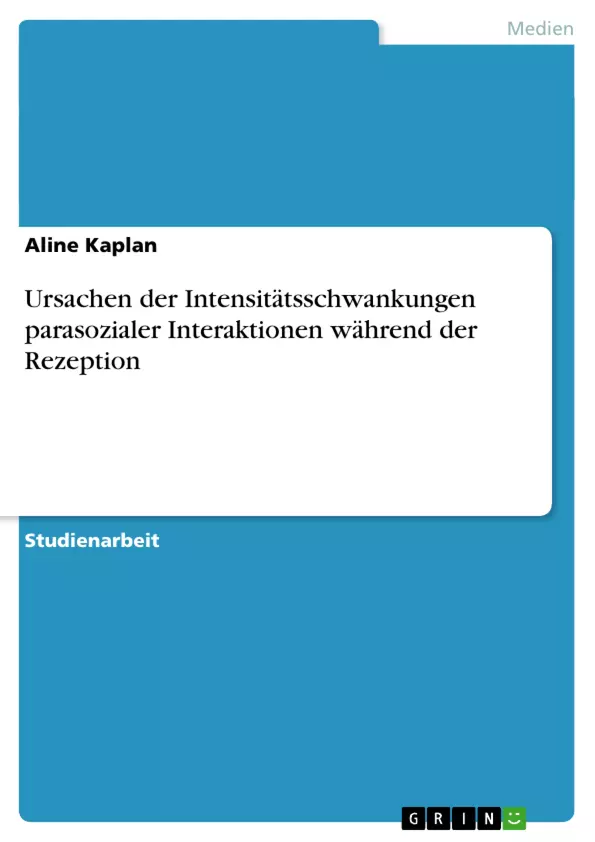Fernseh-Moderatoren, die ihre Zuschauer zu Beginn der Sendung herzlich begrüßen und diese entsprechend darauf reagieren, Rezipienten von Telenovelas wie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ oder „Sturm der Liebe“, die ihre Lieblingsdarsteller tagtäglich im Fernsehen verfolgen und zu Ihnen aufschauen oder Nachrichtensprecher, die beinahe zu ständigen Begleitern des Publikums werden und ihnen fast so vertraut sind wie Freunde, alle haben sie eines gemeinsam: die "parasozialen Interaktionen" bzw. "parasozialen Beziehungen", wie sie innerhalb der Kommunikations- und Medienwissenschaften genannt werden. Die ersten Konzepte zu diesem Phänomen entstanden in den 50er Jahren. In diesen ging es im Zuge der sich rasch verbreitenden Medien Radio, Fernsehen und Kino um die Beschreibung massenmedialer Kommunikationsprozesse als parasoziale Interaktion bzw. parasoziale Beziehung. Die beiden bedeutendsten und weit reichsten wissenschaftlichen Arbeiten in der Entstehung der Theorie zur parasozialen Interaktion stammen von den amerikanischen Sozialwissenschaftlern Donald Horten und Richard R. Wohl, Mass communication and parasocial interaction. Observations on intimacy at a distance (1956), die die Grundformen für diese Art der Fernsehrezeption entdeckt und erklärt haben sowie in der Publikation von Anselm Strauss und Wohl, Interaction in audience-participation shows (1957), in welcher die Gedanken wiederaufgenommen und präzisiert wurden. Allerdings muss hierbei erwähnt werden, dass die Ausführungen von Horton und Wohl eine Reihe an Desideraten und Unschärfen aufweisen (vgl. Schramm et al., 2002).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Die Begriffe der parasozialen Interaktion (PSI) & Beziehung (PSB)
- Persona und Rezipienten
- Stand der Forschunge zu PSI und PSB
- Der Ursprung des PSI-Konzepts – PSI bei Horton und Wohl (1956)
- Forschung zur schwankenden Intensität von PSI Und PSB
- Das Zwei-Ebenen-Modell (2004)
- Befunde zur schwankende Intensität der PSI
- Auswertung und Zusammenfassung der Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der parasozialen Interaktion und Beziehung im Kontext des Fernsehens. Sie beleuchtet insbesondere die schwankende Intensität dieser Interaktionen und Beziehungen und analysiert die Ursachen dieser Schwankungen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die dynamische Beziehung zwischen Fernsehzuschauern und Medienpersonen zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe parasoziale Interaktion und Beziehung
- Entwicklung des PSI-Konzepts und dessen historische Bedeutung
- Analyse der Ursachen für die schwankende Intensität parasozialer Interaktionen
- Anwendung des Zwei-Ebenen-Modells zur Komplexitätsreduktion des PSI-Konzepts
- Bewertung relevanter Forschungsergebnisse zur Intensität parasozialer Interaktionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt das Thema parasoziale Interaktion und Beziehung im Kontext des Fernsehens ein und stellt die Relevanz des Themas heraus. Sie beleuchtet die verschiedenen Arten der parasozialen Interaktion und Beziehung, die im Fernsehen vorkommen, und hebt die Bedeutung des Rezipienten für die Entstehung dieser Beziehungen hervor.
- Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe parasoziale Interaktion (PSI) und parasoziale Beziehung (PSB) und grenzt sie klar voneinander ab. Es werden außerdem die Rollen der Medienpersona und des Rezipienten in diesem Zusammenhang näher erläutert.
- Stand der Forschung zu PSI und PSB: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den bisherigen Stand der Forschung zum Thema parasoziale Interaktion und Beziehung. Es beleuchtet die Entwicklung des PSI-Konzepts und die verschiedenen Forschungsansätze, die in den letzten Jahrzehnten verfolgt wurden.
- Der Ursprung des PSI-Konzepts – PSI bei Horton und Wohl (1956): Dieses Kapitel befasst sich mit der Pionierstudie von Horton und Wohl aus dem Jahr 1956, welche den Begriff der parasozialen Interaktion prägte. Es analysiert die wichtigsten Erkenntnisse der Studie und erläutert, wie Horton und Wohl das Phänomen der parasozialen Interaktion beobachteten und definierten.
- Forschung zur schwankenden Intensität von PSI und PSB: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Intensität parasozialer Interaktionen und Beziehungen. Es stellt das Zwei-Ebenen-Modell vor, welches zur Komplexitätsreduktion des PSI-Konzepts entwickelt wurde, und analysiert verschiedene Forschungsbefunde, die sich mit der schwankenden Intensität parasozialer Interaktionen beschäftigen.
Schlüsselwörter
Parasoziale Interaktion, parasoziale Beziehung, Fernsehen, Medienperson, Rezipient, Intensitätsschwankungen, Zwei-Ebenen-Modell, Forschungsergebnisse.
- Quote paper
- Aline Kaplan (Author), 2012, Ursachen der Intensitätsschwankungen parasozialer Interaktionen während der Rezeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209070