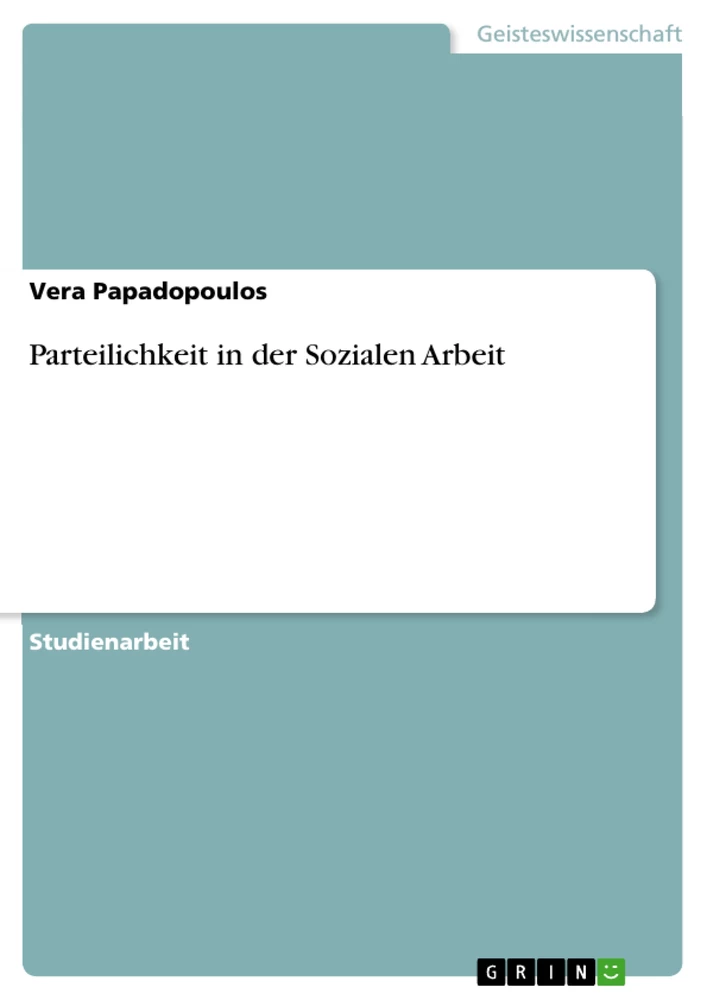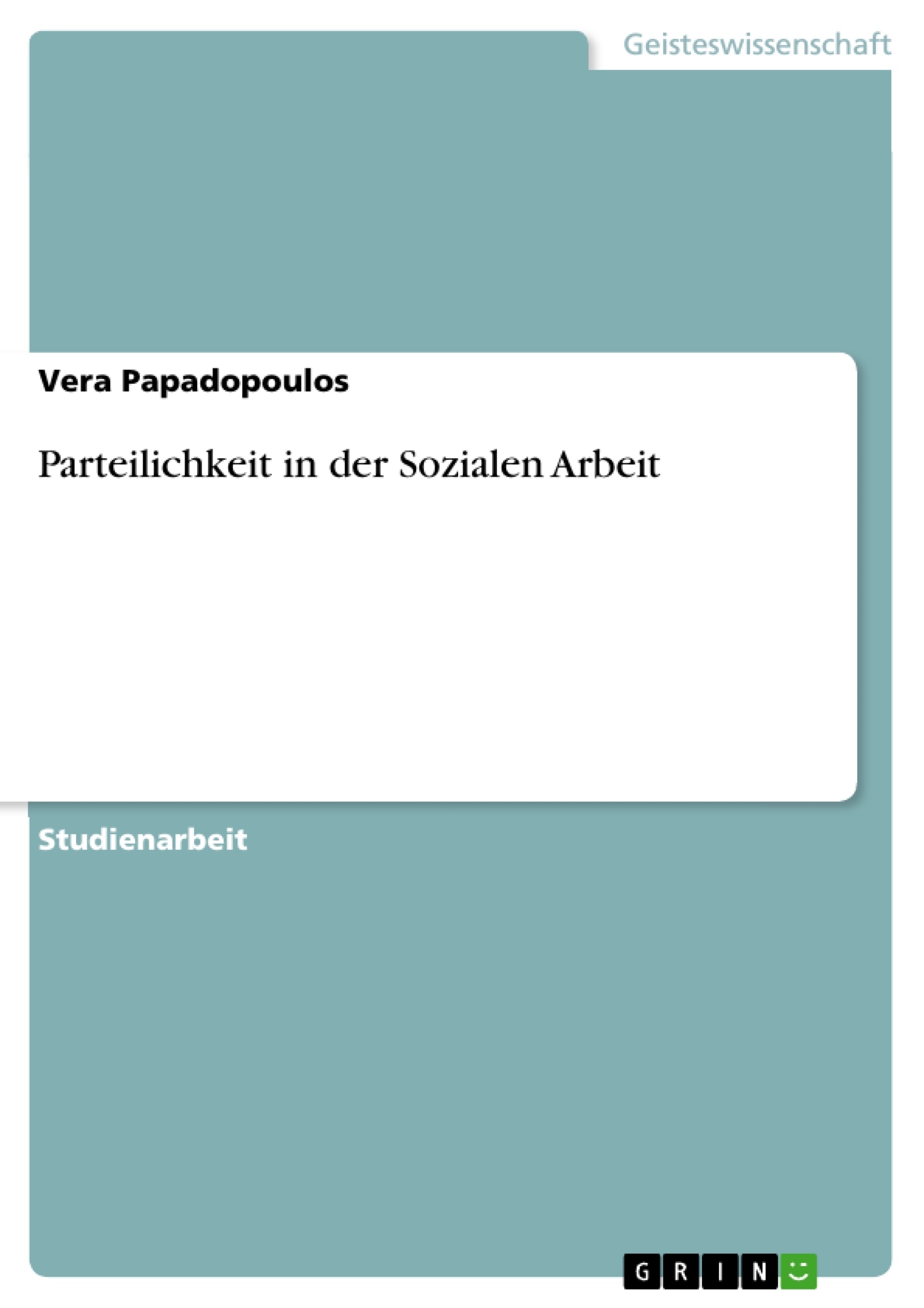In der Sozialen Arbeit kennzeichnet der vieldeutige Begriff Parteilichkeit die sozialarbeiterische Haltung und das solidarische Engagement im Umgang mit AdressatInnen, anderen relevanten Personen(-gruppen) und Institutionen sowie eine sozialpolitische Haltung; Parteilichkeit kann in bestimmten Arbeitsbereichen und Funktionen für SozialarbeiterInnen dabei zum Handlungsprinzip werden.
In der Sozialen Arbeit kennzeichnet der vieldeutige Begriff Parteilichkeit die sozialarbeiterische Haltung und das solidarische Engagement im Umgang mit AdressatInnen, anderen relevanten Personen(-gruppen) und Institutionen sowie eine sozialpolitische Haltung (vgl. Hartwig 2000:1); Parteilichkeit kann in bestimmten Arbeitsbereichen und Funktionen für SozialarbeiterInnen dabei zum Handlungsprinzip werden.
Ein Blick auf die Entwicklung des Begriffes Parteilichkeit zeigt, dass er ursprünglich in Form eines radikalen politischen Anspruchs im Zusammenhang mit feministischen Projekten (z. B. gegen das Patriarchat und sexuelle Gewalt) eine eindeutige Positionierung zu den Opfern bedeutete (vgl. Kuhlmann 200:12). Eine Modifizierung des Begriffes erfolgte in den 80er Jahren, da der therapeutische Bedarf von AdressatInnen in den Vordergrund rückte. Parallel entfachte sich eine generelle Diskussion, welche Merkmale Professionalität auszeichnen, da nun Distanz gegenüber AdressatInnen als ein wesentlicher Bestandsteil der Professionalität betrachtet wurde (vgl. Kuhlmann 200:13).
Zunehmend wird der Begriff auch in anderen sozialpädagogischen Handlungsfeldern, z. B. in der Erziehungshilfe, in der Jugendarbeit und im Streetwork verwendet. In Konzepten der Mädchen- und Frauenarbeit ist Parteilichkeit heute noch eine wesentliche Grundlage des Handelns.
Abhängig von verschiedenen fachlichen und weltanschaulichen Konzepten sowie vom grundsätzlichen Verständnis der Sozialen Arbeit und deren Fachkräften, werden verschiedene Positionen zum Thema Parteilichkeit vertreten; die unterschiedlichen Auffassungen haben sich zu differenzierten wissenschaftstheoretischen Positionen verfestigt (vgl. Hartwig 2000:97); manche schließen parteiliches Handeln aus, manche nehmen gar keine Stellung zu diesem Thema und andere wiederum empfehlen oder fordern sogar eine Parteilichkeit. Folgend wird eine Auswahl an einigen bekannten Auffassungen knapp vorgestellt.
Alice Salomon zählte zur Professionalität sozialer Arbeit nicht nur eine Kenntnis über die Lebensbedingungen der Menschen, sondern auch eine empathische Haltung ihnen gegenüber (vgl. Kuhlmann 2000:16). Entsprechend Salomons Verständnis von professioneller Arbeit verstehen sich Fachkräfte als Anwälte ihrer AdressatInnen und haben durchaus eine politische Haltung zu ihren Tätigkeiten. Sie verwies einerseits aber auch auf die wesentliche Differenz zwischen Politik und sozialer Arbeit und andererseits darauf, dass „niemand einen anderen dadurch stark machen könne, indem er für diesen anderen arbeitet“ (Kuhlmann 2000:20).
Hans Scherpner, Sozialarbeitswissenschaftler, sprach sich gegen die Parteilichkeit als politische Handlung aus, betonte jedoch eine sympathisierende Identifikation mit den AdressatInnen als Helfermotiv.
Lutz Rössner, Vertreter einer kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft, kombinierte den Begriff Parteilichkeit mit dem Begriff Normalisierung, parteiliches Vorgehen war ihm grundsätzlich fremd. Er erachtete allein die fachliche Diagnose als Erkenntnisgewinn für Veränderungsbedarf und als Grundlage aller Handlungsschritte.
Ernst Engelke, Professor mit den Lehr- und Forschungsgebieten Theorien und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit, schließt sich Fritz Haags Ansatz an und vertritt die Ansicht, dass der Begriff Parteilichkeit nicht umfassend genug und Ausdruck einer verdeckten, machtbetonten und ablehnenswerten Herrschaft sei. Die autonome Sozialarbeit soll (sich selbst eingeschlossen) kritisch verändern und sich für die Umwelt und AdressatInnen öffnen (vgl. Hartwig 2000:97).
Silvia Staub-Bernasconi spricht in der Diskussion um Mandantschaften in der Sozialen Arbeit von einem Tripel-Mandat: dem doppelten Mandat von Gesellschaft/Trägerschaft und AdressatInnen, das zudem als 3. Verpflichtung auch eine Verpflichtung gegenüber der Profession als solche hat, welche zum einen unabhängig von illegitimem gesellschaftlichem Konformitätsdruck, zum andern unabhängig von illegitimen Ansprüchen der AdressatInnen ist . Die Verpflichtung beinhaltet den Bezug auf wissenschaftsbasierte Methoden sowie auf den
(inter-)nationalen Berufskodex der Sozialarbeitenden, der auch die Verpflichtung zur Einhaltung und Durchsetzung der Menschenrechte enthält. In den UN-Manual Social Work and Human Rights ist auch eine Passage enthalten, die festschreibt, dass sich die Profession Sozialer Arbeit im Zweifelsfall auf die Seite ihrer AdressatInnen und somit gegen die Organisation stellen muss (vgl. Staub- Bernasconi 2005:21).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Parteilichkeit in der Sozialen Arbeit?
Parteilichkeit kennzeichnet eine sozialarbeiterische Haltung und ein solidarisches Engagement im Umgang mit Adressaten sowie eine sozialpolitische Positionierung, die in bestimmten Arbeitsbereichen zum Handlungsprinzip wird.
Wie hat sich der Begriff der Parteilichkeit historisch entwickelt?
Ursprünglich entstand der Begriff als radikaler politischer Anspruch in feministischen Projekten. In den 80er Jahren wurde er modifiziert, als therapeutische Bedarfe und die professionelle Distanz stärker in den Fokus rückten.
Was versteht Silvia Staub-Bernasconi unter dem Tripel-Mandat?
Das Tripel-Mandat umfasst die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft/Trägerschaft, den Adressaten und der Profession selbst, wobei letztere auf wissenschaftlichen Methoden und Menschenrechten basiert.
Welche Rolle spielt Parteilichkeit in der heutigen Mädchen- und Frauenarbeit?
In Konzepten der Mädchen- und Frauenarbeit ist Parteilichkeit auch heute noch eine wesentliche Grundlage des professionellen Handelns.
Welche Position vertrat Alice Salomon zur Parteilichkeit?
Salomon sah Fachkräfte als Anwälte ihrer Adressaten mit politischer Haltung, betonte jedoch die Differenz zwischen Politik und Sozialer Arbeit sowie die Notwendigkeit der Selbstermächtigung der Betroffenen.
Was besagt der UN-Manual Social Work and Human Rights zur Parteilichkeit?
Der Manual schreibt fest, dass sich die Profession im Zweifelsfall auf die Seite der Adressaten und somit gegen die eigene Organisation stellen muss.
- Arbeit zitieren
- Vera Papadopoulos (Autor:in), 2012, Parteilichkeit in der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209292