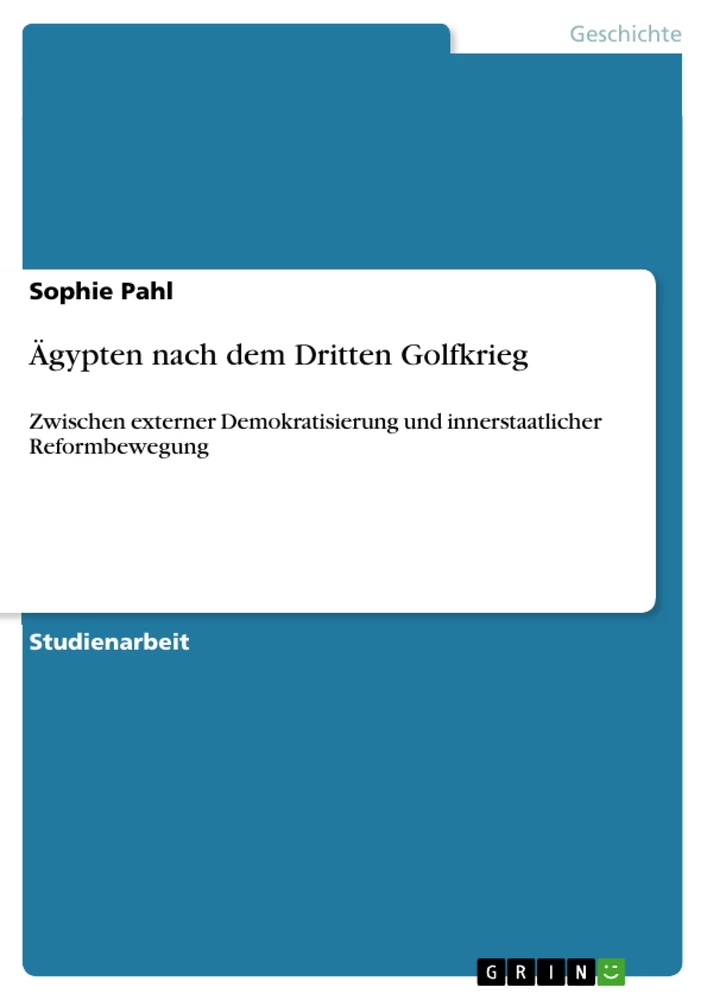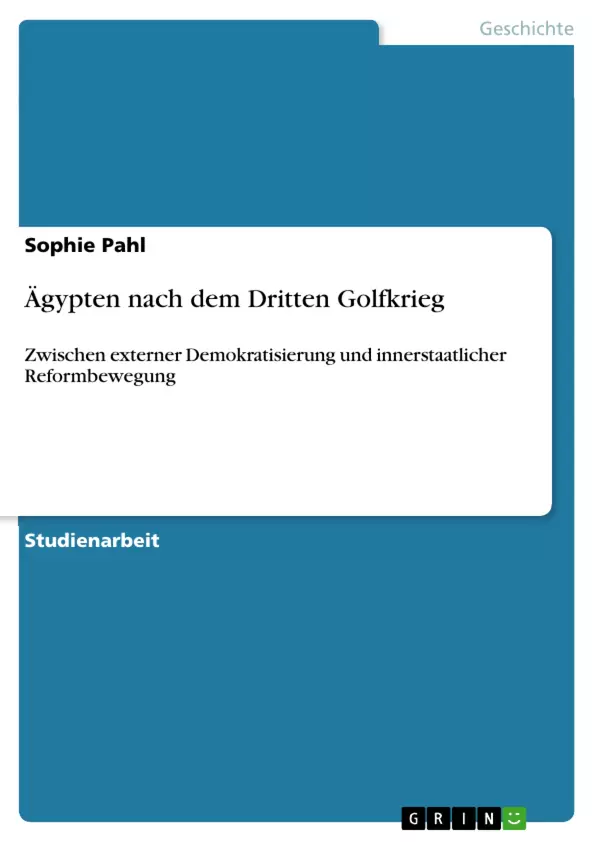Am 25. Januar 2011 gingen in Ägypten Tausende Demonstranten auf die Straßen. Auf ihren Plakaten forderten sie „Revolution und Freiheit“. Dort stand auch: „Tunesien ist die Lösung“. Und sie riefen: „Mubarak – geh, geh, wir wollen Dich nicht!“. Doch wie konnte es in Ägypten so schnell so weit kommen? Zwar hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Demonstrationen gegeben, doch hatte das autokratische Regime bis zum 25. Januar immer die Kontrolle behalten. Was war also passiert? Um sich darüber klar zu werden, ist es entscheidend, zunächst zu untersuchen, auf welche Voraussetzungen die aufkeimenden Freiheitsbestrebungen trafen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vorgeschichte
3. Vom „Kairoer Frühling“ zum „Kairoer Winter“
4. Die politische Landschaft nach dem „Kairoer Winter“
5. Fazit
6. Bibliographie
- Quote paper
- Sophie Pahl (Author), 2011, Ägypten nach dem Dritten Golfkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209388