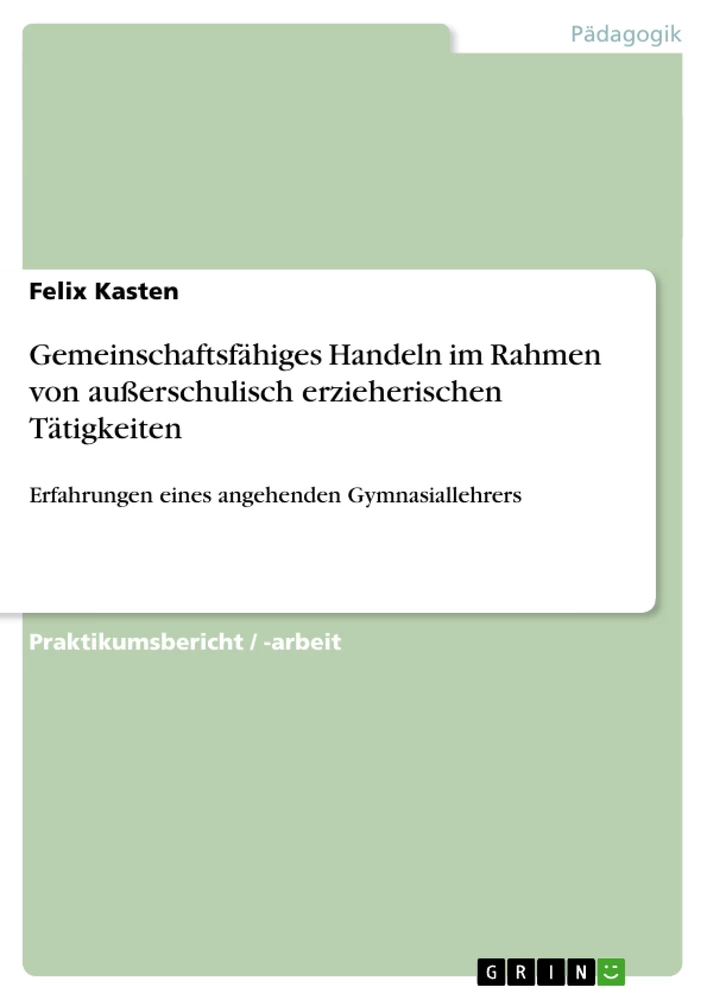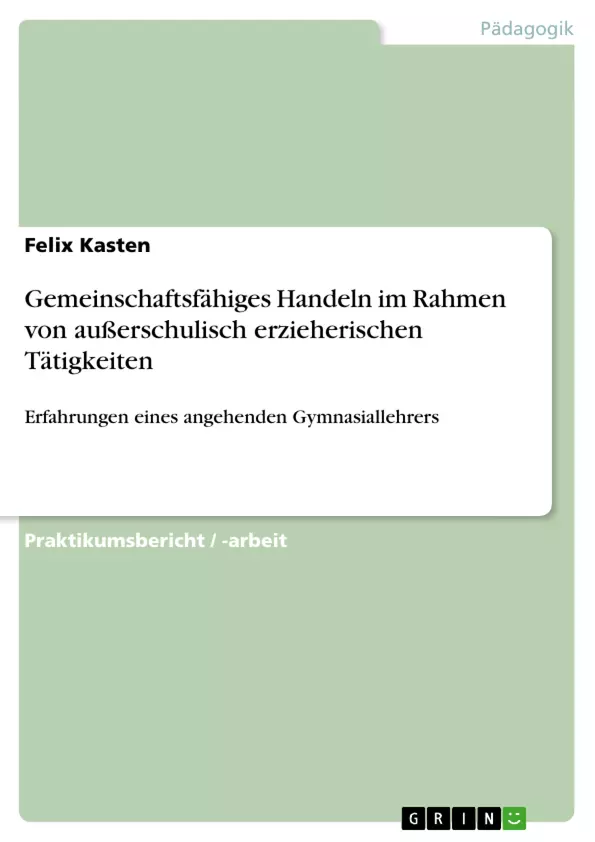Aufgrund meines Interesses an dem Lehrerberuf nahm ich im Februar 2005 eine Übungsleitertätigkeit im Bereich Volleyball im Freizeitsport beim Sportverein Fortuna Rostock e.V. (im Folgenden kurz: SV Fortuna) an. Der SV Fortuna ist ein sehr junger Verein. [...] 2009 wurde er mit den „Sternen des Sports“ ausgezeichnet, ein Preis für die soziale Arbeit des Vereins. Der SV Fortuna hat neben einem großen Angebot aus Tanzgruppen, Kindersport und Mutterkindersport u.a. auch zwei Volleyballgruppen, eine dieser wird von mir geleitet. Zwei mal im Jahr (seit 2009 vier Mal) veranstaltet der SV Fortuna ein Volleyballturnier für Freizeitsportmannschaften, bei dessen Organisation, Betreuung, sowie auch Durchführung und Aufbau ich seit der Einführung beteiligt bin.
Sportler fast jeder Altersklasse nehmen an meinen Übungseinheiten teil, unter anderem auch Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren. Daher ist es mir möglich, dies als Sozialpraktikum anrechnen zu lassen. Zunächst trainierte ich mit den Sportbegeisterten am Freitag von 20 bis 21:30 Uhr in der Sporthalle der Borwinschule am Kabutzenhof. Dies stellte sich aber als äußerst ungünstige Zeit heraus, sodass um weitere Sportler für die Gruppe zu interessieren und zu gewinnen, die Zeit auf Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr verlegt werden musste. Zu meinem Erstaunen kamen hier viele junge Interessenten, um daran teilzunehmen, trotz der Schule/Arbeit, die am nächsten Tag stattfindet. Während meiner Tätigkeit absolvierte ich verschiedene Kurse zur Weiterbildung, um als Übungsleiter kompetenter, aber vor allem auch organisierter und sicherer zu werden. Dies bezüglich belegte ich den „Grundkurs zur Ausbildung von Übungsleitern C, Fachübungsleitern C, Trainern C der 1. Lizenzstufe“ beim SSB Rostock und erwarb eine Lizenz als „Übungsleiter C für Breitensport Kinder/Jugendliche“ beim KSB Bad Doberan.
Bewegung ist also ein wesentlicher Bestandteil meiner Freizeitgestaltung. Ich interessiere mich für vielerlei Arten von Sport. Umso wichtiger ist es für mich, dass das neu gewonnene theoretische Wissen mir gleichfalls neue Erkenntnisse und Einsichten in der pädagogischen Praxis bringen. Im Folgenden wird erläutert, welche erzieherischen Aufgaben der Übungsleiter zu bewerkstelligen hat und welche Dinge in seinen Aufgabenbereich hineinfallen. Die zentrale Thematik ist dabei die Arbeit eines Übungsleiters zu charakterisieren.
Abschließend gilt es, Schlussfolgerungen hinsichtlich der pädagogischen Arbeit zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
1.0 Einleitung
2.0 Aufgabenfelder und Tätigkeiten
3.0 Beobachtungen während der Realisierung
4.0 Fazit
5.0 Anhang
5.1 Anmerkung
5.2 Literaturverzeichnis
5.3 Übungsplan
1.0 Einleitung
Die Lehrerausbildung gliedert sich in zwei Phasen. Die erste bezeichnet man als universitäre Phase, in der die erziehungswissenschaftlichen und vor allem fachlichen Elemente näher erläutert werden. Diese ist segmentiert in das Grundstudium und das Hauptstudium, dem sich dann das 1. Staatsexamen anschließt. Die zweite Phase ist das sogenannte Referendariat, in dem die berufspraktische Ausbildung im Vordergrund steht. Die Grundlagen dafür bilden die Praktika während des Studiums. Eines dieser grundlegenden Praktika ist das Sozialpraktikum (die anderen beiden sind Schulpraktika), in dem außerschulisch erzieherische Tätigkeiten und soziales Verhalten praktiziert werden soll. Der Schwerpunkt liegt darin, die Arbeit und den Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 19 Jahren zu üben. Das Praktikum kann in verschiedenen Einrichtungen absolviert werden, die außerschulisch betreuend, präventiv oder intervenierend tätig sind. Sozial bedeutet in diesem Zusammenhang gemeinschaftsfähig zu handeln. Es soll eine sogenannte Sozialerziehung stattfinden, d.h. einerseits die „Vermittlung von Gemeinschaftsfähigkeit wie Toleranz [und] Rücksichtnahme“, wie zum Beispiel gegenüber Leistungsschwächeren oder religiösen Personen, andererseits die „Eingliederung in eine Gruppe durch erzieherische Maßnahmen“(Büchin-Wilhelm, Jaszus 2006, 12). Es ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Ausbildung, da hier erstmals der angehende Pädagoge die Möglichkeit hat, die Theorie aus den Vorlesungen und Seminaren in die Praxis umzusetzen und daraus resultierend sich selbst als Pädagoge trainiert. Unter anderem kann es dazu führen, dass dem Studenten ein weiterer Motivationsschub gegeben wird, denn es unterstützt die kritische Auseinandersetzung mit den Zielen und Erwartungen von sich selbst oder vom Studium innerhalb der Ausbildungszeit.
Aufgrund meines Interesses an dem Lehrerberuf nahm ich im Februar 2005 eine Übungsleitertätigkeit im Bereich Volleyball im Freizeitsport beim Sportverein Fortuna Rostock e.V. (im Folgenden kurz: SV Fortuna) an. Der SV Fortuna ist ein sehr junger Verein. Er wurde Ende des Jahres 2005 gegründet und genießt seit Beginn eine sehr hohe Zuwachsrate, in den ersten Jahren sogar die höchste aller Rostocker Vereine. 2009 wurde er mit den „Sternen des Sports“ ausgezeichnet, ein Preis für die soziale Arbeit des Vereins. Der SV Fortuna hat neben einem großen Angebot aus Tanzgruppen, Kindersport und Mutterkindersport u.a. auch zwei Volleyballgruppen, eine dieser wird von mir geleitet. Zwei mal im Jahr (seit 2009 vier Mal) veranstaltet der SV Fortuna ein Volleyballturnier für Freizeitsportmannschaften, bei dessen Organisation, Betreuung, sowie auch Durchführung und Aufbau ich seit der Einführung beteiligt bin.
Sportler fast jeder Altersklasse nehmen an meinen Übungseinheiten teil, unter anderem auch Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren. Daher ist es mir möglich, dies als Sozialpraktikum anrechnen zu lassen. Zunächst trainierte ich mit den Sportbegeisterten am Freitag von 20 bis 21:30 Uhr in der Sporthalle der Borwinschule am Kabutzenhof. Dies stellte sich aber als äußerst ungünstige Zeit heraus, sodass um weitere Sportler für die Gruppe zu interessieren und zu gewinnen, die Zeit auf Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr verlegt werden musste. Zu meinem Erstaunen kamen hier viele junge Interessenten, um daran teilzunehmen, trotz der Schule/Arbeit, die am nächsten Tag stattfindet. Während meiner Tätigkeit absolvierte ich verschiedene Kurse zur Weiterbildung, um als Übungsleiter kompetenter, aber vor allem auch organisierter und sicherer zu werden. Dies bezüglich belegte ich den „Grundkurs zur Ausbildung von Übungsleitern C, Fachübungsleitern C, Trainern C der 1. Lizenzstufe“ beim SSB Rostock und erwarb eine Lizenz als „Übungsleiter C für Breitensport Kinder/Jugendliche“ beim KSB Bad Doberan.
Bewegung ist also ein wesentlicher Bestandteil meiner Freizeitgestaltung. Ich interessiere mich für vielerlei Arten von Sport. Umso wichtiger ist es für mich, dass das neu gewonnene theoretische Wissen mir gleichfalls neue Erkenntnisse und Einsichten in der pädagogischen Praxis bringen. Im Folgenden wird erläutert, welche erzieherischen Aufgaben der Übungsleiter zu bewerkstelligen hat und welche Dinge in seinen Aufgabenbereich hineinfallen. Die zentrale Thematik ist dabei die Arbeit eines Übungsleiters zu charakterisieren.
Abschließend gilt es, Schlussfolgerungen hinsichtlich der pädagogischen Arbeit zu ziehen.
2.0 Aufgabenfelder und Tätigkeiten
Das folgende Kapitel soll die theoretischen Grundlagen der Übungsleitertätigkeit aufzeigen. Zum einen werden die Aufgaben des Übungsleiters erläutert, zum anderen wichtige didaktische und pädagogische Grundsätze beschrieben.
In erster Linie leitet der Übungsleiter, wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, das Üben, das in der Regel in Gruppen stattfindet. Allerdings muss selbst das Leiten zu Beginn erprobt werden. Das bedeutet letztlich, dass personelle Voraussetzungen erworben werden müssen, um erfolgreich die Führungsfunktionen zu erfüllen. Man muss sich als kompetent erweisen und sich einer vernunftgemäßen Kommunikation mit den Sportlern bedienen. Der Übungsleiter muss die Sportler motivieren, Verantwortung für jene übernehmen und gleichzeitig als „Vorgesetzter“ geachtet werden.
Die Aufgaben des Übungsleiters sind sehr vielseitig. Er muss Übungseinheiten planen, vorbereiten und durchführen, bis am Schluss die Auswertung erfolgt. Dazu gehört auch die Auswahl von entsprechenden Übungsinhalten, eine Entscheidung über geeignete Methoden, sowie die Berücksichtigung personeller und materieller Bedingungen. Ein kleines Beispiel für 12 Übungseinheiten ist dem Anhang zu entnehmen.
Das Planen der Einheit ist von essentieller Bedeutung, da es dazu dient, den gesetzten Absichten nachzugehen. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Vorsätzen: Die Fernziele und die Nahziele einerseits, andererseits kann auch eine Unterteilung in Lehrziele und Lernziele vorgenommen werden, die jeweils Erklärung finden sollen. Fernziele sind langfristige Ziele, die aus dem Zusammenwirken verschiedener Nahziele, kurzfristige Ziele, resultieren. Als Beispiel hierfür ist in spielnahen Situationen das Spielvermögen zu verbessern, um dann wiederum bei Turnieren erfolgreicher zu sein. Die Nahziele stellen die Bewältigung der einzelnen Aufgaben dar, das Fernziel ist, in diesem Fall, den Spielbetrieb zu verbessen. Damit sind auch die Lernziele gegeben, denn die Sportler wollen die jeweiligen Bewegungsabläufe lernen. Damit sind ebenfalls die Lehrziele verknüpft. Diese dienen dazu, mittels verschiedener Lehrmethoden das Lernen der Sportler zu ermöglichen.
Eine wichtige Zielstellung herrscht unabhängig von Alter und Leistungsvoraussetzungen vor, nämlich die eigene Handlungsfähigkeit in dem jeweils gewählten Sportbereich zu verbessern, in meinem Fall Volleyball. Beim Volleyball sind es primär die Spielfähigkeiten der Grundfertigkeiten, wie das obere und untere Zuspiel, der Angriff oder auch die Abwehr und die Aufgabe. Sekundär geht damit die Kommunikation während des Spielverlaufs einher. Das motorische bzw. sportliche Handeln rückt aber deutlich in den Vordergrund der Lernprozesse. Aufgrund der Ähnlichkeit vieler Bewegungsabläufe stellt also sportliches Handeln eine komplexe Anforderung an die Persönlichkeit der Sportler dar. Das Planen soll unter anderem auch die zeitliche Abfolge gliedern. Diese reicht vom Erwärmen, das das Verletzungsrisiko erheblich senkt, über die eigentliche Übungseinheit, in diesem Falle Volleyball spielen, bis hin zum Ausklingen. Innerhalb dieser Gliederung hat man viel Freiraum für die Planung. Einerseits kann man die Sportler mit spielerischen Übungen zu erhöhten Leistungen motivieren, andererseits ist es möglich, viele spielnahe Situationen einzubinden oder einfach Grundübungen aufzuziehen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines Sozialpraktikums im Lehramtsstudium?
Das Ziel ist das Einüben von außerschulisch erzieherischen Tätigkeiten und sozialem Verhalten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 19 Jahren.
Welche Aufgaben hat ein Übungsleiter im Sportverein?
Ein Übungsleiter plant, führt durch und wertet Übungseinheiten aus. Er übernimmt Verantwortung, motiviert Sportler und vermittelt soziale Kompetenzen wie Toleranz und Rücksichtnahme.
Was bedeutet "Sozialerziehung" im Sportkontext?
Sozialerziehung umfasst die Vermittlung von Gemeinschaftsfähigkeit sowie die Eingliederung des Einzelnen in eine Gruppe durch pädagogische Maßnahmen.
Welche Lizenzen sind für Übungsleiter relevant?
Relevant ist beispielsweise die Lizenz „Übungsleiter C für Breitensport Kinder/Jugendliche“, die durch entsprechende Grundkurse erworben werden kann.
Wie unterscheiden sich Fernziele und Nahziele in der Trainingsplanung?
Fernziele sind langfristig (z.B. Turniersiege), während Nahziele die Bewältigung einzelner technischer Aufgaben in einer Übungseinheit beschreiben.
- Citar trabajo
- Felix Kasten (Autor), 2009, Gemeinschaftsfähiges Handeln im Rahmen von außerschulisch erzieherischen Tätigkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209562