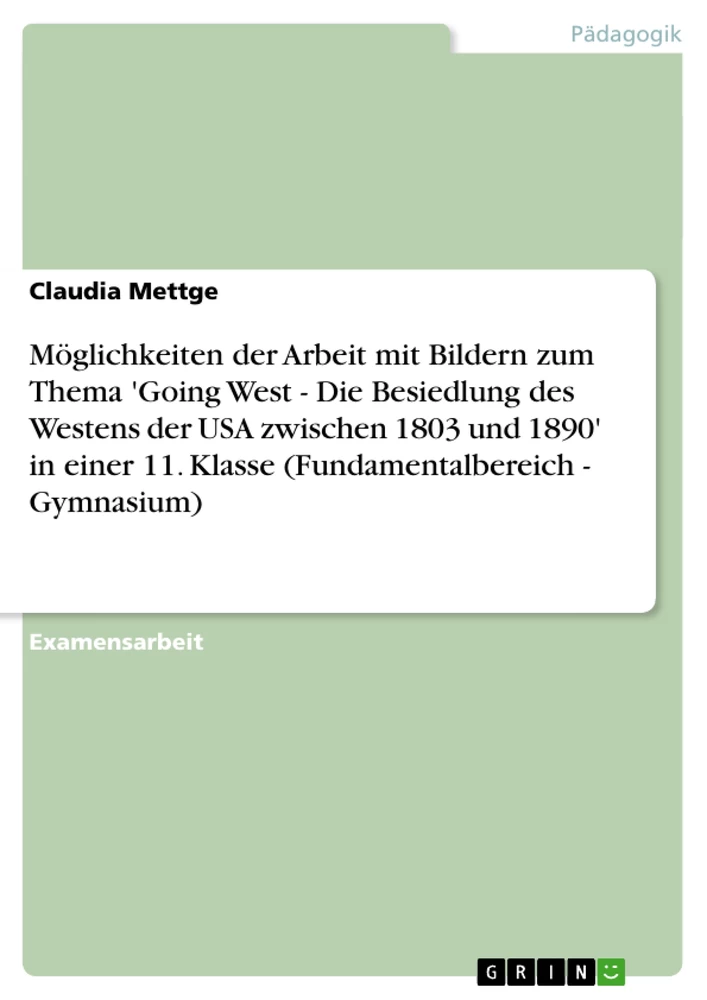Wir leben heute in einer von visuellen Reizen überladenen Welt – Fernsehen, Video, Zeitschriften und Zeitungen, Werbung und das Internet arbeiten mit den verschiedensten Mitteln, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Alle verwenden Bilder und optische Anreize, um die gewünschte Aufmerksamkeit sicherzustellen. Anlässlich dieser Dominanz des Visuellen im alltäglichen Bereich fragt man sich, wenn diese denn offensichtlich so erfolgreich ist, warum nicht ähnliche Mittel viel häufiger im Unterricht genutzt werden.
Ein Ansinnen dieser Arbeit ist es somit, zu untersuchen, ob Bilder positive Effekte im Lernen bewirken können, ob hierdurch Motivation, Aufmerksamkeit und Behaltensleistung befördert werden können.
Dieser Ansatz ist nicht neu, die Tradition des Lernens mit Bildern begann mit Comenius, sie wird von Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik fortgesetzt. Dabei beschränkt sich erstere aber häufig auf die Untersuchung des Lernens mit Bildern bei jüngeren Kindern, etwa im Grundschulalter, wohingegen letztere stark auf den Bereich der Sekundarstufe I, also den beginnenden Fremdsprachenerwerb, fokussiert. In der Sekundarstufe II, die hier im Mittelpunkt der Betrachtung steht, wird der Bildeinsatz theoretisch weniger häufig gestreift.
Erstaunlicherweise ist das Bild heutzutage trotz der intensiven Forschung zumeist nur als schmückendes Beiwerk im Unterricht anzutreffen. Andere Medien haben es wieder verdrängt, zudem eine deutliche Dominanz des geschriebenen Wortes vorherrscht. Eindeutige Definitionen, handfeste Bildungsinhalte sind in der Schule dem Arbeiten auf mehreren Eingangskanälen gleichzeitig vorzuziehen, lautet die landläufige Meinung. Ob es nicht vielleicht auch anders geht, und trotzdem (oder gerade deshalb) gelernt wird, soll hier erprobt werden.
Aus den Eingangsbemerkungen zur visuellen Flut im alltäglichen Leben ergibt sich die Notwendigkeit, diese auch in die Schule schwappen zu lassen, um dort eine Kompetenz der Schüler zu entwickeln, selbständig mit Bildinformationen umgehen zu können. Dies ist Teil dessen, was unter dem Stichwort „visual literacy“ diskutiert wird.
Ziel der Arbeit wird es sein, zunächst eine theoretische Grundlage zum Lernen mit Bildern zu schaffen, um diese dann in der Praxis umsetzen zu können. Daran anschließend sollen die praktischen Erfahrungen wiederum reflektiert und analysiert werden. Meine Ausgangsthese hierbei ist, dass im Englischunterricht mit Bildern sinnvoll inhaltlich und sprachlich gearbeitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Wahrnehmung
- 2.2. Visuelle Medien im Englischunterricht
- 2.3. Funktionen und Möglichkeiten von Bildern im Unterricht
- 2.4. Tiefere Darlegung einzelner Varianten
- 2.4.1. Möglichkeit 1: Aktivierung und Antizipation (1. Stunde)
- 2.4.2. Möglichkeit 2: Kreatives Schreiben zu Bildern (3. Stunde)
- 2.4.3. Möglichkeit 3: Dialogerstellung zu Bildern (6. Stunde)
- 2.4.4. Möglichkeit 4: Wiederholung (8. Stunde)
- 3. Unterrichtsvoraussetzungen
- 3.1. Allgemeine Unterrichtsvoraussetzungen
- 3.2. Spezielle Unterrichtsvoraussetzungen
- 4. Planung der Unterrichtsreihe
- 4.1. Didaktisch-methodische Überlegungen und Entscheidungen
- 4.2. Thematische Schwerpunkte - Sachanalyse
- 4.3 Auswahl der sprachlichen Schwerpunkte
- 4.4. Auswahl der Bildmedien
- 4.5. Lernziele
- 4.6. Klausur
- 5. Synopse der Unterrichtsreihe
- 6. Durchführung und Analyse ausgewählter Unterrichtsstunden
- 6.1. Möglichkeit 1: Aktivierung und Antizipation
- 6.2. Möglichkeit 2: Kreatives Schreiben zu Bildern
- 6.3. Möglichkeit 3: Dialogerstellung zu Bildern
- 6.4. Möglichkeit 4: Wiederholung
- 6.5. Analyse Klassenarbeit
- 7. Gesamtreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Bilder positive Effekte im Lernen bewirken können, ob sie Motivation, Aufmerksamkeit und Behaltensleistung fördern. Ziel ist es, eine theoretische Grundlage für den Einsatz von Bildern im Englischunterricht zu schaffen, diese in der Praxis umzusetzen und die Erfahrungen zu reflektieren. Dabei wird die These vertreten, dass mit Bildern im Englischunterricht sinnvoll inhaltlich und sprachlich gearbeitet werden kann.
- Theoretische Grundlagen zum Lernen mit Bildern
- Wahrnehmungstheoretische Aspekte und die Rolle des Sehens
- Einsatz visueller Medien im Englischunterricht
- Funktionen und Möglichkeiten von Bildern im Unterricht
- Praktische Umsetzung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und begründet die Relevanz des Themas im Hinblick auf die Dominanz visueller Medien im Alltag. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Lernens mit Bildern, indem es die Wahrnehmungstheorie, die Bedeutung visueller Medien im Englischunterricht und die Funktionen von Bildern im Unterricht diskutiert. Kapitel 3 beschreibt die Unterrichtsvoraussetzungen, sowohl allgemein als auch spezifisch für die Unterrichtsreihe. In Kapitel 4 wird die Planung der Unterrichtsreihe detailliert dargestellt, inklusive didaktisch-methodischer Überlegungen, thematischer und sprachlicher Schwerpunkte, der Auswahl der Bildmedien, der Lernziele und der Klausur. Kapitel 5 bietet eine Synopse der Unterrichtsreihe. Kapitel 6 widmet sich der Durchführung und Analyse ausgewählter Unterrichtsstunden, darunter die Möglichkeiten der Aktivierung und Antizipation, des kreativen Schreibens zu Bildern, der Dialogerstellung zu Bildern und der Wiederholung, sowie der Analyse der Klassenarbeit. Die Arbeit schließt mit einer Gesamtreflexion.
Schlüsselwörter
Visuelle Medien, Englischunterricht, Wahrnehmung, Lernen, Bilder, Motivation, Aufmerksamkeit, Behaltensleistung, Unterrichtsplanung, Didaktik, Methodik, Unterrichtspraxis, Analyse, Reflexion, Visual Literacy.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist "Visual Literacy" im Unterricht wichtig?
In einer visuell geprägten Welt müssen Schüler lernen, Bildinformationen selbstständig zu analysieren und kritisch zu hinterfragen.
Wie können Bilder die Motivation im Englischunterricht steigern?
Bilder dienen als Sprech- und Schreibanlässe, fördern die Antizipation von Inhalten und erleichtern das Behalten von Vokabeln durch visuelle Verknüpfung.
Welche Methoden eignen sich für die Arbeit mit Bildern?
Bewährte Methoden sind kreatives Schreiben zu Bildern, die Erstellung von Dialogen basierend auf Bildszenen oder die Bildbeschreibung zur Aktivierung von Vorwissen.
Was war der historische Kontext "Going West"?
Es handelt sich um die Besiedlung des Westens der USA zwischen 1803 und 1890, ein Thema, das reich an visuellem Quellenmaterial ist.
Sind Bilder nur "schmückendes Beiwerk" im Lehrbuch?
Nein, die Fachdidaktik zeigt, dass Bilder als eigenständige Informationsträger fungieren können, die tiefere Lernprozesse anstoßen als reiner Text.
- Quote paper
- Claudia Mettge (Author), 2002, Möglichkeiten der Arbeit mit Bildern zum Thema 'Going West - Die Besiedlung des Westens der USA zwischen 1803 und 1890' in einer 11. Klasse (Fundamentalbereich - Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20958