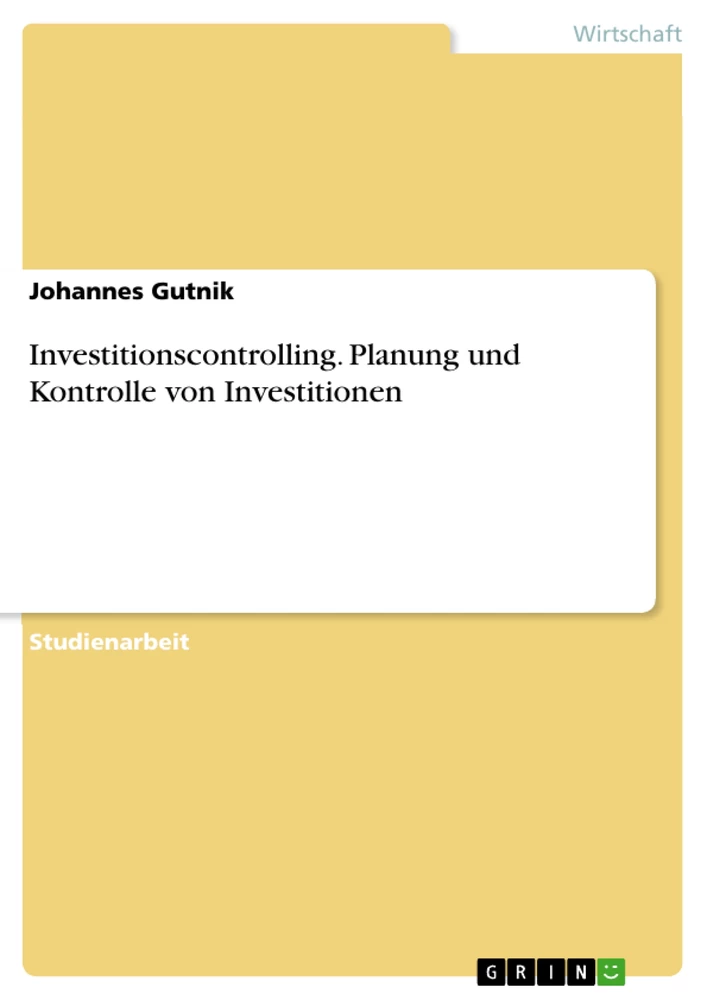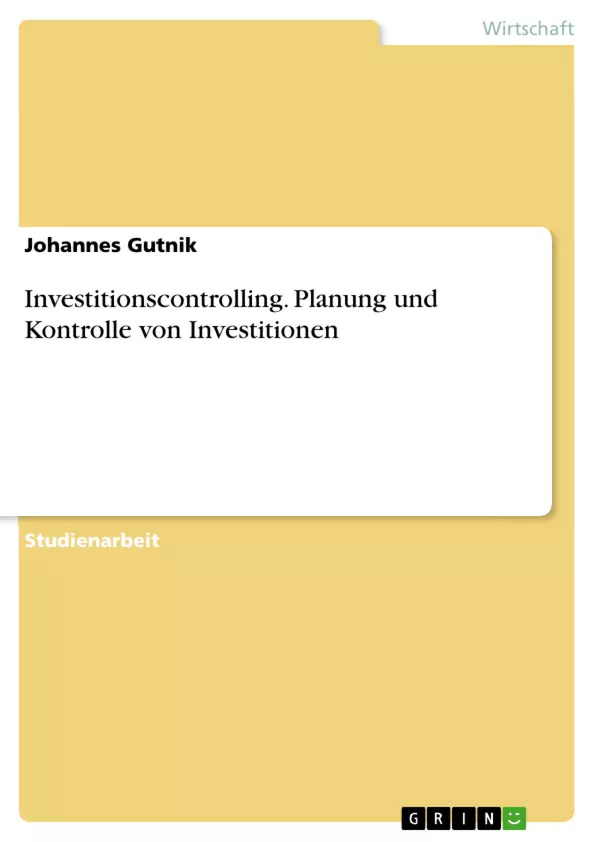Investitionen sind bedeutende Entscheidungen eines Unternehmens, die sowohl Erfolgspotentiale als auch Risiken bergen. Sie sind durch eine hohe und langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet und haben meist Auswirkungen auf andere Bereiche des Unternehmens. Deshalb sind Investitionen eine der wichtigsten Entscheidungen, die die Unternehmensleitung fällen muss. Es ist aus einer Fülle von Methoden der Entscheidungshilfe zu wählen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Das Ziel der vorliegenden Abfassung ist es, einige Aufgaben und Methoden des Investitionscontrollings über den gesamten Investitionslebenszyklus darzustellen. Damit soll aufgezeigt werden wie es möglich ist Investitionsrisiken zu minimieren. Aus den Hauptaufgaben des Investitionscontrollings werden dabei die Planung und Kontrolle von Investitionen näher erläutert.
Dabei widmet sich Kapitel eins den Grundlagen von Investitionen und den zentralen Aufgaben des Investitionscontrollings. Das zweite Kapitel behandelt konventionelle Methoden der Investitionsrechnung, die eine monetäre Beurteilung von Investitionen möglich machen. In Kapitel drei werden einige Kontrollverfahren des Investitionscontrollings umfassend beschrieben. Abschließend werden Ergebnisse einer Benchmarking-Studie vorgestellt, die das Investitionscontrolling in deutschen Großunternehmen untersucht hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Investition
- 1.1 Definition
- 1.2 Aufgaben des Investitionscontrollings
- 2. Konventionelle Methoden der Investitionsrechnung
- 2.1 Statische Investitionsrechnung
- 2.1.1 Kostenvergleichsrechnung
- 2.1.2 Gewinnvergleichsrechnung
- 2.1.3 Renditevergleichsrechnung
- 2.1.4 Amortisationsrechnung
- 2.2 Dynamische Investitionsrechnung
- 2.2.1 Kapitalwertmethode
- 2.2.2 Annuitätenmethode
- 2.2.3 Interne Zinsfußmethode
- 2.1 Statische Investitionsrechnung
- 3. Investitionskontrollen
- 3.1 Zuordnung und Aufgaben der Investitionskontrollen innerhalb des Investitionscontrollings
- 3.2 Strategische Kontrollen des Investitionscontrollings
- 3.3 Sachzielkontrollen des Investitionscontrollings
- 3.4 Erfolgszielkontrollen des Investitionscontrollings
- 3.4.1 Ermittlung der Soll- und Ist-Daten
- 3.4.2 Die Abweichungsermittlung
- 3.4.3 Die Abweichungsanalyse
- 3.4.4 Der Kontrollbericht
- 3.4.5 Anregung von Korrekturmaßnahmen
- 4. Investitionskontrolle in der Praxis – Ergebnisse einer Benchmarking-Studie
- 4.1 Ablauf der Benchmarking-Studie
- 4.2 Kontrollbereiche
- 4.3 Kontrolleigenschaften in der Praxis
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit zielt darauf ab, die Planung und Kontrolle von Investitionen im Rahmen des Investitionscontrollings zu beleuchten. Es werden verschiedene Methoden der Investitionsrechnung vorgestellt und deren Anwendung im Kontext des Investitionslebenszyklus erläutert. Die Arbeit untersucht, wie Investitionsrisiken minimiert werden können.
- Grundlagen von Investitionen und Investitionscontrolling
- Konventionelle Methoden der Investitionsrechnung (statisch und dynamisch)
- Kontrollverfahren des Investitionscontrollings
- Ergebnisse einer Benchmarking-Studie zum Investitionscontrolling in deutschen Großunternehmen
- Minimierung von Investitionsrisiken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Investitionen ein und betont deren Bedeutung für Unternehmenserfolg und -risiken. Sie beschreibt die hohe Kapitalbindung und die weitreichenden Auswirkungen von Investitionsentscheidungen. Das Ziel der Arbeit wird als die Darstellung von Aufgaben und Methoden des Investitionscontrollings über den gesamten Investitionslebenszyklus definiert, mit dem Fokus auf Risikominimierung durch Planung und Kontrolle.
1. Investition: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Investition" und differenziert zwischen verschiedenen Definitionen und Klassifizierungen in der Literatur. Es werden unterschiedliche Investitionsarten (Sach-, Finanz-, immaterielle Investitionen) und Motive (Neu-, Ersatz-, Rationalisierungs-, Erweiterungsinvestitionen) erläutert und ihre Bedeutung für das Verständnis des Investitionscontrollings hervorgehoben. Die Aufgaben eines effektiven Investitionscontrollings werden skizziert, um den Rahmen für die folgenden Kapitel zu setzen.
2. Konventionelle Methoden der Investitionsrechnung: Dieses Kapitel befasst sich mit statischen und dynamischen Methoden der Investitionsrechnung. Die statischen Methoden (Kosten-, Gewinn-, Rendite- und Amortisationsvergleichsrechnung) werden kurz vorgestellt, während die dynamischen Methoden (Kapitalwert-, Annuitäten- und interne Zinsfußmethode) detaillierter erläutert werden. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren werden verglichen, um ein umfassendes Verständnis für deren Anwendung in der Praxis zu vermitteln. Die Kapitel verdeutlicht wie diese Methoden zu einer fundierten monetären Bewertung von Investitionsprojekten beitragen.
3. Investitionskontrollen: Dieses Kapitel beschreibt umfassend verschiedene Kontrollverfahren des Investitionscontrollings. Es werden strategische, sachziel- und erfolgszielorientierte Kontrollen differenziert behandelt. Der Fokus liegt auf der Erfolgszielkontrolle, welche die Ermittlung von Soll- und Ist-Daten, die Abweichungsermittlung, die Abweichungsanalyse, den Kontrollbericht und die Anregung von Korrekturmaßnahmen beinhaltet. Das Kapitel verdeutlicht die verschiedenen Phasen und Instrumente zur Überwachung und Steuerung von Investitionen.
4. Investitionskontrolle in der Praxis – Ergebnisse einer Benchmarking-Studie: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer Benchmarking-Studie, die das Investitionscontrolling in deutschen Großunternehmen untersucht. Der Ablauf der Studie wird beschrieben und die wichtigsten Ergebnisse zu den Kontrollbereichen und -eigenschaften in der Praxis werden analysiert. Die Studie dient dazu, die theoretischen Konzepte des Investitionscontrollings mit der tatsächlichen Praxis in Unternehmen zu vergleichen und aufzuzeigen welche Kontrollmethoden am häufigsten eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
Investitionscontrolling, Investitionsrechnung, statische Investitionsrechnung, dynamische Investitionsrechnung, Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode, interne Zinsfußmethode, Investitionskontrolle, Erfolgskontrolle, Sachzielkontrolle, Strategische Kontrolle, Benchmarking, Risikominimierung, Investitionsentscheidung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Investitionscontrolling
Was ist der Inhalt dieser Studienarbeit?
Diese Studienarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Investitionscontrolling. Sie deckt die Planung und Kontrolle von Investitionen ab, beginnend mit der Definition von Investitionen und verschiedenen Investitionsarten, über die Darstellung konventioneller Investitionsrechnungsmethoden (statisch und dynamisch), bis hin zur detaillierten Beschreibung von Kontrollverfahren im Investitionscontrolling und den Ergebnissen einer Benchmarking-Studie zur Praxis des Investitionscontrollings in deutschen Großunternehmen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Minimierung von Investitionsrisiken.
Welche Methoden der Investitionsrechnung werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt sowohl statische als auch dynamische Methoden der Investitionsrechnung. Zu den statischen Methoden gehören der Kostenvergleich, der Gewinnvergleich, der Renditevergleich und die Amortisationsrechnung. Die dynamischen Methoden umfassen die Kapitalwertmethode, die Annuitätenmethode und die interne Zinsfußmethode. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren werden verglichen.
Welche Arten von Kontrollen im Investitionscontrolling werden erläutert?
Die Studienarbeit unterscheidet zwischen strategischen, sachziel- und erfolgszielorientierten Kontrollen im Investitionscontrolling. Die Erfolgszielkontrolle wird besonders detailliert behandelt, inklusive der Ermittlung von Soll- und Ist-Daten, der Abweichungsanalyse und der Anregung von Korrekturmaßnahmen.
Welche Ergebnisse liefert die Benchmarking-Studie?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse einer Benchmarking-Studie zum Investitionscontrolling in deutschen Großunternehmen. Die Studie analysiert die in der Praxis eingesetzten Kontrollbereiche und -eigenschaften und vergleicht diese mit den theoretischen Konzepten des Investitionscontrollings. Der genaue Ablauf der Studie und die wichtigsten Ergebnisse werden beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Investitionscontrolling, Investitionsrechnung (statisch und dynamisch), Kapitalwertmethode, Annuitätenmethode, interne Zinsfußmethode, Investitionskontrolle, Erfolgskontrolle, Sachzielkontrolle, strategische Kontrolle, Benchmarking und Risikominimierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Investitionen, konventionellen Investitionsrechnungsmethoden, Investitionskontrollen, einer Präsentation der Ergebnisse der Benchmarking-Studie und einem Resümee. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welches Ziel verfolgt die Studienarbeit?
Die Studienarbeit zielt darauf ab, die Planung und Kontrolle von Investitionen im Rahmen des Investitionscontrollings zu beleuchten und aufzuzeigen, wie Investitionsrisiken minimiert werden können. Sie vermittelt ein umfassendes Verständnis der relevanten Methoden und Verfahren.
Für wen ist diese Studienarbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Investitionscontrolling auseinandersetzen, z.B. Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Praktiker im Finanz- und Rechnungswesen sowie Unternehmensberater.
Wo finde ich das detaillierte Inhaltsverzeichnis?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn des Dokuments und ist in Form einer übersichtlichen Liste strukturiert.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Jedes Kapitel wird in der Arbeit separat zusammengefasst, wobei die zentralen Inhalte und Erkenntnisse jedes Kapitels hervorgehoben werden. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über den jeweiligen Themenbereich.
- Quote paper
- Johannes Gutnik (Author), 2011, Investitionscontrolling. Planung und Kontrolle von Investitionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209584